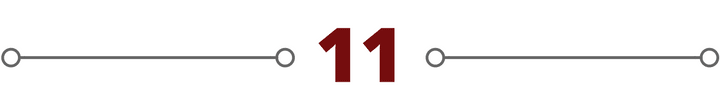Das fünfte Kapitel der Gheranda Samhita widmet sich den yogischen Atemtechniken: Pranayama. Gleich im ersten Vers wird das Resultat ausdauernder Pranayamaübung klar benannt: Der Praktizierende wird gottgleich.
Prana steht im Yoga für Lebensenergie. Meist werden beim Pranayama zwei Ziele verfolgt:
- Mehr Lebensenergie zu erhalten.
- Den Geist zu beruhigen und zu sammeln.
Immer wieder, so auch hier, wird vor dem allzu sorglosen Üben von Pranayama gewarnt. Zu fatal können die Auswirkungen von falschem und allzu heftig durchgeführten Atemübungen sein. Darum wird immer die Schulung durch einen fachkundigen Lehrer angemahnt.
Aus meiner Sicht spricht aber nichts dagegen, die sanften Atemtechniken mit dem primären Ziel des ruhigen Geistes zu üben. Diese sind Bestandteil vieler spiritueller Lehren und werden seit Jahrtausenden angewendet.
Die einzelnen Verse des fünften Kapitels der Gheranda Samhita lauten frei übersetzt:
Inhalt
Im Folgenden findest du meist den Volltext, an einigen wenigen Stellen Zusammenfassungen der einzelnen Verse, meist mit weiterführenden Links zu den Yoga-Techniken. Ich habe mich nach bestem Wissen bemüht, die trefflichste Übersetzung aus den Quelltexten zu wählen (hin und wieder gab es darin doch deutliche Unterschiede, wurden die Übungen völlig unterschiedlich beschrieben).
Das Ziel von Pranayama
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 1
Durch die Praxis des Atemanhaltens wird der regelmäßig Übende, der die korrekten Regeln einhält, gottgleich.
Die günstigen Bedingungen für Pranayama
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 2
Die Erfordernisse für Pranayama sind: ein günstiger/angenehmer Platz, eine angemessene Zeit, Maßhalten bei der Nahrung und eine Reinigung der Nadis [Kanäle]. Damit beginnt Pranayama.
Anmerkung: Diese Bedingungen finden sich in vielen Yogaschriften für das Üben von Yoga im Allgemeinen.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 3
Die Yogapraxis soll nicht an einem von der Heimat weit entfernten Ort begonnen werden. Auch nicht im Wald oder am Hofe eines Königs [steht vermutlich allgemein für "da wo viel Trubel herrscht] oder inmitten einer Menge von Menschen. Tut man dies dennoch dort, so verhindert man den Erfolg der Übungen.
Anmerkung: Vergleiche für die Bedingungen an den Ort Hatha Yoga Pradipika, 1. Kapitel, Verse 11-20.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 4
In einem fernen Land hat der Schüler kein Vertrauen, im Wald keine Sicherheit und inmitten von vielen Menschen wird er abgelenkt. Darum gilt es, diese drei Orte zu meiden.

Die Yogi-Hütte
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 5
In einer schönen Umgebung, in einem Land mit gerechter Regierung, wo der Yogi sein Auskommen [alternativ: es Almosen gibt] hat und es keine Störungen gibt, baue man sich eine Hütte und umzäune diese.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 6
Innerhalb dieser Umzäunung soll ein Brunnen und ein Teich sein [vermutlich gemeint: Wasser zum Trinken und einen Ort zum Reinigen]. Die Hütte sei nicht zu hoch und nicht zu niedrig und frei von Ungeziefer.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 7
Diese Hütte soll versteckt liegen und fensterlos sein. Man bestreiche die Wände mit Kuhmist [vermutliches Ziel: die Hütte ist dicht] und übe dann darin Pranayama.
Die günstige Jahreszeit für Pranayama
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 8
Man soll Yoga nicht im Winter, in kühler Jahreszeit, im Hochsommer oder während der Regenzeit starten. So vermeidet der Yogi Krankheiten durch Yoga.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 9 bis 15
Hierin werden die Jahreszeiten erläutert. Das Fazit lautet:
Man beginne Yoga im Frühling oder im Herbst. Dies führt zum Erfolg und vermeidet yogabedingte Krankheiten.
Günstige Ernährung für Pranayama
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 16
Wer Yoga ohne Mäßigung im Essen beginnt, wird von vielen Krankheiten heimgesucht und hat keinen Erfolg.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 17 bis 21
Hier wird mögliche Yoga-Nahrung aufgeführt. Dazu gehören Reisspeise, Gerste, Weizen, Mungo-Bohnen, Masa-Bohnen, Kichererbsen, Gurken, Muskat, Krebse, Wurzeln, grünes Blattgemüse und Heilkräuter. Alles sei sauber und frei von Spelzen [Hülsen].
Die Nahrung sei schmackhaft und rein und werde mit in einem Geisteszustand zu sich genommen, als ob man mit der Nahrungsaufnahme Gott erfreuen wolle.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 22
Die Nahrung fülle nur die Hälfte des Magens, ein Viertel werde mit Wasser gefüllt und der vierte Teil bleibt zur Regulierung des Atems frei.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 23 bis 28
Vor allem zu Beginn seiner Yogapraxis soll sich der Yogi zahlreicher Speisen enthalten. Dazu gehören blähende, abgestandene, salzige, bittere, saure und ganz allgemein schwer verdauliche Nahrung.
Zudem meide er Alkohol und schränke die Sexualität ein.
Mittendrin erscheint die Forderung, der Yogi möge sich abhärten und nicht viel umherreisen.
Empfohlen wird: Kokosnüsse, Granatapfel, Butter, Milch, Grapefruits, Anis, Obstsaft, Walnuss, Kardamon und Dattel.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 29 und 31
Der Yogi nehme milde und leicht verdauliche Nahrung zu sich, die dem Körper alle wichtigen Nahrungsbestandteile zuführt. Darum meide man überreife und zu feste Nahrung sowie besonders kalte und heiße Speisen.
Der Yogi soll morgens nicht im Teich baden, aber Essen zu sich nehmen. Er meide alle übertriebene Quälerei in Bezug auf die Nahrungsaufnahme. So dürfe ein Yogi durchaus alle drei Stunden etwas zu sich nehmen.
Anmerkung: Von Buddha ist überliefert, dass er nur einmal am Tag etwas gegessen hat. Das wird hier jedoch nicht als notwendig erachtet.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 32
Wenn der Yogi sein Leben auf diese Weise reguliert, kann er Pranayama praktizieren. Zu Beginn soll er täglich etwas Milch und zerlassene Butter (Ghee) zu sich nehmen. Er esse zweimal pro Tag: mittags und abends.
Der Yogi-Sitz
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 33
Der Yogi sitze auf einem Sitz aus Kusa-Gras, dem Fell einer Antilope oder eines Tigers, einer Wolldecke oder einfach nur auf der Erde. Das Gesicht ist gen Osten oder nach Norden ausgerichtet. Nachdem der Yogi die Nadis gereinigt hat, kann er mit Pranayama beginnen.
Die Reinigung der Nadis
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 34
Der Schüler fragt: Wie werden die Nadis gereinigt?
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 35
Wenn die Nadis mit Unreinheiten verstopft sind, kann der Vayu [Wind] nicht durch sie streifen. Wie kann so Pranayama mit Erfolg ausgeführt werden und die Kenntnis der Wahrheit der Tattvas erlangt werden? Darum müssen zuerst die Nadis gereinigt werden, bevor man Pranayama übt.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 36
Die Reinigung der Nadis erfolgt auf zwei Arten: Samanu und Nirmanu. Samanu wird mit einem mentalen Prozess mit Bija-Mantras erreicht. Nirmanu wird durch physische Reinigung erreicht.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 37
Nirmanu, die physische Reinigung der Nadis wurde bereits erklärt. Nun wird Nirmanu erläutert.
Siehe zu Nirmanu das 1. Kapitel der Gheranda Samhita.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 38
Der Yogi sitze in Lotus-Haltung auf seinem Sitz. Dann nehme man die Verehrung des Meisters vor, wie diese von ihm gelehrt wurde. Dann führe man die Reinigung der Kanäle durch.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 39-40
Der Yogi konzentriere sich auf das Vayu-Symbol [Wind Symbol oder Y, Bija-Mantra Yam], das rauchfarben und voller Energie ist. Er ziehe die Luft mit dem linken Nasenloch ein und wiederhole dabei das Symbol [bzw. Mantra] 16 mal. Das ist Puraka.
Dann halte man den Atem für 64 Wiederholungen an. Das ist Kumbhaka.
Dann stoße man den Atem sanft durch das rechte Nasenloch mit 32 Wiederholungen aus.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 41-42
Die Wurzel des Nabels ist der Sitz von Agni-Tattva, dem inneren Feuer. Man wiederhole die Übung mit dem Agni-Symbol [Feuer-Symbol r, Bija-Mantra Ram]. Dadurch zieht man das Feuer hoch. Dabei meditiere man über das vermischte Licht.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 43-44
Dann fixiere man die Nasenspitze und meditiere über den dort reflektieren Glanz des Mondes. Dabei atme man durch das linke Nasenloch ein und wiederhole bei 16 mal das Symbol tha [Bija-Mantra Tham].
Dann halte man die Luft für 64 Wiederholung des Mantra Vam an.
Dann stelle man sich vor, wie silberner Nektar von der Spitze der Nase durch uns strömt und die Nadis reinigt. Dabei stoße man sanft die Luft durch das rechte Nasenloch aus und wiederhole 32 mal das Bija-Mantra Lam.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 45
Mit diesen drei Pranayama werden die Nadis gereinigt. Dann setze sich der Yogi in seinen festen Sitz und beginne mit den eigentlichen Pranayama-Übungen.
Die "eigentlichen" Pranayama-Übungen
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 46
Es gibt acht Pranayama-Übungen mit Kumbhaka, dem Zurückhalten des Atems. Diese sind Sahita, Suryabheda, Ujjayi, Sitali, Bhastrika, Bhramari, Murcha und Kevali.
Sahita
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 47
Es gibt zwei Arten von Sahita: Sagarbha und Nirgabha. Wenn man Kumbhaka [Atemanhalten] mit dem Wiederholen eines Bija-Mantra praktiziert, ist es Sagarbha. Ohne diese Wiederholung ist es Nirgabha.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 48
Zuerst Sagarbha: Man setze sich mit dem Gesicht nach Osten oder Norden in seinen bequemen [und festen] Sitz. Der Yogi kontempliere über Brahma [Gott] und seine Raja-Qualitäten [seine Schöpfer-Tätigkeit], welche die Qualität einer blutroten Farbe hat, in Form des Buchstabens A.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 49
Dann zieht der weise Yogi die Luft durch das linke Nasenloch ein und wiederholt dabei 16 mal dieses A. Am Ende der Einatmung, bevor er die Luft anhält, führe er Uddhiyana-Bandha aus.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 50
Während des Atemanhaltens meditiere der Yogi über den Gott Hari, von schwarzer Farbe und satvischer Qualität, und wiederhole 64 mal den Laut U.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 51
Dann atme der Yogi durch das rechte Nasenloch aus und wiederhole währenddessen 32 mal den Laut Ma. Dabei stelle man sich Shiva von weisser Farbe und tamischer Qualität vor.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 52
Dann ziehe man die Luft wieder durch das rechte Nasenloch ein, halte die Luft an und atme durch das linke Nasenloch wieder aus. Dabei wiederhole man die Bija-Mantren bzw. Laute wie zuvor beschrieben.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 53
So unter Abwechseln der Nasenlöcher praktiziere man wieder und wieder. Nach der Einatmung (Puraka) halte man beide Löcher sowohl mit dem Daumen [auf der einen Seite] als auch mit Ringfinger und kleinem Finger [auf der anderen Nasenseite] zu, solange der Atem angehalten wird. Den Zeige- und Mittelfinger benutze man nie.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 54
Nigarbha [einfaches oder mantraloses] Pranayama wird wie eben beschrieben nur ohne Wiederholung der Bija-Mantra durchgeführt. Die Gesamtheit von Einatmen, Anhalten und Ausatmen mag von 1 bis 100 Matras ausgedehnt werden.
In einigen Übersetzungen folgt: Nigarbha wird mit der linken nach oben geöffneten Handfläche, die auf dem linken Knie liegt, praktiziert.
Hinweis: Matra [nicht Mantra!] bedeut Maß oder Maßeinheit. Es steht hier vermutlich für die Anzahl von Mantra-Wiederholungen oder entsprechende Zeiteinheiten, z. B. wenn man während des Pranayama zählt.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 55
Das höchste Pranayama sind 20 Matras [z. B. 20 Sekunden Puraka (Einatmung), 80 Sekunden Kumbhaka [Anhalten] und 40 Sekunden Rechaka (Ausatmung) laut einer englischen Übertragung], das mittlere Pranayama sind 16 Matras [z.B. 16, 64 und 32 Sekunden], das niedrigste Pranayama sind 12 Matras [z. B. 12, 48 und 24 Sekunden]. Hierdurch wird das Pranayama auf dreierlei Art unterteilt.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 56
Das niedrigste Pranayama erhitzt nach einiger Zeit den Körper [englische Übertragung: lässt ihn stark schwitzen], das mittlere Pranayama lässt den Körper schwanken [englische Übertragung: gefühlt ein Zittern um die Wirbelsäule]. Das höchste Pranayama lässt den Yogi schweben [Levitation]. Diese Resultate sind Zeichen für den Erfolg der drei Arten von Pranayama.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 57
Mit Pranayama erhält der Yogi die Siddhi [yogische Kraft] der Levitation, Krankheiten werden geheilt und die Shakti [spirituelle Energie] wird geweckt. Durch Pranayama wird der Geist zur Ruhe geführt [siehe Sutra I-2] und die mentalen Kräfte erhöht (der Manonmani-Zustand wird erreicht). Der Geist wird voll der Freude und der Yogi glücklich.
Suryabheda
(auch Surya Bheda genannt)
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 58-59
Es wurde Sahita Pranayama erläutert. Jetzt folgt Suryabheda. Atme durch das rechte Nasenloch [Sonnen-Kanal] mit aller Kraft ein [so tief man kann]. Halte die Luft mit großer Sorgfalt und praktiziere Jalandhara Bhanda. Halte den Atem so lange bis dir die Hitze aus den Spitzen deiner Nägel und den Wurzeln deiner Haare kommt.
Ergänzung: Im zweiten Kapitel der Pradipika wird Suryabheda ein wenig anders erklärt. Dort steht auch, dass danach der Atem langsam durch das linke Nasenloch ausgeblasen wird.
Die Vayus
Vayu = Hauche, Wind, Atem, Luftelement
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 60
Es gibt zehn Vayus:
Innere Vayu: Prana [Luft], Apana [Erde], Samana [Feuer], Udana [Äther] und Vyana [Wasser];
Äußere Vayu: Naga, Kurma, Krikara, Devadatta und Dhanajaya.
Siehe zur Erläuterung der Vayus hier.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 61-62
Das Prana bewegt sich stetig im Herzen; das Apana in der Sphäre des Anus; das Samana in der Nabel-Region und Udana in der Kehle. Die Vayus durchdringen den ganzen Körper. Diese fünf grundlegenden Vayus sind als Pranadi bekannt und gehören zum inneren Körper. Die fünf Vayus mit Namen Nagadi gehören zum äußeren Körper.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 63-64
Nun berichte ich vom Sitz der fünf äußeren Vayus. Das Naga-Vayu bewirkt das Aufstoßen; Kurma öffnet die Augenlider; Krikara verursacht Niesen; Devadatta löst das Gähnen aus; Dhanajaya durchzieht den ganzen äußeren Körper und verlässt den Körper nicht, auch nicht nach dem Tod.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 65
Das Naga-Vayu bewirkt ein gesteigertes Bewusstsein, Kurma löst Visionen aus, Krikara Hunger und Durst, Devadatta Gähnen und Dhanajaya Geräusche.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 66-67
All diese Vayus, getrennt vom Surya-Kanal [Surya Nadi befindet sich auf der rechten Seite des Körpers und endet im rechten Nasenloch], lass sie von der Wurzel des Nabels aus ansteigen; dann lass sie von Ida-Nadi ausatmen, langsam mit ununterbrochener, kontinuierlicher Kraft. Lass ihn erneut Luft durch das rechte Nasenloch einatmen, anhalten wie erläutert und [durch das linke Nasenloch] wieder ausatmen. Der Yogi tue dies wieder und wieder. In diesem Pranayama wird die Luft immer durch den Surya-Kanal, eingeatmet.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 68
Suryabheda zerstört Verfall und Tod, erweckt die Kundalini und erhöht das Körperfeuer.
Ujjayi
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 69-72
Verschließe den Mund und ziehe die Luft durch beide Nasenlöcher ein und ziehe [gleichzeitig] die innere Luft aus der Lunge und der Kehle hoch. Halte so die Luft im Mund.
Dann reinige man den Mund und führe Jalandhara Bhanda durch. Halte den Atem solange an, wie es ohne Hemmnis gelingt.
Mit Ujjayi Kumbhaka wird alle Arbeit vollendet. Der Yogi wird von ... [zahlreichen Krankheiten wie Schwindsucht, Phlegma, Verdauungsstörungen usw.] befreit und besiegt Verfall und den Tod.
Anmerkung: Auch Ujjayi wird im zweiten Kapitel der Pradipika leicht anders beschrieben.
Sitali
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 73
Bei herausgestreckter Zunge [zusammengerollt] und zusammengezogenen Lippen ziehe man die Luft langsam durch den Mund ein, so dass sie den Magen füllt. Dann halte man die Luft für eine kurze Zeit an und stoße sie aus beiden Nasenlöchern wieder hinaus.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 74
Der Yogi vollziehe immer den Sitali-Kumbakha, dem Spender von Freude. So wird er von Phlegma, Magenverstimmung und Gallenleiden befreit.
Bhastrika
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 75
Wie der Blasebalg eines Schmieds sich hebt und senkt ziehe der Yogi die Luft durch beide Nasenlöcher ein und dehne dabei den Bauch aus. Dann stoße er die Luft schnell wieder aus.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 76
Wenn der Yogi dies 20 mal durchgeführt hat, halte er die Luft an. Dann stoße er die Luft wie in der vorigen Methode aus [durch das linke Nasenloch].
Der weise Yogi vollzieht Bhastrika Kumbhaka drei mal hintereinander aus. So wird er nie an einer Krankheit leiden und immer gesund sein.
Bhramari
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 78
Wenn Mitternacht vergangen ist, an einem Ort, wo kein Geräusch eines Lebewesens zu hören ist, atmet der Yogi ein und hält die Luft an, während er die Ohren mit seinen Händen zuhält.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 79
Dann wird er in seinem rechten Ohr einen inneren, glücksverheißenden Ton vernehmen. Zuerst den Ton einer Grille, dann den Ton einer Laute.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 80
Dann den Ton von Donner, [wörtlich: einer Wolke] , einer Trommel, einer Biene, einer Glocke, eines Gongs, eines Weberschiffs, einer Trompete, einer Pauke, einer Doppelkonustrommel, einer Militärtrommel ...
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 81-82
Diese Töne hört der Yogi nach täglicher Praxis von diesem Kumbhaka. Zuletzt hört er einen Ton ohne Anschlag (den Anahata-Klang), der vom Herz aufsteigt. In diesem Ton liegt Resonanz und in dieser Resonanz ist Licht. In dieses Licht taucht der Geist ein. Wenn der Geist darin ganz absorbiert ist, erreicht er den höchsten Sitz von Vishnu. Bei Erfolg führt Bhramari Kumbhaka zu Samadhi.
Murcha
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 83
Man führe Kumbhaka mit Leichtigkeit aus und richte den Geist auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Alle äußeren Sinne werden zurückgezogen [siehe Pratyahara]. Dies verursacht Geistesbetäubung und ein glückliches Gefühl. So verbindet sich der Geist mit dem Atman und es entsteht innerliche Wonne. Daraus folgt vollkommene Versenkung.
Kevali
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 84
Der Atem jedes Menschen tritt mit dem Klang "sah" ein und mit "ham" aus, [im Durchschnitt] 21.600 mal pro Tag. Jedes Leben murmelt [Japa] diesen Klang, unbewusst aber konstant. Dies wird Ajapa Gayatri genannt.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 85
Dieses Ajapa Japa [Japa = beständiges Murmeln, meist im Sinne der Wiederholung eines Mantras gebraucht] wird an drei Stellen gebildet: zum einen im Muladhara [am Perinaeum], im Anahat Lotus des Herzens und an der Wurzel der Nasenkanäle.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 86-87
Dieser Körper des Windes [vermutlich des Atems] misst im Schnitt 96 Längen [ca. 1,80 Meter]. Der ausgeatmete Atem misst in der Regel 23 Zentimeter. Beim Singen wird er 30 Zentimeter lang, beim Essen 38 Zentimeter, beim Gehen 45 Zentimeter, im Schlaf 70 Zentimeter. Beim Sex ist er 68 Zentimeter lang, bei körperlichen Übungen noch länger.
Anmerkung: Alle Längen aus der englischen Übersetzung von Inches und Feets auf Zentimeter und Meter umgerechnet.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 88
Wenn die natürliche Länge des ausgeatmeten [Atem-]Flusses von 23 Zentimetern abnimmt und kürzer und kürzer wird, nimmt das Leben zu; wenn dieser Fluss anwächst, vermindert sich das Leben.
Alternativübersetzung 1: Wenn die Anzahl seiner Bewegungen geringer wird, wächst das Leben, sagt man;
Alternativübersetzung 2: In dem Maße, wie die Länge der ausgeatmeten Luft abnimmt, wird das Leben verkürzt;
Interpretation: Je ruhiger die Tätigkeit, desto "kürzer" der Atem. Wenn dieser also immer kürzer wird, erfolgt die Atmung immer langsamer. Das würde bedeuten: Je weniger Atemzüge pro Zeiteinheit ein Mensch macht, desto länger lebt er. Diese Interpretation passt zu dem Gedanken, dass der Mensch bei seiner Geburt eine bestimmte Anzahl Atemzüge auf den Weg bekommt. Je schneller er diese verbraucht, umso früher würde er sterben ...
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 89
Solange der Atemwind im Körper verbleibt, tritt der Tod nicht ein. Wenn die volle Länge des Windes komplett auf den Körper begrenzt ist, kein Atemwind aus dem Körper austritt, ist es Kevala Kumbhaka.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 90-91
Alle Menschen rezitieren ständig und unbewusst das Ajapa Mantra [15 mal pro Minute]; Wenn man diese Anzahl verdoppelt und dabei weder regulär ein- (Puraka) noch ausatmet (Rechaka), ist der Manonmani-Zustand [fixierter Geist] erlangt. Dann ist da nur Kevala Kumbhaka.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 92
Nach dem Einatmen durch beide Nasenlöcher möge der Yogi Kevala Kumbhaka durchführen. Am ersten Tag soll er den Atem von 1 bis 64 Zeiteinheiten zurückhalten.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 93-94
Dieses Kevali soll acht mal pro Tag durchgeführt werden, alle drei Stunden. Alternativ kann man Kevali fünf mal pro Tag durchführen: frühmorgens, mittags, zur Dämmerung, Mitternacht und im vierten Teil der Nacht. Oder der Yogi macht es drei mal am Tag: morgens, mittags und abends.
Gheranda Samhita, Kapitel V, Vers 95-96
Solange noch kein Erfolg in Kevali erreicht wurde, soll der Yogi die Länge von Ajapa Japa jeden Tag erhöhen, von einem zu fünf mal [pro Tag?]. Derjenige, der Pranayama und Kevali kennt, ist ein wirklicher Yogi. Was soll der in dieser Welt nicht erreichen können, der Kevali Kumbhaka gemeistert hat?
Damit endet das fünfte Kapitel der Gheranda Samhita.
Bücher zur Gheranda Samhita
🛒 "Gheranda Samhita" auf Amazon anschauen ❯