Yamas und Niyamas: Ethik im Yoga verstehen und im Alltag anwenden
Keine spirituelle Richtung kommt ohne Verhaltensregeln aus. Diese legen fest, welche ethischen Handlungsweisen für einen Aspiranten (oder auch jeden Menschen) förderlich sind. Was dem Christen die zehn Gebote, das sind dem Yogi die Yamas und Niyamas.
Gleichzeitig sind die Yamas und Niyamas die ersten beiden Stufen im Raja Yoga, dem achtgliedrigen Yoga-Pfad (auch Ashtanga-Yoga genannt). Patanjali, der bekannteste Yogaphilosoph, definiert die Yamas und Nyamas im Yogasutra.
Dieser Artikel zeigt, wie sich alte Weisheit im modernen Alltag verankern lässt: Was sind die Yamas und Niyamas? Wie werden diese in den alten Schriften ausgelegt? Und wie wende ich die Yamas und Niyamas im Alltag an? Der Artikel gibt Antwort und hält zwei Downloads (Poster & Merkkarte) parat.

Kurz gefasst: Yamas und Niyamas
Die Yamas und Niyamas werden bei Patanjali im Yogasutra ab Sutra II-29 besprochen.
Yoga Sutra II-29: Die acht Glieder des Yoga-Weges sind: Yama (Umgangsregeln), Niyama (Enthaltungen), Asana (Stellungen), Pranayama (Atemregulierung), Pratyahara (Sinnesrückzug), Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Erleuchtung)
Patanjali stellt diese Prinzipien in einen systematischen Zusammenhang. Ähnliche ethische Leitideen finden sich auch in älteren Traditionen und Texten, sodass er sie nicht aus dem Nichts heraus formuliert.
Die fünf Yamas (nach Patanjali):
- Ahimsa – Nichtverletzen, Gewaltlosigkeit, nicht nur körperlich, sondern auch durch Sprache, Stimmung, Druck.
- Satya – Wahrhaftigkeit, die nützt; Wahrheit ohne Zerstörungslust.
- Asteya – Nicht-Stehlen, auch nicht Zeit, Aufmerksamkeit, Ideen, Anerkennung.
- Brahmacharya – Selbstbeherrschung; Maßhalten und Ausrichtung; Energie nicht ständig verfrühstücken.
- Aparigraha – Nicht-Greifen; weniger Besitz- und Kontrollreflexe.
Die fünf Niyamas (nach Patanjali):
- Saucha – Reinheit/Klarheit; äußerlich und innerlich aufgeräumt.
- Svadhyaya – Selbststudium; Muster erkennen statt sie zu rechtfertigen.
- Tapas – Disziplin, Übungsenergie; dranbleiben, ohne sich zu verbrennen.
- Santosha – Zufriedenheit; weniger Vergleich, weniger inneres Meckern.
- Ishvarapranidhana – Hingabe/Vertrauen; Ergebnisse loslassen, ohne passiv zu werden.
Yoga ist mehr als Asana:
Die Yamas und Niyamas stehen am Beginn des achtgliedrigen Yoga-Pfades und gelten als praktische Lebensregeln, die weit über körperliche Übungen hinausgehen und auf Alltag, Beziehungen und Bewusstsein wirken.
Konflikt zwischen Prinzipien ist normal:
Prinzipien wie Ahimsa und Satya können im Alltag in Konflikt geraten. Die Praxis besteht darin, sie kontextbezogen abzuwägen, z. B. Wahrheit so zu formulieren, dass sie nützt, statt verletzt.
Moderne Anwendung im Alltag:
Die Prinzipien lassen sich bei Social Media, im Berufsleben oder beim Konsum anwenden, indem du etwa nicht „geistiges Eigentum stiehlst“, Ablenkungen reduzierst oder deine Energie bewusst verwaltest.
Fallstricke
Zu viel des Guten kann kippen: Gewaltlosigkeit darf nicht Selbstaufgabe bedeuten, Wahrhaftigkeit nicht Brutalität, Disziplin nicht Selbstquälerei. Balance ist entscheidend.
Download: Yamas & Niyamas als Poster & Merkkarte
Yamas & Niyamas als Poster
Wir haben ein Poster von den Yamas und Niyamas erstellt:

Das Bild als DIN A4 - Poster:
Yamas & Niyamas als Merkkarte
Alternativ/ergänzend kannst du dir die Yamas & Niyamas auch als kleine Merkkarte für die Geldbörse herunterladen. Einfach runterladen, ausdrucken und ausschneiden:
Die Yamas – Verhaltensregeln im Umgang mit der Umwelt
Beginnen wir mit den Regeln, die ein Yogi im Umgang mit den Mitmenschen einhalten sollte: den Yamas.
Sanskrit
- Yama: Enthaltung; Selbstkontrolle;
Die Yamas sind Bestandteil des Sadharana Dharmas, allgemeine Verhaltensregeln der Hindus. Im Yogasutra werden sie wie folgt einegührt:
Yoga Sutra II-30: Die förderlichen Selbstbeschränkungen (yamas) sind Nichtverletzen, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, Enthaltsamkeit und Begierdelosigkeit
Yoga Sutra II-31: Die Yamas sind überall einzuhalten, unabhängig vom eigenen Status, dem Ort, der Zeit oder den äußeren Umständen – sie stellen das Große Gelübde dar

1. Ahimsa – Gewaltlosigkeit oder Nichtverletzen
Das erste Yama ist die grundlegenste Regel eines Yogis im Umgang mit anderen Lebewesen:
Füge anderen kein Leid zu!
 Das zugrunde liegende Sanskrit:
Das zugrunde liegende Sanskrit:
- Himsa: Gewalt, Grausamkeit
- Ahimsa: Nicht-Gewalt
Das Yogasutra zu Ahimsa:
Yoga Sutra II-34: Gedanken und Zweifel, die zu schädigendem Verhalten führen – egal ob dies selbst getan, in Auftrag gegeben oder nur begünstigt wird, egal ob durch Gier, Ärger oder Verblendung motiviert, egal ob in der Ausführung mild, mittelmäßig
Vom Wortlaut her fordert Ahimsa zunächst einmal ein Vermeiden von Gewalt. Meist wird es darüber hinaus als ein grundlegendes Nichtverletzen interpretiert. Gewaltlosigkeit meint, niemals einem Lebewesen in irgendeiner Form Schaden zuzufügen. Ahimsa wird auch als Grundlage für die folgenden Yamas und Niyamas gedeutet.
Gewaltlosigkeit klingt nach Weltpolitik und Gandhi. Aber sie beginnt viel kleiner. Nichtverletzen kann auf mehreren Ebenen ausgelegt werden: Nicht genervt hupen, wenn jemand beim Abbiegen trödelt. Statt dich für den dritten Keks selbst zu verfluchen, freundlich zu dir sein. Gewaltlosigkeit fängt im Kopf an, nicht im Protestmarsch. Weitere Beispiele:
- Keine körperliche Gewalt gegen kein fühlendes Wesen
Beispielhaft steht hier das Leben von Mahatma Gandhi, der seinen Protest gegen die britische Kolonialherrschaft in Indien auf strikte Gewaltlosigkeit gründete. Doch nicht nur Schläge verursachen Schmerzen, auch Worte können tief verletzen. Von daher wird Ahimsa auch als Freundlichkeit in Worten verstanden.
Zudem sehen viele in Ahimsa eine Forderung des Yoga nach einem vegetarischem wenn nicht sogar veganem Leben. - Keine gewalttätigen Gedanken
Doch was nützt ein friedliches äußeres Gebaren deinem yogischen Fortschritt, wenn du in deinem Inneren jedem Zweiten die Pest an den Hacken wünscht? Wenig bis gar nichts. Darum wird Ahimsa auch als Forderung zu freundlichen Gedanken gegenüber jedermann verstanden. - Wie sieht Gewaltlosigkeit auf Social Media aus? Vielleicht so: keine wütenden Kommentare schreiben, auch nicht, wenn dich jemand provoziert oder wenn die Person etwas schreibt, was in deinen Augen verabscheuenswürdig ist.
Im Patanjalayogasastra (beinhaltet den Kommentar zum Yogasutra vom Vyasa, hier zitiert aus „Roots of Yoga“), wird Ahimsa als Grundlage für die folgenden Yamas und Niyamas gedeutet. Dort heißt es:
"Von diesen bedeutet Gewaltlosigkeit, niemals einem Lebewesen in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen. Die anderen Regeln und Observanzen sind darin verwurzelt. Sie werden praktiziert, um sie zu praktizieren, mit dem Ziel, sie zu vervollkommnen. Sie werden nur deshalb dargelegt, um seine reine Form herbeizuführen. Und so heißt es: „In der Tat, je mehr dieser Brahmane hier viele Gelübde ablegen möchte, desto mehr praktiziert er eben jene Gewaltlosigkeit in ihrer reinen Form, indem er von den Ursachen der aus Unachtsamkeit ausgeübten Gewalt Abstand nimmt."
Warum ist Ethik so wichtig im Yoga?
Manche sagen, weil man mit Yoga so außergewöhnliche Kräfte entwickele, brauche man hohe ethische Maßstäbe für das eigene Handeln. Wahrscheinlich hatten die alten Yogis bei der Formulierung der Yamas und Niyamas aber vor allem die Förderung der Geistesruhe des Yogis durch Einhalten dieser Regeln im Sinn. Denn Yoga ist ja, so die Definition von Patanjali, das Zuruhebringen der Bewegungen im Geist.
Auch kein Himsa bei dir selbst
Wo Gewaltlosigkeit in Selbstaufgabe kippen kann: Manchmal braucht es ein klares „Nein“, auch wenn es unbequem ist.
Viele Kommentatoren verstehen daher die Forderung nach Ahimsa weit: Die Gewaltlosigkeit müsse auch der eigenen Person zuteilwerden, auch „dem eigenen Wesen“ (R. Palm). Nicht nur den anderen Wesen solltest du Freundlichkeit angedeihen lassen, du solltest auch nett zu dir selbst sein. Dich nicht ständig in Gedanken schelten, weil du heute wieder nicht alles geschafft hast. Deinen Körper nicht durch ungesundes Verhalten schädigen.
Ich soll weder in Taten, noch Worten und (vor allem?) auch nicht in Gedanken verletzen, nicht andere, nicht mich, auch kein Tier, gar kein fühlendes Wesen.
Grenzen von Ahimsa
Diese Forderung – radikal gedeutet – würde wohl zum eigenen Verhungern führen (was einige wenige radikale Jainas wohl wegen dieser Deutungsart auch so vollziehen – das Ritual des Zu-Tode-Fastens). Neben anderen plädiert Skuban dazu, den gesunden Menschenverstand bei der Befolgung der Forderung nach Nichtverletzen einzuschalten, um zu beurteilen, wie weit Ahimsa in unserem Leben reichen kann. Für den einen ist es die klare Forderung danach, vegan zu leben, ein anderer sieht es so, wie Cicero einst schrieb: „Töte mich, um zu essen, aber morde nicht, um besser zu essen.“
Die Antwort nach den Grenzen von Ahimsa sei individuell, so mehrere Kommentatoren, müsse aber – so die recht einhellige Meinung – entschieden weiter reichen, als das, womit sich die Menschheit zur Zeit begnügt.
R. Skuban betont die große Wirksamkeit von Ahimsa. Er sagt: „... würde die Mehrheit der Menschen nur diesen ersten Schritt des Yoga-Weges beherzigen, wären wir dem Paradies auf Erden schon sehr nah.“
Sutra II-35: Was folgt, wenn wir Ahimsa befolgen
Yoga Sutra II-35: Wenn das Nichtverletzen [anderer Lebewesen im Wesen eines Menschen] (Ahimsa) fest verwurzelt ist, verschwindet jede Feindseligkeit in seiner Umgebung

2. Satya – Wahrhaftigkeit
Sanskrit
- Satya = Wahrhaftigkeit, Wahrheit;
Im Patanjalayogasastra (beinhaltet den Kommentar zum Yogasutra vom mystischen Vyasa, zitiert aus „Roots of Yoga“) heißt es:
„Wahrhaftigkeit ist, wenn Rede und Geist mit ihrem Objekt übereinstimmen und wenn Rede und Geist mit dem übereinstimmen, was gesehen oder gefolgert wird. Wenn sie geäußert wird um einem anderen die eigenen Gedanken mitzuteilen, sollte die Rede nicht trügerisch, verworren oder ohne Information sein. Sie sollte unternommen werden, um allen Wesen zu nützen, nicht um Wesen zu verletzen. Und selbst wenn die Rede auf diese Weise [d.h. wahrheitsgemäß] geäußert wird, aber mit der alleinigen Absicht, den Wesen zu schaden, dann liegt keine Wahrhaftigkeit vor, sondern nur Sünde. Durch diesen bloßen Schein der Tugend, diese Fälschung der Tugend, würde man in schrecklicher Dunkelheit enden. Deshalb sollte man, nachdem man das Wohl aller sorgfältig bedacht hat, die Wahrheit sprechen.“
Hierzu haben wir eine passende Geschichte auf yoga-welten.de. Sie geht so:
Drei Siebe des Sokrates (bzw. des Weisen, der Weisheit oder der Wahrheit)
Zum weisen Sokrates kam der junge Polimus gelaufen und er rief bereits von Weitem: "Höre, Sokrates. Ich muss dir etwas erzählen!"
"Halte ein!" unterbracht ihn der Weise, "hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt?"
"Drei Siebe?", fragte Polimus voller Verwunderung.
Satya heißt im Grunde genommen vor allem, dass wir nicht lügen sollen. Wahrhaftigkeit bedeutet nicht, jedem Kollegen ungebremst die Meinung zu servieren. Satya ist der Entschluss, weniger Notlügen zu benutzen – nicht „ich stecke im Stau“ zu murmeln, wenn du schlicht zu spät losgegangen bist. Wahrheit schafft Vertrauen, auch in winzigen Dingen.
Was wie eine ethische Pflichtübung daherkommt, kann für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und auf die Zusammensetzung unseres Umfeldes erhebliche Auswirkungen haben. Jeder, der ernsthaft versucht, die tausenderlei Notlügen, Verdrehungen oder „Lügen durch Übergehen“ im Alltag zu vermeiden, wird einschneidende Veränderungen in seinem Leben feststellen. Meist wird von (sehr) positiven Auswirkungen berichtet. Man muss sich aber erst einmal trauen, den Weg der Wahrhaftigkeit – auch oder vor allem gegenüber sich selbst – zu betreten ...
Konfliktpotenzial: Wann Wahrhaftigkeit brutal wird, statt hilfreich. Nicht jede ungeschminkte Wahrheit tut gut.
Satya kann in Konkurrenz zu Ahimsa stehen, wenn das wahre Wort jemand anderen verletzen würde. Hier gilt es abzuwägen. Im Thirukkural heißt es sogar:
„Auch eine Lüge ist als Wahrheit zu bewerten, wenn diese Lüge niemanden schadet aber bei jemand anderen Gutes bewirkt.“
Manchmal ist dann Schweigen der bessere Weg. Als Lösung bietet es sich hin und wieder auch an, diplomatisches Geschick bei der Wahl seiner Worte zu entwickeln. Zum Beispiel die Wahrheit im Meeting sagen – aber ohne Kollegen bloßzustellen.
Ein andermal sollten wir vielleicht unsere negative Sicht über den Kritisierten oder dessen Verhalten überdenken. Wenn wir alle anderen als Idioten ansehen und uns ethische Pluspunkte davon versprechen, dies jedem offen mitzuteilen, könnten wir uns auf dem Holzweg befinden ...
Weite Auslegung
Mehrere Kommentatoren legen – wie bei den anderen Yamas auch – dieses Yama weit aus. Satya meine auch:
- nicht übertreiben
- nichts vortäuschen
- nicht heucheln
- nicht betrügen
- Ehrlichkeit in der Werbung
- völlige Aufgabe von Selbsttäuschungen
- nur das aussprechen, was erbaulich und/oder sinnvoll ist
- usw.
Satya sollte ebenfalls auf sich selbst angewendet werden. Wir sollten uns nichts vormachen oder uns selbst belügen. Gedanken sind schnell gedacht und auch schnell verdreht gedacht. Darum ist das Führen eines spirituellen Tagebuches eine große Hilfe dabei, sich selbst gegenüber ehrlich zu werden.
Sutra II-36: Was folgt, wenn wir Satya befolgen
Yoga Sutra II-36: Wenn Wahrhaftigkeit (Satya) [im Wesen eines Menschen] fest verwurzelt ist, entspricht das [jeweilige] Ergebnis seiner [jeweiligen] Handlung
Das Niederschreiben unserer Erlebnisse, Gedanken und Gefühle hat mehrere erfreuliche und fördernde Wirkungen. Wir reflektieren das Geschehene, halten wertvolle Erkenntnisse fest und sind durch die Niederschrift zu Präzision und Klarheit angehalten. Im folgenden Artikel geben wir Tipps und Empfehlungen, wie man ein spirituelles Tagebuch führen kann. Inklusive Vorlage zum Gratis-Download.Beitrag: Spirituelles Tagebuch führen

Ein spirituelles Tagebuch führen: Diese Ereignisse gehören hinein – mit Merkkarte und Vorlage zum Download

3. Asteya – Nicht-Stehlen
Sanskrit
- Steya: Stehlen, Diebstahl;
- Asteya; Nicht-Stehlen;
„Du sollst nicht stehlen“. Das kommt bekannt vor. Aber es geht auch darum, kein geistiges Eigentum missbräuchlich zu verwenden oder gar als unsere Leistung auszugeben.
Im Patanjalayogasastra (beinhaltet den Kommentar zum Yogasutra vom mystischen Vyasa, zitiert aus „Roots of Yoga“) heißt es:
„Stehlen ist die unrechtmäßige Aneignung von fremdem Besitz für sich selbst; seine Ablehnung dagegen ist Nicht-Stehlen, das sich in Form von Lustlosigkeit äußert.“
Nichtstehlen klingt selbstverständlich. Doch wie schnell stehlen wir Zeit? Fünf Minuten länger bei Instagram scrollen, obwohl jemand am Küchentisch wartet. Und Nicht-Stehlen in Zeiten von Copy-Paste? Ganz einfach: Bilder oder Texte nicht ungefragt übernehmen, sondern Urheber fragen und nennen. Asteya beginnt im Respekt vor dem, was anderen gehört.
Manche Kommentatoren sehen die moralische Forderung weiter. Auch Missgunst über Hab und Gut anderer gilt es zu vermeiden. Man sollte am besten gar nicht erst das haben wollen, was jemand anderes hat.
Sutra II-37: Was folgt, wenn wir Asteya befolgen
Yoga Sutra II-37: Wenn Nichtstehlen [im Wesen eines Menschen] fest verwurzelt ist, kommen alle Reichtümer [wörtlich: Juwelen] zu ihm
Feldnotiz aus dem Digitalen:
Asteya im Netz ist nicht nur Copy-Paste. Es ist auch das „Stehlen“ von Aufmerksamkeit: Empörung als Geschäftsmodell, Dauerreaktion als Lebensstil. Man kann sich daran beteiligen, ohne es böse zu meinen. Genau deshalb lohnt der Blick.

4. Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit

Sanskrit
- Brahma: das Wesentliche, das Eine Wahre;
- Char: bewegen;
- Brahmacharya: Mäßigung; Bewegung auf das Wesentliche hin; sexuelle Enthaltsamkeit; sexuelles Fehlverhalten vermeiden; Selbstbeherrschung; Maß halten;
Wir sehen: Brahmacharya wird recht unterschiedlich übersetzt. Oft wird es als sexuelle Enthaltsamkeit oder sexuelle Zurückhaltung interpretiert. Manchmal als Aufforderung, treu zu sein. Ein andermal als Aufforderung zum reinen Lebenswandel.
In modernen Interpretationen gerne auch als „Maß halten“. Selbstbeherrschung ist dann kein Ruf zum Klosterleben. Sie zeigt sich darin, nach dem zweiten Glas Wein aufzuhören oder Netflix pünktlich auszuschalten. Maßhalten, statt sich treiben zu lassen. Brahmacharya heißt dann: nicht alles mitnehmen, was gerade lockt. Selbstbeherrschung heißt hier auch: Überstunden im Zaum halten. Denn wer ständig überzieht, stiehlt letztlich sich selbst Energie.
Brahmacharya heißt wörtlich „brahmischer Wandel“ und meint ein Verhalten, das zum Ziel die Allseele (R. Palm) oder im yogischen Sinne auch „Purusha – das wahre Selbst“ hat. Also eine Lebensweise, die zur Erleuchtung, zum höchsten Ziel führt. Enthaltsamkeit in diesem Sinne würde „das rechte Maß einhalten“ bedeuten, vernünftig leben. Ein Zuviel aber auch ein Zuwenig vermeiden. In diesem Sinne wäre es zu kurz gegriffen, Brahmacharya nur auf den Sex zu beziehen.
Meist wird Brahmacharya aber auf sexuelle Enthaltsamkeit bezogen oder als Aufforderung zu moralisch einwandfreier Sexualität verstanden (zu deuten als: Sex, der niemanden verletzt, erniedrigt oder Lügen nach sich zieht).
Vom Prinzip her dürfte es darum gehen, den spirituellen Fortschritt nicht durch sexuelle Fehltaten oder andere Zügellosigkeiten zu verzögern.
Govindan schreibt: mit Enthaltsamkeit „kann man vieles loslassen, was ... gewöhnlich eine große Quelle der Ablenkung und des Leids ist.“
Im Patanjalayogasastra (beinhaltet den Kommentar zum Yogasutra vom mystischen Vyasa, zitiert aus „Roots of Yoga“) heißt es:
„Sexuelle Enthaltsamkeit ist Enthaltsamkeit des verborgenen Organs, der Genitalien.“
Sutra II-38: Was folgt, wenn wir Brahmacharya befolgen
Yoga Sutra II-38: Wenn Brahmacharya (Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit) [im Wesen eines Menschen] fest verwurzelt ist, erlangt er große Vitalität
Liṅgapurāṇa – Detailanweisungen zur sexuellen Enthaltsamkeit:
1.8.16 Für Asketen, die sexuelle Enthaltsamkeit (brahmacarya) praktizieren, heißt [sexuelle Enthaltsamkeit], sich nicht durch Handlungen des Geistes, der Rede oder des Körpers am Geschlechtsverkehr zu beteiligen.
1.8.17 Dies bezieht sich insbesondere auf Einsiedler, die ohne Ehefrauen leben. Ich werde dich auch über die sexuelle Enthaltsamkeit von Haushältern belehren, die mit Ehefrauen leben.
1.8.18 Für sie heißt sexuelle Enthaltsamkeit, dass sie [den Geschlechtsverkehr] mit ihren Frauen vorschriftsmäßig vollziehen und sich ansonsten immer in Gedanken, Taten und Worten davon zurückhalten.
1.8.19 Nachdem die rituell reine Ehefrau den Geschlechtsverkehr vollzogen hat, sollte sie ein Bad nehmen. Indem er sich so verhält, ist der disziplinierte Hausvater sicherlich sexuell enthaltsam.
Brahmacharya Diese vier Fehler bei der Sexualität meiden
Wim van den Dungen schreibt in seinem Kommentar zu Brahmacharya:
"Sexuelles Fehlverhalten : wird im Hinblick auf die „Vier Fehler“ analysiert:
- falsches Objekt: jedes ungeeignete Objekt der Aufmerksamkeit: für einen zölibatären Mönch (Nonne): jede andere Person, für einen Laien: der Partner eines anderen, unsere eigenen Eltern , ein Kind, ein Mönch (Nonne), eine schwangere Frau, Tiere, jede nicht zustimmende Person;
- falsches Organ: falscher Ort im Körper;
- falscher Ort: Orte, die andere beleidigen (öffentlicher Raum oder heiliger Raum);
- falsche Zeit: während der Schwangerschaft, Krankheit oder wenn man Gelübde abgelegt hat;"
Eliade schreibt in "Yoga" auf Seite 58:
"Der Yoga legt ein besonderes Gewicht auf jene -verborgenen Kräfte der Zeugungsfähigkeit-, deren Ausgeben die kostbarste Energie verschwendet, die Kraft des Gehirns schwächt und die Konzentration erschwert ... Und zwar bedeute sexuelle Enthaltsamkeit (brahmacarya) nicht nur Verzicht auf sexuelle Akte, sondern auch das -Verbrennen- der fleischlichen Versuchung selbst. Der Instinkt darf weder ... im Unterbewusstsein sich ausbreitend erhalten bleiben , noch ... sublimiert werden, sondern er wird ganz einfach zertstört ..."

5. Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier
Sanskrit
- Parigraha: Begehren; Gier;
- Aparigraha: Nicht-Greifen; Nicht-Zugreifen; Nichtannehmen von Geschenken; Nicht-Begehren; Nichtumfassen;
Hier wird der Yogi aufgefordert, seine Gier zu zügeln und im Leben nicht alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Vor allem dann nicht, wenn vermeintliche Geschenke mit dem Ansinnen gegeben werden, unser Verhalten zu manipulieren.
Nicht-Greifen heißt vermutlich nicht, alles aufzugeben. Aber die Frage zu stellen: „Brauche ich das wirklich?“ – vor dem Kauf, beim nächsten Gratisangebot, bei der nächsten Diskussion. Anspruchslosigkeit entlastet.
Aparigraha meint in anderen Texten auch das Nichtannehmen von Geschenken, die mit einer Absicht gegeben werden. In anderen Worten: unbestechlich sein, sich nicht für Lohn verbiegen. Geschenke unter guten Freunden und Liebenden sind damit vermutlich nicht gemeint.
Es beziehe sich aber nicht nur, so Iyengar, auf materielle Besitztümer, sondern auch „auf die Starrheit des Denkens“. Auch an Gedanken [und Meinungen] dürfe man nicht haften und müsse immer bereit sein, sie loszulassen.
In einem noch weitergehenden Sinne fordert Aparigraha, sogar die Aufgabe von Gewinnsucht und keinen Besitz zu horten.
Im Patanjalayogasastra (beinhaltet den Kommentar zum Yogasutra vom mystischen Vyasa, zitiert aus „Roots of Yoga“) heißt es:
„Nicht-Erwerbstätigkeit ist, die Objekte der Sinne nicht für sich selbst zu nehmen, weil man die Fehler des Erwerbens, Beschützens, Verlierens, Anhaftens oder Schädigens an ihnen sieht.“
Sutra II-39: Mehr zu Aparigraha und: Was folgt, wenn wir Aparigraha befolgen?
Yoga Sutra II-39: Ist Begierdelosigkeit (Aparigraha) [im Wesen eines Menschen] gefestigt, erkennt er den Sinn seiner Geburt
Umfrage: Welches Yama hälst du ein?
Um die Einhaltung welcher der Yamas bemühst du dich im täglichen Leben?
Perfekt ist wohl niemand von uns. Darum: In welchem Yama gibst du dir Mühe?
Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓
Die bisherigen Stimmen:
| Ahimsa – Gewaltlosigkeit | 64 Stimmen |
| Satya – Wahrhaftigkeit | 53 Stimmen |
| Asteya = Nicht-Stehlen | 48 Stimmen |
| Aparigraha – Nicht-Greifen | 41 Stimmen |
| Brahmacharya – Selbstbeherrschung | 33 Stimmen |
Die Niyamas – Selbstkontrolle, persönliche Disziplin
Sanskrit
- Niyama: Verhaltensregel; Einschränkung;
Grundlegende Sutra:
Yoga Sutra II-32: Die Nyamas lauten Reinheit, Zufriedenheit, Selbstdisziplin, Selbststudium und Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal)

1. Saucha – Reinheit
Sanskrit
- Sauca, Saucha: (innere und äußere) Reinheit; Klarheit; Sauberkeit; Entschlackung; das Geklärte;
Zugehöriges Element in einigen modernen Zuordnungen: Erde (körperliche Hülle);
Die Yogis wussten schon lange, dass innere und äußere Reinheit dem Menschen zuträglich ist. Saucha wird vielschichtig ausgelegt. Man versteht darunter unter anderem:
- körperliche Hygiene (äußere Reinheit)
- saubere Gedanken zu pflegen (energetische und mentale Ebene)
- vornehmlich sattvige, leichte, vegetarisch/vegane und reine Nahrung zu sich zu nehmen (gesunde Ernährung)
- innere Reinheit anzustreben (hierfür stehen dem Yogi Pranayama, Asana und verschiedene Kriya-Yoga-Reinigungstechniken zur Verfügung)
- eine saubere Wohnumgebung
- einen aufgeräumten und sauberen Arbeitsplatz
- Asana und Pranayama zur inneren Reinigung zu üben
- Den Nachrichtenstrom zu filtern. Wer den Kopf sauber hält, lebt leichter.
Deshpande/Bäumer schreiben: "Der Yogaweg verlangt Reinigung" wie die Gewinnung von reinem Gold die Entferfnung der Schmutzklumpen im Golderz notwenig mache.
Etwas darüber hinausgehend kann man unter Saucha auch die Forderung sehen, sich nicht durch die ungefilterte Aufnahme von schlechten Nachrichten innerlich zu verschmutzen. Buddha spricht in diesem Zusammenhang davon, dass er Schlechtes nicht in sein "Herz einlässt". Siehe dazu auch Sutra II-33, in der eine Kultivierung positiver Gedanken angemahnt wird. Vyasa (Kommentator des Yogasutra) fügt hinzu, dass Sauca auch meine, Unreinheiten des Geistes zu reinigen (Eliade, Yoga, S.58f).
Unter Saucha wird von mancher Stelle sogar die Aufforderung zu einer Lebensweise verstanden, die heutzutage mit Minimalismus bezeichnet wird. Siehe den Artikel "Warum Minimalismus?".
Deshpande/Bäumer hingegen wollen eine Betonung der "Reinigung des Sehens" bei Saucha verstanden wissen. Der Yogi müsse zum "reinen Schauen" finden, dies führe zu "Loslösung und Befreiung" und sei "der Kern der Reinigung".
Im Yoga wurden Techniken entwickelt, auch das Innere des Körpers mechanisch zu reinigen:
Artikel: Die 6 Yoga-Reinigungsübungen
- Dhauti: Anleitungen, Varianten, Vorteile & Kontraindikationen
- Tratak oder Trataka – die Augenreinigung
- Kapalabhati als Lungenreinigung und als Stirnhöhlenreinigung
- Cakri – Erläuterungen und Anleitung
- Basti – die Darmreinigung/Enddarmreinigung
- Neti – die Nasenreinigung
- Nauli / Lauliki – die Dünndarmreinigung
Ähnliche Reinigungstechniken finden sich übrigens im Evangelium der Essener, wie man bei Ralph Skuban nachlesen kann.
Sutras: Was folgt, wenn wir Saucha befolgen
Yoga Sutra II-40: Durch Reinheit entsteht Abneigung gegenüber dem eigenen Körper und gegenüber der Berührung mit anderen Körpern
Yoga Sutra II-41: Aus Reinheit entstehen Klarheit im Geist, innere Freude, gerichtete Konzentration, Beherrschung der Sinne und Erkennen vom wahren Selbst

2. Santosha – Zufriedenheit
Sanskrit
- Santosha, Samtosa: Sanskrit Genügsamkeit, Bescheidenheit; Zufriedenheit;
Zugehöriges Element in einigen modernen Zuordnungen: Wasser (physiologische Hülle);
Santosha steht für folgende Geisteshaltungen:
- Ich nehme alles so, wie es kommt.
- Ich bin mit dem zufrieden, wie es ist.
Das reicht von der Empfehlung, die geistige Haltung der Abneigung bzw. Ablehnung (von Erlebnissen, Menschen, Umständen usw.) immer weiter abzulegen bis hin zur Forderung, sich nicht mit anderen zu vergleichen.
Zufriedenheit klingt schlicht, ist aber manchmal die härteste Übung: beim Warten in der Supermarktschlange nicht innerlich kochen. Zufriedenheit: die Macken des anderen nicht ständig neu verhandeln. „Ich nehme, was ist.“ – das ist Santosha.
Dies bedeutet nicht, dass man in seinem Leben nichts verändern darf. Es geht vielmehr darum, die negativen Folgen geistigen Haderns mit der Welt und den eigenen Erfahrungen zu vermeiden.
Hariharananda Aranhya (1869-1947), Kommentar des Yogasutra, verdeutlicht:
"Um Dornen zu entgehen, ist es lediglich nötig, Schuhe zu tragen, nicht jedoch, die ganze Erde mit Leder zu überziehen."
Ramana Maharshi (1879-1950) geht noch einen Schritt weiter: Wenn der Wunsch eines Menschen erfüllt wird, er (mehr oder weniger kurz) zufrieden ist, "kehrt er in Wirklichkeit zu seinem Ursprung zurück und erfreut sich an dem Glück, das das Selbst ist" (beides zitiert aus Ralph Skuban). Mit Santosha würde ein Mensch also nur seine eigentliche Natur empfinden.
Deshpande/Bäumer sehen in Santosha, dass Begierden, Wünsche, Gier und der unstillbare Hunger nach einem Mehr von allem, was man für wünschenswert hält, zur Ruhe kommen. Irgendwann sei nichts mehr von Bedeutung, was nicht "das reine Schauen und das rechte Verstehen der existenziellen Situation fördert."
Sutra: Was folgt, wenn wir Santosha befolgen
Yoga Sutra II-42: Durch das Kultivieren von Zufriedenheit (Santosha) erreichen wir höchstes Glück

3. Tapas – Selbstzucht
Sanskrit
- Tapas: Hitze, Glut; Intensität; Enthusiasmus; den Körper „erhitzen“; etwas mit Freude tun; Askese; Selbstzucht; Selbstdisziplin; inneres Feuer; Hitze; Intensität der Disziplin; ständige Übung; Anstrengung;
Zugehöriges Element in einigen modernen Zuordnungen: Feuer (psychische Hülle);
Tapas hat viele Bedeutungen, auch im Yoga-Universum. Hier bei den Niyamas wird es meist im Sinne von Selbstzucht verstanden. Gemeint ist sowohl die Disziplin beim Üben von Meditation, Asana und Co. als auch der bewusste Verzicht auf Annehmlichkeiten, die uns auf lange Sicht schwächen. Ziel ist ebenfalls, über innere und äußere Reinheit ein Stärken von Körper und Geist.
Wann Selbstdisziplin in Selbstquälerei umschlägt: Ausdauer ist wertvoll, Fanatismus zerstörerisch. Selbstdisziplin bedeutet nicht, sich mit eiserner Härte durch Fastenkuren zu peitschen. Es reicht schon, Widerstände zu überwinden (morgens aufzustehen und zu meditieren), sich ungesunder Vergnügungen zu enthalten (die fünfte Tasse Kaffee ...) und einen klaren und positiven Geist trotz widriger äußerer Umstände zu bewahren (z. B. bei einer Beleidigung innerlich nicht aufzubrausen).
Sutra: Was folgt, wenn wir Tapas befolgen
Yoga Sutra II-43: Durch tapas (Entsagungen, Selbstzucht) verschwinden Unreinheiten; dies führt zu Vollkommenheit und Beherrschung vom Körper und den Sinnen
Feldnotiz zur Selbstdisziplin:
Bei Tapas ist der Trick oft nicht mehr Härte, sondern bessere Dosierung. Disziplin, die sich selbst bewundert, ist verdächtig. Disziplin, die still funktioniert, ist meist die echte.
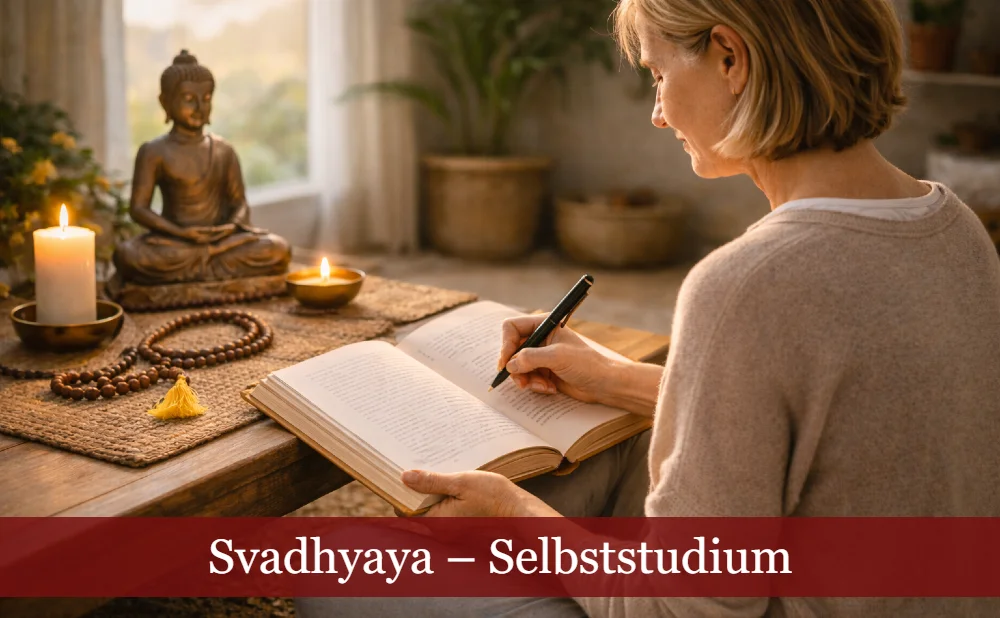
4. Svadhyaya – Selbststudium (Studium)
Sanskrit
- Sva, Swa: selbst: „zu mir gehörig“;
- Adhyaya: Untersuchung; Erforschung; nahe herangehen;
- Svadhyaya, Swadhyaya: Selbststudium; Selbsterforschung; Selbstreflexion; (innere) Reflexion; lernen von sich selbst; auf sich selbst achten;
Zugehöriges Element in einigen modernen Zuordnungen: Luft (intelektuelle Hülle);
Hier fordert uns die Yogalehre dazu auf, uns selbst immer besser kennenzulernen. Uns unserer Gedanken und Einstellungen bewusst zu werden. Die Motive unseres Handelns zu erkennen.
Selbststudium meint: innehalten. Tagebuch schreiben. Sich selbst beim Argumentieren zuhören – und hinterfragen, ob man sich gerade etwas vormacht.
In einem engeren Sinne wird Svadhya als Studium spiritueller Schriften ausgelegt. Aber auch dieses Lesen heiliger Texte soll uns letzlich zur Selbsterforschung, zum Gang nach Innen motivieren.
Sutra: Was folgt, wenn wir Svadhyaya befolgen
Yoga Sutra II-44: Durch Selbstserforschung wird man eins mit der ersehnten Gottheit (bzw. dem Ideal)
Siehe auch:
Das Niederschreiben unserer Erlebnisse, Gedanken und Gefühle hat mehrere erfreuliche und fördernde Wirkungen. Wir reflektieren das Geschehene, halten wertvolle Erkenntnisse fest und sind durch die Niederschrift zu Präzision und Klarheit angehalten. Im folgenden Artikel geben wir Tipps und Empfehlungen, wie man ein spirituelles Tagebuch führen kann. Inklusive Vorlage zum Gratis-Download.Beitrag: Spirituelles Tagebuch führen

Ein spirituelles Tagebuch führen: Diese Ereignisse gehören hinein – mit Merkkarte und Vorlage zum Download

5. Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen
Sanskrit
- Ishvarapranidhana, Ishvara Pranidhana: Verehrung des Göttlichen; Hingabe an Gott; Verehrung Gottes; Verehrung des Göttlichen; Gottvertrauen; Annehmen des Schicksals;
Zugehöriges Element in einigen modernen Zuordnungen: Äther (spirituelle Hülle);
Das Göttliche anerkennen – auch ohne religiösen Hintergrund. Es kann heißen: loslassen. Nicht alles kontrollieren wollen. Ein Stück Vertrauen ins Leben selbst.
Patanjali definiert „das Göttliche“ im Yogasutra nicht konkret. Es scheint, als will er jedem selbst überlassen, ob und wie er an etwas Göttliches glaubt. Allgemein könnte man Ishvarapranidhana als die Forderung nach einer Kultivierung einer Beziehung zu Gott verstehen.
Ralph Skuban schreibt: "Die Hingabe ... kann eine Art Schnellstraße zum inneren Licht sein." Er zählt darunter auch das Sprechen (heiliger) Mantras, Gebete, rituelle Handlungen oder Karmayoga.
Ishvarapranidhana lässt sich aber auch so deuten, dass man alles in Gottes Hände gibt. Sich schon selbst im Leben bemüht, aber das Ergebnis Gott überlässt.
Im täglichen Leben kannst du probieren, alles als göttlich anzusehen. So durch die Welt zu gehen kann sehr inspirierend sein.
Mystiker gehen noch weiter. Sie erstreben völlige Selbstaufgabe, eine Art Sterben im Leben, gemeint ist vermutlich die völlige Aufgabe des Ego über die bedingungslose Hingabe (Liebe) zum Höchsten bzw. der Quelle, aus der alles entstand, meist Gott genannt. Im Zen (ohne Gott) heißt es ähnlich:
"Der Suchende wird zum Tal."
Dann werden alle Geheimnisse der Seele offenbart (Johannes vom Kreuz, 1542-1591, schrieb dies im Dunklen einer Gefängniszelle, inmitten der Folter durch die Inquisition in der Schrift "Die dunkle Nacht der Seele", gefunden bei Ralph Skuban).
Sutra: Was folgt, wenn wir Ishvarapranidhana befolgen
Yoga Sutra II-45: Die Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal) führt zur Vollkommenheit in Samadhi
Alle Sutras zu Ishvara / dem Göttlichen bzw. der Hingabe daran
Alle Sutras zu Ishvara / dem Göttlichen bzw. der Hingabe daran
Yoga Sutra I-23: Oder durch fromme Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal) kann es erlangt werden
Yoga Sutra I-24: Ishvarah ist als besonderes Wesen unberührt von Leid, Karma oder Wünschen
Yoga Sutra I-25: Er ist unübertroffen und Quell allen Wissens
Yoga Sutra I-26: Ungegrenzt von der Zeit ist er seit ältesten Zeiten der Lehrer aller Meister
Yoga Sutra I-27: Ishvara zeigt sich in dem Wort OM (Pranavah)
Yoga Sutra I-28: OM ist im Bewusstsein seines Sinnes mit Hingabe zu wiederholen
Yoga Sutra I-29: Durch diese Praxis erlangt man das wahre innere Selbst und alle Hindernisse verschwinden
Yoga Sutra II-1: Strenge Übungspraxis, Selbststudium und Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal) – das ist der Kriya-Yoga
Yoga Sutra II-32: Die Nyamas lauten Reinheit, Zufriedenheit, Selbstdisziplin, Selbststudium und Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal)
Yoga Sutra II-45: Die Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal) führt zur Vollkommenheit in Samadhi
Umfrage: Welches Niyama hälst du ein?
Um die Einhaltung welcher der Niyamas bemühst du dich im täglichen Leben?
Wie oben bereits gesagt: Perfekt ist wohl niemand von uns. Darum: In welchem Niyama gibst du dir Mühe?
Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓
Die bisherigen Stimmen:
| Santosha – Zufriedenheit | 27 Stimmen |
| Saucha – Reinheit | 22 Stimmen |
| Svadhyaya – Selbststudium | 22 Stimmen |
| Tapas – Selbstzucht | 19 Stimmen |
| Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen | 10 Stimmen |
Wenn Prinzipien sich widersprechen: eine alltagstaugliche Abwägung
Im wirklichen Leben stehen Yamas und Niyamas manchmal quer zueinander. Wer das nicht erlebt, lebt entweder sehr zurückgezogen – oder übersieht die Konflikte elegant. Ein klassisches Beispiel ist Satya (Wahrhaftigkeit) gegen Ahimsa (Nichtverletzen): Die Wahrheit kann treffen, manchmal sogar unnötig.
Eine pragmatische Abwägung, die in vielen Situationen funktioniert, ist diese Reihenfolge:
- Absicht prüfen: Sage ich das, um zu helfen – oder um Dampf abzulassen?
- Schaden minimieren: Was ist die ehrlichste Form, die am wenigsten verletzt?
- Zeitpunkt wählen: Wahrheit hat manchmal einen besseren Moment. Man kann richtig liegen und trotzdem falsch liefern.
- Alternativen nutzen: Wenn Wahrheit nur zerstört, kann Schweigen oder eine Frage besser sein als ein Urteil.
- Verantwortung übernehmen: Wenn ich etwas sage, trage ich die Wirkung mit – nicht nur die „Faktenlage“.
Diese Art von Abwägung macht aus Regeln etwas Lebendiges. Wer sie ernst nimmt, wird nicht „perfekt“, aber oft präziser und überraschend milder.
Häufige Fragen zu Yamas und Niyamas
- Sind das Gebote wie ein Regelwerk?
Sie können so gelesen werden, aber manche empfehlen sie mehr als Orientierung. Wer sie nur als Verbotstafel versteht, macht sie oft entweder zu streng – oder schiebt sie weit weg. Als Orientierung werden sie handhabbar. - Muss man religiös sein für Ishvarapranidhana?
Nicht zwingend. Manche verstehen darunter Gottvertrauen, andere eher die Übung, Kontrolle zu lockern und das Ergebnis nicht vollständig besitzen zu wollen. Der Kern ist weniger Dogma, mehr Loslassen von Übersteuerung. - Warum stehen Yamas und Niyamas am Anfang?
Weil sie das Fundament legen: Sie reduzieren innere Konflikte, Reue, versteckte Spannungen. Und das wiederum macht Meditation und Konzentration überhaupt erst stabil. - Ist Brahmacharya nur Sexualethik?
In vielen Lesarten ja, in anderen geht es allgemeiner um Maßhalten und Ausrichtung der Lebensenergie. Praktisch kann es beides sein: sexuelle Integrität und ein kluger Umgang mit Ablenkung, Dopamin und Dauerverfügbarkeit. - Was, wenn ich ständig scheitere?
Dann bist du vermutlich an der richtigen Stelle. Die Praxis besteht nicht aus fehlerfreiem Verhalten, sondern aus Wahrnehmung, Korrektur und manchmal aus einem trockenen Lächeln über die eigene Gewohnheitsmaschine.
Yamas und Niyamas im Berufsleben: nüchtern betrachtet
Im Job sind Yamas und Niyamas kein Wohlfühlprogramm. Sie sind eher ein Mittel gegen Reibungsverluste.
- Ahimsa heißt im Arbeitskontext oft: keine Demütigung, keine passiv-aggressive Kommunikation, keine „kleinen“ Machtspiele.
- Satya heißt: Fakten sauber halten, Versprechen realistisch formulieren, Fehler nicht elegant verschwinden lassen.
- Asteya heißt: keine Ideen klauen, keine Credits verschieben, keine Zeit der anderen als selbstverständlich behandeln.
- Brahmacharya heißt: Grenzen und Energie schützen – auch gegen die eigene Neigung, sich über Leistung zu definieren.
- Aparigraha heißt: weniger Klammern an Status, Titel oder die Illusion, alles kontrollieren zu können.
Auf der Niyama-Seite wirkt es wie mentale Ergonomie:
Saucha (Klarheit) macht Arbeit oft schneller. Santosha (Zufriedenheit) reduziert den Vergleichsdruck. Tapas (Übungsenergie) verhindert das Zickzack. Svadhyaya (Selbststudium) schützt vor Wiederholungsschleifen. Ishvarapranidhana (Hingabe/Vertrauen) hilft, Ergebnisse nicht mit dem eigenen Wert zu verwechseln.
Die Yamas und Niyamas in der Hatha Yoga Pradipika
Aus dem 1. Kapitel der Hatha-Yoga-Pradipika:
Vers I-15: Übermaß an Essen, zu starke Anstrengung, Geschwätz, Befolgung falscher Regeln, falsche Gesellschaft und Unbeständigkeit - diese sechs Sünden machen Yoga wirkungslos.
Vers I-16: Fester Wille/Enthusiasmus, Mut, Beharrlichkeit/Geduld, Wahrheit, wahres Wissen über das Sein und das Aufgeben von [nur unförderlicher?] Gemeinschaft mit Menschen – diese sechs Dinge führen den Yoga zum Erfolg.
Dann folgen die Regeln von Yama und Niyama, nahezu verdoppelt gegenüber den Sutras des Patanjali:
Hinweis: Die folgenden beiden Verse I-17 und I-18 wurden vermutlich erst späteren Textfassungen der Pradipika hinzugefügt.
Vers I-17: Nun folgen die Yama und Niyama: Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, Selbstbeherrschung, Nachsicht, Entschlossenheit, Mitgefühl, Aufrichtigkeit, Mäßigung und Reinheit sind gewiss Yama.
Vers I-18: Selbstzucht, Zufriedenheit, Gläubigkeit, Freigebigkeit, Gottes-Verehrung, Studium der Aussagen der heiligen Schriften, Schamhaftigkeit, Einsicht, Opfer und Japas [Mantrawiederholung, Gebete], das sind die 10 Niyamas, die von denjenigen genannt werden, die mit den Yoga-Schriften vertraut sind.
Zusammengefasst: Warum sollten wir die Yamas und Niyamas im täglichen Leben einhalten?
Die Gründe in Kurzform:
- Um spirituell wachsen zu können
- Um Leiden zu vermeiden
- Um positive Gefühle und gutes Karma anzusammeln
- Als Richtschnur für den spirituellen Pfad und zum Selbstschutz
- Wir werten uns nicht ab
- Um eine ungünstige / leidvolle Wiedergeburt zu umgehen
- Um gesund zu bleiben und tiefer zu meditieren
Erläuterungen zu diesen Gründen obenim Text und zusammengefasst in Sutra II-30 (für die Yamas) und Sutra II-32 (für die Niyamas).
Fazit: Yamas und Niyamas im täglichen Leben
Die Yamas und Niyamas sind keine staubigen Regeln aus alter Zeit, sondern Werkzeuge, die dich mitten im Alltag begleiten können. Sie erinnern daran, dass es oft kleine Gesten sind – nicht hupen, ehrlich sein, Maß halten, aufräumen, zufrieden sein –, die das große Ganze formen.
Vielleicht liegt genau darin ihre zeitlose Kraft: Sie bringen den Yoga vom Podest in den Alltag. Und genau da, zwischen Supermarkt, Laptop und Familienessen, haben sie ihre größte Wirkung.

Ergänzung oder Frage von dir
Gibt es eine Frage zum Beitrag, etwas zu ergänzen oder vielleicht sogar zu korrigieren?
Fehlt etwas im Beitrag? Kannst du etwas beisteuern? Jeder kleine Hinweis/Frage bringt uns weiter und wird in den Text eingearbeitet. Vielen Dank!

Im Zusammenhang interessant
Interessante Fakten zu den Yamas und Niyamas
- Ethisches Fundament älter als Patanjali – Die Yamas und Niyamas finden sich schon in frühen Upanishaden und Dharma-Texten. Patanjali systematisierte sie nur.
- Ahimsa als politische Praxis – Gandhi machte Gewaltlosigkeit zu einem Grundprinzip seines Widerstands. Später wurde gewaltfreier Widerstand auch in anderen Bürgerrechtsbewegungen aufgegriffen, unter anderem in den USA.
- Satya kann Schweigen bedeuten – In manchen Traditionen gilt Schweigen als höchste Form der Wahrhaftigkeit, wenn jedes Wort nur Verwirrung stiften würde.
- Asteya und digitale Welt – Schon Vyasa warnte vor „geistigem Stehlen“. Heute wäre das schlicht: keine Bilder, Musik oder Texte ohne Erlaubnis kopieren.
- Brahmacharya ohne Zölibat – Im antiken Indien war Brahmacharya ursprünglich die Lebensphase des Lernenden – nicht zwingend sexuelle Enthaltsamkeit, sondern Konzentration auf Studium und Charakterbildung.
- Minimalismus avant la lettre – Aparigraha fordert nicht erst heute „Weniger ist mehr“. Schon vor 2000 Jahren galt Besitzanhäufung als Hindernis für geistige Freiheit.
- Niyamas als psychische Hygiene – Saucha (Reinheit) war nie nur körperlich gemeint. Schon alte Yogis sprachen von „mentaler Verschmutzung“ durch schlechte Gesellschaft oder negative Gedanken – fast wie ein Vorläufer moderner Psychologie.
Download Yamas und Niyamas als Poster und Merkkarte
Yamas & Niyamas als Poster
Wir haben ein Poster von den Yamas und Niyamas erstellt:

Das Bild als DIN A4 - Poster:
Yamas & Niyamas als Merkkarte
Alternativ/ergänzend kannst du dir die Yamas & Niyamas auch als kleine Merkkarte für die Geldbörse herunterladen. Einfach runterladen, ausdrucken und ausschneiden:
Weiterlesen
Das Ziel des Yoga ist ein stiller Geist, siehe dazu Yoga-Sutra I-2. Patanjali empfiehlt hierfür dem achtfachen Pfad zu folgen:
- Yama – 5 ethische Verhaltensregeln
- Niyama – 5 Regeln der Selbstdisziplin
- Asana – Körperstellungen, bei Patanjali nur Sitzhaltungen
- Pranayama – Atemübungen zur Atemkontrolle
- Pratyahara – Zurückziehen der Sinne nach innen
- Dharana – Konzentration auf ein einzelnes Objekt
- Dhyana – Meditation; Ziel: die Stille
- Samadhi – Nach längerer Stille und innerer Entwicklung kommt es zum Überbewusstsein, zu völliger Selbsterkenntnis; Erleuchtung
Wichtig: Alle Stufen sind wichtig und notwendig zur Erreichung des Yoga-Zieles. Also auch Yama und Niyama nicht vergessen ;-)
➔ Hintergründe und alte Schriften zum achtfachen Pfad des Raja Yoga

- Beliebte Yoga-Sprüche & Zitate
- Gibran - der Prophet - Von der Liebe
- Sat Nam - das Mantra der inneren Wahrheit
- Buntes Wissen aus der Welt des Yoga
- Yoga-Gedichte
Weitere beliebte Yoga-Beiträge
- Buddha-Zitate - die Top-27 für dein tägliches Leben
- Yamas und Niyamas
- Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die 5 Lebensregeln der Societas Jesus
- Das Leben ... (von Mutter Teresa)



