Yoga Sutra Pratyaya
Die Übersetzungen / Bedeutungen für/von Pratyaya sind vielfältig. Unter anderem:
a) Ursache, Motiv, Zustand, Zeichen;
b) Gebrauch, Gewissheit, Vertrauen, Glauben, Zuversicht, Überzeugung;
c) Gedanke, vorgestellte Idee, die Vorstellung, geistiges Bild, Wissen, Vorstellung, das Denken, Bewusstsein, Geist, Intellekt.
Adolf Jandcek, Prag; untersuchte die Bedeutung von Pratyaya im Yogasutra. Patanjali verwendet es an mehreren Stellen (I 10, 18, 19, II 20, III 2, 12, 19, 35, IV 27) das Wort pratyaya. Er kommt zu folgenden Schlussfolgerungen (Eigenübersetzung):
Durch die Analyse aller Sutras von Patahjali, in denen das Wort pratyaya vorkommt, können wir die Schlussfolgerungen wie folgt zusammenfassen:
1. Pratyaya als zentripetaler Impuls bezieht sich auf die ursprüngliche Bedeutung, d. h. das, was in Richtung von jemandem oder etwas kommt. Der Begriff Impuls ist geeignet gewählt, weil er die Bedeutung des Wortes besser ausdrückt als die Worte mitwirkende Ursache, äußere Ursache, Vorstellung.
Zugleich drückt er das Anfangsstadium als Ursache jeder Tätigkeit aus und schließt den Sinn aus, nach dem man über andere Stadien urteilen könnte, insbesondere über das Endstadium wie bei Vorstellung, präsentierte Idee, Fluktuation, Erkenntnis. Dieses Anfangsstadium hat eine feste Stütze im Text der Yoga-Sutras, besonders in I 10, wo die Beziehung zwischen pratyaya als dem Anfang und vrtti als der Folge ausgedrückt wird.
2. Pratyaya als zentripetaler Impuls bezieht sich auf die objektive Realität, auf die Quelle, aus der er entspringt. Eine Stütze für diese Erklärung findet sich im Sutra IV 27, wonach pratyaya aus samskaras - Eindrücken - entsteht.
Samskaras gehören nach Vyasas Interpretation auch zur gleichen Kategorie wie Vastu - äußeres Objekt, d. h. Impulse von einem äußeren Objekt und von sarnskaras sind dasselbe. Vastu strahlt Grahyasakti aus - die Kraft, erfasst oder erkannt zu werden.
3. Wenn wir Impuls als die Bedeutung von pratyaya wählen, kommen wir zu folgender Impulsfolge:
a) negativer Impuls - abhdvapratyaya in der hemmenden Form nidra,
b) hemmender Impuls - virdmapratyaya in asamprajiidtanirodha,
c) angeborener Impuls - bhavapratyaya, d. h. dieser hemmende Impuls ist bei manchen Menschen angeboren,
d) erwünschter Impuls - updyapratyaya, ein von den Kommentatoren verwendeter Begriff, der sich auf einzelne spezielle Methoden von sraddhd bis prajnd bezieht,
e) Ausgleich von Impulsen - tulyapratyaya im Falle von Transformationen des Geistesstoffes, cittaparindma,
f) Untersuchungsimpuls, durch den der Sinn von Sprache und Klängen gefunden wird, und auch das Bewusstsein eines anderen Menschen und die Wirklichkeit erkannt werden,
g) überlappender, sich vermischender, undifferenzierter Impuls - ... - Essen, oder Erfahrung,
h) fließender Impuls - pratyaya-ekatanata im Falle von dhydna. Das Wesen dieser Impulse besteht darin, entweder Erregung oder Hemmung bzw. Hemmung der Hemmung (Enthemmung) hervorzurufen.
4. Das Vorhandensein solcher Impulse, die verschiedene Funktionen ausüben, kann auf dem Gebiet der experimentellen Physiologie der höheren Nerventätigkeit bewiesen werden, wie es durch die Ergebnisse von I. P. Pavlov und seiner Schule bewiesen wurde (oder auch auf dem Gebiet der Technik in der Radiophonie usw.).
5. Die Bedeutung von pratyaya als Impuls gibt allen Sutras des Grundtextes der Yoga-Sutras, in denen dieser Ausdruck vorkommt, einen klaren Sinn und ermöglicht darüber hinaus auch eine präzise Erklärung des gesamten in den Yoga-Sutras erwähnten Verfahrens.
a) In erster Linie ist es möglich, klar zu erklären, dass nidra nicht Schlaf bedeutet, wie es von den Kommentatoren angenommen wurde, die sich ganz berechtigten Einwänden gegen ihre Interpretation stellen mussten. Die Bedeutung von pratyaya als Impuls beseitigt diese Einwände und ermöglicht darüber hinaus, nidra als eine der fünf Formen von vrttis zu klassifizieren.
b) Eine korrekte Interpretation von virdmapratyaya als hemmender Impuls führt zur Bestimmung der Beziehung nirodha, samddhi, kaivalya in dem Sinne, dass nirodha eine Voraussetzung für Samadhi ist. Dies widerlegt auch die Vermutung der Kommentatoren und einiger Indologen, dass es einen Konflikt zwischen den beiden Texten über samprajhata nirodha und sabija Samadhi gibt. Die Existenz eines Impulses, der eine Hemmung hemmt, gibt dem Sutra I 51 einen klaren Sinn.
c) Die Bedeutung von pratyaya als Impuls gibt den Sutras über das Erreichen von Vollkommenheiten einen Sinn.
d) Besonders bedeutsam ist, dass pratyaya als Impuls der Grundkonzeption von Patahjali einen anderen Sinn gibt, nämlich dass Patanjalis Ausgangspunkt realistisch und nicht idealistisch ist, wie die Kommentatoren annahmen.
e) Pratyaya als Impuls rückt auch das Verhältnis der Kommentatoren zu den Yoga-Sutras insofern in ein anderes Licht, als schon der erste Kommentator Vyasa den Sinn des Grundtextes nicht richtig verstanden hat, so dass der Grundtext viel älter ist als der Kommentar, als bisher angenommen wurde, womit die Frage der Autorenschaft zugunsten des Grammatikers Patanjali gelöst ist. Andererseits sind die Kommentare ein zuverlässiger Wegweiser, um den ursprünglichen Sinn des Grundtextes zu finden.
f) Durch all dies rückt die korrekte Auffassung von pratyaya als Impuls die obskuren und lakonischen Formulierungen des Patanjali in ein klares Licht.
g) Es trägt auch zum Nachweis bei, dass der Grundtext der Yoga-Sutras eine vollständige Einheit bildet und nicht aus verschiedenen Texten verschiedener Yogaschulen verschiedener Zeiten besteht, die erst vom letzten Herausgeber zusammengestellt wurden.
h) Es ermöglicht auch, verborgene Eindrücke zu finden, die den Zusammenhang mit den Erfahrungen und Gedanken der altindischen Medizinschule herstellen.
i) Schließlich macht es den Weg frei für eine wissenschaftliche experimentelle Erforschung der Yoga-Sutren, die sowohl aus psychophysiologischer als auch aus experimenteller Sicht interessant ist.
Das Ziel dieser Studie war es, einen Beitrag in dieser Richtung zu leisten.
Quelle: https://archive.org/details/JANACEK1957TheMeaningOfPratyaya/page/n57/mode/2up
-
Yoga Sutra I-10: Schlaf wird die Erscheinungsform des Geistes genannt, welche von Abwesenheit jedwedes Inhaltes gekennzeichnet ist

Abhâva–pratyayâlambanâ [tamo-]vrittir nidrâ
अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्राNun geht es um den traumlosen Schlaf. Eigentlich ist dabei nicht viel los. Doch ein Yogi weiß auch diesen Zustand zu nutzen.
-
Yoga Sutra I-18: Ein weiterer Zustand des Samadhi - Virama Pratyaya - ist nach intensiver Übung erreicht, wenn alle geistigen Aktivitäten aufhören und nur (ein Rest) unmanifestierter Eindrücke im Geist (eine Form der Leere) verbleiben

Virâma–pratyayâ-abhyâsa–pûrvah samskâra–seso nyah
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यःWir tauchen tiefer in die Welt des Samadhi ein. Sutra I-18 erläutert Virama-Pratyaya. Dieser Zustand muss schon sehr wonnevoll und reich an intuitiven Erkenntnissen sein. Aber Achtung! Es droht Gefahr...
-
Yoga Sutra I-19: Dieses [Virama Pratyaya oder Asamprajnata Samadhi] kann [auch] von Geburt aus, durch frühere Körperlosigkeit oder durch Verschmelzung mit der Natur (Prakriti) erlangt werden
 Bhava-pratyayo videha-prakṛti-layānām
Bhava-pratyayo videha-prakṛti-layānām
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्In den Sutras I-19 und I-20 geht es um "mittlere Samadhi-Zustände". Es ist nicht ganz klar, ob sich Patanjali mit "dieses/dieser" auf den Asamprajnata Samadhi allgemein oder den Zwischenzustand Virama Pratyaya aus Sutra I-18 bezieht. So unterscheiden sich die Übersetzungen erheblich und bieten ein schönes Beispiel dafür, wie unterschiedlich das alte Sanskrit gedeutet werden kann. Ich finde es trotzdem nützlich, sich die unterschiedlichen Deutungen vor Augen zu führen. Wir können sie in unserem Geist abwägen und die jeweilige Deutung in unserem eigenen Leben überprüfen.
-
Yoga Sutra II-20: Der sehende ist reines Bewusstsein; doch er sieht [die Welt] durch den [täuschungsanfälligen] Geist
 draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho-pi pratyaya-anupaśyaḥ
draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho-pi pratyaya-anupaśyaḥ
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यःPatanjali beschreibt unsere grundlegende Essenz und deren Wahrnehmung der Welt. In diesem Wahrnehmungsprozess kommt es gemäß der Yogalehre leicht zu Verwirrung und Täuschung. Es finden sich hier interessante Parallelen zur modernen Wahrnehmungspsychologie.
-
Yoga Sutra III-2: Wenn die Wahrnehmung des Objektes ungebrochen fließt, ist es Dhyana (Meditation)
 Tatra pratyaya-ikatānatā dhyānam
Tatra pratyaya-ikatānatā dhyānam
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्In Sutra 3.2 kommen wir von der Konzentration zur Meditation. Dies ist eine der relevantesten Sutra für deine tägliche Yogapraxis. Entscheidend ist, dass du deine Konzentration auf dein Meditationsobjekt stetig verlängerst, so dass ein ununterbrochender Fluß entsteht. Wir werden im Artikel Übersetzung und Bedeutung untersuchen, Kommentare von Gelehrten betrachten und herausfinden, wie wir den Weg zu Dhyana in unseren Alltag integrieren können.
In III-2 wird der Übergang von Konzentration zu Meditation erläutert: ► Der Weg zu Dhyana ► Daran erkennst du Dhyana ► Übungen für den Alltag ► Übersetzungsalternativen ►...
-
Yoga Sutra III-12: Die dritte Verwandlung: ekagrata-parinama. Ekagrata (Einpünktigkeit der Konzentration) tritt ein, wenn die kommenden und gehenden wandelbaren Inhalte des Geistes in zwei Zeitpunkten gleich sind.
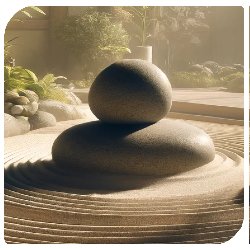 Tataḥ punaḥ śātoditau tulya-pratyayau cittasya-ikāgratā-pariṇāmaḥ
Tataḥ punaḥ śātoditau tulya-pratyayau cittasya-ikāgratā-pariṇāmaḥ
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामःHier nun wird die dritte Verwandlung des Geistes des Yogis/ der Yogini beschrieben: die Transformation durch „einpünktige Konzentration“. Dabei empfindet sich das zeitliche Empfinden des fortgeschrittenen Meditierenden.
-
Yoga Sutra III-17: Klang, Vorstellung und Bedeutungen überlagern sich, wenn wir etwas hören. Das verwirrt den Geist. Mit Samyama auf die Trennung dieser Drei versteht der Yogi die Sprachen aller Wesen
 Shabdârtha-pratyayânâm itaretarâdhyâsât samkaras tat-pravibhâga-samyamât sarva-bhûta-ruta-jnânam
Shabdârtha-pratyayânâm itaretarâdhyâsât samkaras tat-pravibhâga-samyamât sarva-bhûta-ruta-jnânam
शब्दार्थप्रत्ययामामितरेतराध्यासात्संकरः तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम्Alle Sprachen sprechen, alle Tiere verstehen – wer würde nicht gerne diese Fähigkeit haben? Patanjali schreibt, dass der Yogi Samyama auf die verschiedenen Bedeutungsebenen des Gehörten legen solle, diese Ebenen klar voneinander trennen möge und so alles von Mensch oder Tier Geäußerte verstehen könne. In den Kommentaren zu dieser Sutra finden wir Ansätze, wie wir im Alltag dieses Siddhi üben können.
-
Yoga Sutra III-19: Durch Samyama auf den Geist eines Menschen erkennt der Yogi dessen Gedanken
 pratyayasya para-citta-jñānam
pratyayasya para-citta-jñānam
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्Kann ein fortgeschrittener Yogi die Gedanken anderer Menschen lesen? Patanjali sagt: ja, und zwar wenn ein Yogi Samyama auf den Geist eines Anderen ausübt. Worauf soll man sich dabei konkret konzentrieren?
-
Yoga Sutra III-36: Weltliche Erfahrungen wie Vergnügen und Genuss beruhen (nur) auf der fehlenden Unterscheidung zwischen dem wahren Selbst (Purusha) und dem eigenen (reinen/sattvigen) Intellekt (Buddhi).
Wissen um und Bewusstsein für das wahre Selbst entsteht durch Samyama auf dessen Interessen.
 Sattwa-purushayor atyantâsamkirnayoh pratyayâvishesho bhogah parârthât svârtha-samyamât purusha-jnânam
Sattwa-purushayor atyantâsamkirnayoh pratyayâvishesho bhogah parârthât svârtha-samyamât purusha-jnânam
सत्त्वपुरुषायोः अत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषोभोगः परार्थत्वात्स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम्Wer sich nicht nur mit dem „was“, sondern auch mit dem „warum“ hinter dem Yoga beschäftigen möchte, landet früher oder später bei den tiefgründigen Versen des Yoga Sutra von Patanjali. Einer davon – Sutra III.36 – hat es besonders in sich. Hier geht’s nicht um akrobatische Posen oder Atemtechniken, sondern um das feine Gespür für das, was in uns wirklich echt ist. Im Artikel findest du die Deutungen und Erläuterungen der Kommentatoren des Yogasutra zu wahrem Selbst, Verstand, inneren Impulsen, äußeren Reizen und spirituellem Ehrgeiz. Und vielleicht – nur vielleicht – bringt dich dieser Vers ein kleines Stück näher an das, was du tief in dir längst bist.
Diese Sutra ist für viele Kommentatoren ein sehr wichtiger Vers. Denn wenn ein Yogi unterscheiden kann, was im Leben dem wahren Selbst dient bzw. in dessen Interesse liegt, so kann er stets eine gute Entscheidung treffen und viele Klippen auf dem spirituellen Pfad umschiffen. Patanjali mahnt vermutlich mit dieser Aussage auch davor, die übersinnlichen Fähigkeiten, die in diesem dritten Kapitel das Hauptthema sind, nicht allzu wichtig zu nehmen bzw. ihnen nicht allzu sehr nachzueifern.
-
Yoga Sutra IV-27: Jedoch kommt es aufgrund noch vorhandener Prägungen (Samskaras) immer wieder zu andersartigen Vorstellungen und damit zu Unterbrechungen (Brüchen – chidreṣu) dieser Unterscheidungskraft
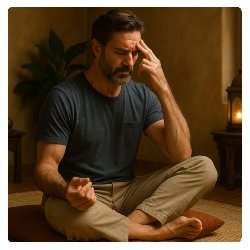 tac-chidreæu pratyayântarâñi samskârebhyah
tac-chidreæu pratyayântarâñi samskârebhyah
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यःWir befinden uns im vorletzten Abschnitt des Yogasutras, Thema ist weiter die Unterscheidungskraft Viveka. Diese ist die Basis für die innere Freiheit (Kaivalya) der/des nach Erleuchtung Strebenden. Patanjali macht hier darauf aufmerksam, dass auch ein weit entwickelter Yogi immer wieder durch seine unbewussten Prägungen zeitweise vom Pfad gestoßen werden kann. Die Vorprägungen (Samskara) trüben dann die Unterscheidungskraft. Folgende Fragen stellen sich: Wie erkenne ich, dass meine Unterscheidungskraft schwächelt, ich irrigen Ansichten fröne? Und: Wie erkenne ich wieder, was richtig ist?
Dieser Artikel führt dich durch klassische Kommentare, moderne Deutungen und wissenschaftliche Parallelen – und zeigt dir, warum die alten Eindrücke (Samskaras) selbst im klarsten Geist noch herumspuken, und wie du damit umgehen kannst.
