tac-chidreæu pratyayântarâñi samskârebhyah
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः
Wir befinden uns im vorletzten Abschnitt des Yogasutras, Thema ist weiter die Unterscheidungskraft Viveka. Diese ist die Basis für die innere Freiheit (Kaivalya) der/des nach Erleuchtung Strebenden. Patanjali macht hier darauf aufmerksam, dass auch ein weit entwickelter Yogi immer wieder durch seine unbewussten Prägungen zeitweise vom Pfad gestoßen werden kann. Die Vorprägungen (Samskara) trüben dann die Unterscheidungskraft. Folgende Fragen stellen sich: Wie erkenne ich, dass meine Unterscheidungskraft schwächelt, ich irrigen Ansichten fröne? Und: Wie erkenne ich wieder, was richtig ist?
Dieser Artikel führt dich durch klassische Kommentare, moderne Deutungen und wissenschaftliche Parallelen – und zeigt dir, warum die alten Eindrücke (Samskaras) selbst im klarsten Geist noch herumspuken, und wie du damit umgehen kannst.
Kurz zusammengefasst
- Sutra 4.27: Selbst fortgeschrittene Unterscheidungskraft (Viveka) wird in Intervallen durch alte Eindrücke (Samskaras) unterbrochen.
- Klassische Kommentare: Vyasa, Bhoja und Vacaspati Mishra betonen, dass diese Rückfälle aus den Resten alter Prägungen stammen, die nach und nach erlöschen.
- Übersetzungsvarianten: Alle Fassungen beschreiben denselben Kern, unterscheiden sich aber in Nuancen („Unterbrechungen“ vs. „Intervalle“, „Vorprägungen“ vs. „Eindrücke“).
- Praxis in Meditation: Beobachte aufsteigende Gedanken wie vorbeiziehende Wolken – nicht bekämpfen, nicht festhalten.
- Praxis im Alltag: Erkenne alte Muster (z. B. Ärger im Straßenverkehr, automatisches Scrollen am Handy) und lerne, nicht automatisch darauf einzusteigen.
- Moderne Wissenschaft: Neuropsychologie und Achtsamkeitsforschung bestätigen, dass alte Muster in Form unbewusster Gewohnheiten und intrusiver Gedanken auftauchen.
- Ziel: Kontinuierliche Wachheit und Demut – Rückfälle sind Teil des Weges, nicht dessen Scheitern.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Tad, tat = diese; der, die, das;
- Cidrresu, cidrreṣu, chidreṣu, chidresu, von: chidra = Unterbrechung; grundlegende Veränderung; Bruch; Loch; Öffnung; in Stücke schneiden; auseinander brechen; unzusammenhängend oder diskontinuierlich; zerrissen; durchlöchert; defekt; dazwischen;
- Tach-chidreshu = darin Unterbrechungen in ihm;
- Pratyaya = Bewusstseinsinhalt; Gedanke; Eindruck; Vorstellung; Inhalte oder Objekte des Geistes; Erfahrung; Erkenntnis; Überzeugung, Meinung, Glaube; Gewissheit; Absicht; Begriff; Erkennen;
- Antarani, antarāṇi, antaraṇi = andere; Andere; Anderes; verschiedene; Inneres; nahe; intim; innerlich; darin enthalten; damit verbunden;
- Pratyayantarani, pratyayântarâni = andere Pratyayas, Gedanken;
- Samskarebhyah, samskârebhyah, saṁskārebhyaḥ = aus (der Stärke der) Samskaras, aus Vorprägungen, früheren Neigungen, unbewussten Eindrücken;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Das vierte Kapitel des Yogasutra, der Kaivalya-Pada, widmet sich der endgültigen Befreiung und den subtilen Mechanismen, die dahin führen. Patanjali beginnt mit der Erklärung, dass außergewöhnliche Fähigkeiten (Siddhis) nicht das Ziel des Yoga sind, sondern Nebenprodukte durch Geburt, Pflanzen, Mantras, Askese oder Meditation entstehen können. Es wird klargestellt, dass der Geist selbst wandelbar bleibt und dass das eigentliche Ziel nicht in der Anhäufung von Kräften, sondern im Erkennen der Unterschiedlichkeit von Purusha (reines Bewusstsein) und Prakriti (Natur) liegt. Der Text beschreibt die feinen Bindungen, die selbst nach großer Klarheit weiterbestehen, und betont, dass nur die Überwindung von Kleshas (Leidursachen) und Samskaras (tiefen Prägungen) den Weg zur endgültigen Freiheit öffnet.
Bis Sutra 4.27 entwickelt Patanjali die Logik, dass wahre Unterscheidungskraft (Vivekakhyāti) durch kontinuierliche Praxis wächst. Doch auch auf diesem hohen Niveau kann der Prozess gestört werden: Alte Eindrücke und unbewusste Prägungen tauchen auf, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt. So schildert der Kaivalya-Pada bis hierhin die Dialektik von Fortschritt und Rückfall: Der Yogi nähert sich dem Zustand der Befreiung, bleibt aber anfällig für die letzten Reste konditionierter Gedanken. Patanjali mahnt so zur Wachsamkeit und erinnert, dass die endgültige Freiheit nicht durch einzelne Erlebnisse, sondern durch das vollständige Verlöschen aller Samskaras erreicht wird.
Übersichtstabelle
| Abschnitt / Sutra-Bereich | Hauptthema | Kernaussage |
|---|---|---|
| 4.1–4.6 | Entstehung übernatürlicher Kräfte (Siddhis) | Siddhis entstehen durch Geburt, Pflanzen, Mantras, Askese oder Meditation, sind aber nicht das Ziel des Yoga. |
| 4.7–4.12 | Karma und Eindrücke | Das Wirken von Karma und Samskaras prägt den Geist; auch der Yogi bleibt zunächst eingebunden, bis Eindrücke überwunden sind. |
| 4.13–4.20 | Natur des Geistes | Der Geist spiegelt viele Inhalte, bleibt aber selbst ein Objekt; nur Purusha ist reines Bewusstsein. |
| 4.21–4.26 | Wachsendes Erkennen | Durch beständige Unterscheidung (Viveka) nähert sich der Geist dem Zustand von Kaivalya; der Unterschied zwischen Purusha und Prakriti wird klarer. |
| 4.27 | Unterbrechungen der Unterscheidungskraft | Auch in fortgeschrittener Erkenntnis steigen alte Eindrücke (Samskaras) in Pausen der Klarheit auf und stören die Kontinuität. |
Die letzten Sutras IV-27 bis IV-34 befassen sich mit Samadhi, Kaivalya und dem Enden der Bindung an die Gunas.
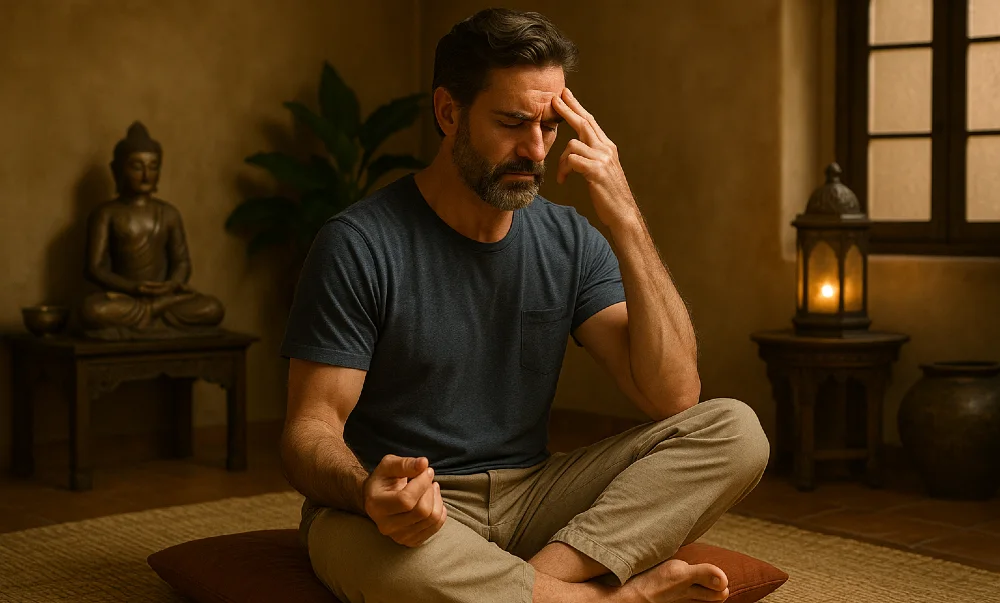
Yogasutra 4.27: Vergangene Eindrücke und die Unterbrechungen der Unterscheidungskraft
Bedeutung der Sutra-Aussage im Kontext der Praxis
Yogasutra 4.27 beschreibt ein Phänomen, das viele Meditierende nur zu gut kennen: Selbst wer schon eine weit entwickelte Unterscheidungskraft (viveka-khyāti) erlangt hat – also die Fähigkeit, Wesentliches vom Unwesentlichen klar zu unterscheiden –, erlebt, dass diese Klarheit nicht immer lückenlos anhält. „Jedoch kommt es zunächst aufgrund vergangener Prägungen (Samskaras) immer wieder zu Unterbrechungen dieser Unterscheidungskraft,“ heißt es in einer deutschen Übersetzung der Sutra. In Patanjalis knapper Originalsprache klingt das so: tach-chhidreṣu pratyayāntarāṇi saṃskārebhyaḥ – „In den Lücken treten andere Gedankeninhalte aufgrund der Saṁskāras (Eindrücke) auf.“ Mit anderen Worten: Immer wenn die innere Wachheit eine Lücke bekommt, schieben sich eventuell alte Eindrücke aus der Vergangenheit dazwischen und trüben den meditativen Frieden.
Aber irgendwann verlieren diese Samskaras ihre Kraft. Klassische Kommentare liefern hierfür ein anschauliches Bild: Genau wie geröstete Samen auf einem Feld nicht mehr keimen können, werden die übrigen Eindrücke durch das Feuer der Unterscheidungskraft letztlich unfruchtbar gemacht. Doch bis es soweit ist, können diese „Samen“ immer wieder kleine Triebe – sprich Gedanken – hervorbringen. Patanjali betont, dass solche Zwischenfälle normal sind auf dem Weg zur völligen inneren Freiheit (kaivalya). Entscheidend ist, wie man damit umgeht.
Schlüsselbegriffe der Sutra: von Saṁskāra bis Viveka-khyāti
Um den Gehalt der Sutra ganz zu erfassen, lohnt ein Blick auf die zentralen Begriffe.
Saṁskāra
Saṁskāra – im Deutschen oft als Eindruck, Prägung oder Konditionierung übersetzt – bezeichnet in der Yogaphilosophie die feinen Spuren, die Erlebnisse und Handlungen im Geist hinterlassen. Jede Erfahrung, ob schmerzhaft oder lustvoll, legt gemäß dieser Theorie einen subliminalen Abdruck in unserem mentalen Speicher an. Diese Eindrücke ruhen meist unsichtbar im Unterbewusstsein, doch sie verschwinden nicht. Im Bild der Yogis liegen sie wie Samenkörner im Boden unseres Geistes bereit. Sobald sich Gelegenheit bietet – „wenn Lücken entstehen“ – keimen sie auf und treten ins Bewusstsein.
Das können Erinnerungen, unbewusste Wünsche oder alte Emotionen sein, die plötzlich wieder da sind, ohne dass wir es wollen. Moderne Psychologen würden vielleicht von unterbewussten Gedächtnisinhalten oder Konditionierungen sprechen; Patanjali nennt es Saṁskāras. Es ist bemerkenswert, dass diese Theorie der mentalen Eindrücke als ein früher Vorläufer heutiger psychologischer Konzepte gesehen werden kann – sie ist einer von Indiens faszinierendsten Beiträgen zur Psychologie.
Samskaras gibt es nicht umsonst. Unser Geist ist für das Überleben in dieser Welt geprägt, lässt dich zum Beispiel bestimmte Nahrung verlangen (die nicht immer gut für dich ist), drängt zu sozialem Austausch, zu sexueller Aktivität usw. Alles hat seinen Grund.
Swami Vivekananda schreibt dazu: „Die vielen Gedanken, die in uns aufsteigen und uns weismachen wollen, wir brauchen etwas von außen zu unserem Glück, stehen jener Vollkommenheit im Wege.“
Welche alten Muster (Samskaras) tauchen bei dir am häufigsten auf?
Viveka-Khyāti
Der zweite Schlüsselbegriff ist viveka-khyāti, die Erkenntnis der Unterscheidung. Gemeint ist ein anhaltender Bewusstseinszustand höchster Klarheit, in dem man das Wirkliche vom Unwirklichen, das Selbst vom Nicht-Selbst, unfehlbar unterscheidet. Diese Unterscheidungskraft ist das Licht, das alle Dunkelheit der Unwissenheit vertreibt. Patanjali betont an mehreren Stellen (z. B. YS 2.26), dass ununterbrochene Unterscheidungsfähigkeit das Mittel zur Befreiung ist. In Sutra 4.27 geht es nun genau um die Unterbrechungen ebendieser Unterscheidungskraft.
Das Sanskritwort chidra (chidresu ) bedeutet „Lücke“ oder „Riss“. Man könnte sagen: solange viveka nicht aviplava – ununterbrochen – ist, schleichen sich in den kleinen Rissen der Achtsamkeit sofort wieder andere pratyayas (Gedankeninhalte, Rainbowbody: „Das Wort Pratyaya wird verwendet, um den partiellen oder fragmentierten Inhalt des dualistischen Geistes zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beschreiben.”) ein, genährt aus den Vorräten der Saṁskāras. Die Kunst des fortgeschrittenen Yoga besteht also darin, diese Lücken immer weiter zu schließen, bis die Unterscheidungskraft lückenlos und dauerhaft wird. Dann, so heißt es, tritt der dharma-megha-samādhi ein, der „Wolke der Tugend“-Zustand (YS 4.29), und echte innere Freiheit ist zum Greifen nah.

Zwei Schritte vor, einen zurück
Spiritueller Fortschritt ist oft schwankend. Zu manchen Zeiten ereilen uns tiefe Erkenntnisse, an anderen Tagen tappen wir in längst überwunden geglaubte Fallen. Identifizieren uns mit Gedanken, stellen alles infrage oder lassen uns von Emotionen fortspülen.
Der Zustand höchsten Samadhis wird in der Regel zunächst einmal nur für kurze Zeit erreicht, so Govindan. Aufkeimende Neigungen stören die volle Bewusstheit zunächst immer wieder. Erinnerungen und Neigungen, so Sriram, können “jederzeit" den Zustand der Erkenntnis stören. Erst nach und nach wird der Yogin alle diese (nach außen gerichteten) Dinge loslassen.
“Intelektueller Hochmut” oder “andere Formen des Denkens” (Iyengar) kommen uns in die Quere. Das endet, so steht es in Bhagavad-Gita ab Vers II-59, wenn der Yogi die Schau des Allerhöchsten meistert. Dann verschwinden alle latenten Schwächen.
Einsichten der klassischen Kommentare
Die klassischen Meister-Kommentatoren der Yogasutra – über Jahrhunderte hinweg und in verschiedenen Kulturkreisen – haben Sutra 4.27 sorgfältig erläutert. Dabei stimmen sie in der Hauptsache überein, setzen aber teils unterschiedliche Akzente. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Auslegungen der Alten und ihre bildhaften Vergleiche:
Vyāsa, der Verfasser des autoritativen Yoga-Bhāṣya (ca. 5. Jh.), erklärt zunächst ganz nüchtern, was passiert: Selbst bei einem Yogi, der über viveka-khyāti verfügt, tauchen gelegentlich andere mentale Vorgänge (pratyaya-antarāni) auf, verursacht durch frühere Eindrücke (saṃskārebhyaḥ). Diese seien jedoch bereits geschwächt und „wie verbrannte Samen“ nicht mehr keimfähig. Vyāsa betont, dass diese letzten Regungen des Geistes das Endspiel der Meditation darstellen: Sie sind die allerfeinsten Überbleibsel der Unwissenheit, die man – genau wie die Wurzeln der Kleshas – nun auch noch ausmerzen muss.
Kleshas nennt man im Yoga die geistigen Trübungen oder Ursachen des Leidens (z. B. Unwissenheit, Egoismus, Anhaftung, Aversion, Angst). Die Strategie, so Vyāsa, ist dieselbe wie zuvor bei den Kleshas: Man muss die auftauchenden Eindrücke durch die Kraft der Erkenntnis „verbrennen“ bzw. durch fortgesetzte Meditation zum Versiegen bringen.
Vācaspati Miśra (9. Jh.), der Gelehrte mit dem klangvollen Beinamen „Schmuck der Unterscheidung“ (Tattva-Vaiśāradī), geht in seinem Glossar zu Vyāsa noch etwas ins Detail. Er unterstreicht, dass die Achtsamkeit des Yogi nicht nachlassen darf, weil sonst augenblicklich die latenten Eindrücke in den Vordergrund treten. Vācaspati interpretiert das Wort chidra (Lücke) als jede Gelegenheit, bei der die Kontinuität der meditativen Versenkung unterbrochen ist – sei es auch nur für einen Sekundenbruchteil. Schon die kleinste Unaufmerksamkeit lässt eine Welle aus dem Unterbewusstsein hochschlagen.
Sein Kommentar liest sich wie eine Mahnung zur Wachsamkeit: Der Yogi solle „keine Pause zwischen die aufmerksame Unterscheidung kommen lassen, nicht einmal eine winzige“ – andernfalls könnten die vasanas (ein Synonym für Samskaras) einem ein Schnippchen schlagen. Hier klingt also ein leicht anderer Ton mit: weniger Gelassenheit, mehr Warnung, ja nicht nachlässig zu werden.
Bhoja (11. Jh.), der gelehrte König, kommentiert das Yogasutra in seinem Werk Rājamārtaṇḍa ebenfalls. Er folgt inhaltlich weitgehend Vyāsas Linie, liefert aber wunderschöne Analogien, um den Prozess zu veranschaulichen. Eine davon haben wir schon erwähnt: der Vergleich der Saṁskāras mit gerösteten Samen im Feld. Bhoja erläutert, dass die Residuen vergangener Handlungen zwar noch vorhanden seien, aber vom Feuer der Erkenntnis so versengt wurden, dass sie – wie geröstete Samen – nicht mehr aufgehen können. Sollte doch ein Same keimen (sprich: ein Eindruck als störender Gedanke aufblitzen), dann hat der Yogi ihn sofort als das erkannt, was er ist – ein Überrest, der keine Frucht mehr tragen wird. In Bhojas Bildsprache gleicht der Geist am Ende dem durchpflügten Feld: Das Unkraut wurde schon entfernt, aber man geht noch einmal drüber, um sicherzustellen, dass auch die letzten Körnchen im Boden keine neuen Sprosse mehr hervorbringen. Diese agrarische Metapher macht klar: Die Substanz der Eindrücke mag noch vorhanden sein, doch ihre Wirkmacht ist bereits gebrochen. Es bleibt dem Yogi überlassen, mit Achtsamkeit und beständigem „Jäten“ die völlige Klarheit zu sichern.
Man könnte es auch so sehen, dass die im nirbīja-samādhi (samadhi ohne Samen) verbliebenen Saṁskāras eigentlich keine neuen karmischen Folgen mehr erzeugen – sie sind also quasi „wirkungslos“ –, aber sie manifestieren sich dennoch als flüchtige Gedanken. Man könnte sagen: Es sind Phantom-Gedanken, die kein neues Leid mehr schaffen, den Yogi aber auf die Probe stellen, ob er wirklich jeden Hauch von Anhaftung überwunden hat. In manchen Kommentaren klingt durch, dass diese letzten Eindrücke sehr subtil und rein sind; manchmal interpretiert man sie sogar als spirituelle Eindrücke, etwa die Restbegeisterung für das Yoga selbst. Solche feinen Ego-Regungen – „Ich bin jetzt so weise“ – könnten ebenfalls als störende Prägungen gelten, die noch abgelegt werden müssen. Daher ist die gleiche Entwurzelung nötig wie bei gröberen Hindernissen. Kein Ego, keine Eindrücke: Ist der letzte Asmita-(Ichhaftigkeits)-Funke erloschen, erlischt mit ihm auch das letzte Aufflackern der Samskaras.
Neben diesen indischen Kommentatoren aus dem Sanskrit-Raum gab es auch in anderen Kulturen Rezeptionen. Der persisch-arabische Gelehrte Al-Bīrūnī etwa übersetzte im 11. Jahrhundert die Yogasutra ins Arabische und versah sie mit Erläuterungen. Zwar liegen nicht alle Details seiner Kommentare vor, doch ist überliefert, dass er die Rolle der latenten Eindrücke ebenfalls hervorhob. Er erklärte Patanjalis Lehre seinen muslimischen Lesern sinngemäß so, dass der Yogi selbst nach dem Abstreifen aller äußeren Laster noch die inneren Neigungen („die Spuren in der Seele von früheren Handlungen“) überwinden müsse. Damit schlug Al-Bīrūnī eine Brücke zur sufischen Idee, das Herz vollkommen zu reinigen.
Über alle Sprach- und Kulturgrenzen hinweg erkennen die Kommentatoren denselben Kern: Alte Eindrücke sind zähe Begleiter auf dem spirituellen Pfad – doch sie lassen sich durch Wissen und Übung unschädlich machen.
Moderne Deutungen und wissenschaftliche Perspektiven
Heutige Yoga-Lehrende und Autoren greifen Sutra 4.27 oft auf, um Praktizierenden Mut zu machen. So betont z. B. Swami Satchidananda in seinem Kommentar, man solle nicht verzagen, wenn während der Meditation plötzlich Gedanken auftauchen: Das sei normal und ein Zeichen, dass der Prozess der inneren Reinigung im Gange ist. Diese Gedanken stammen aus den Saṁskāras – „Memories come... sometimes even when we do not want them“, wie er schreibt – und Meditation bringe sie eben an die Oberfläche, wo man sie loslassen kann. Satchidananda warnt aber auch augenzwinkernd davor, diese Eindrücke unterschätzen: „Denke nicht, dass du jemals etwas wirklich vergessen würdest. Alle Erfahrungen sind im citta gespeichert…“. Mit anderen Worten: Der Datenschatz des Unterbewusstseins ist enorm; Meditation ist der Weg, diese Archive zu durchforsten und zu bereinigen.
Auch moderne Lehrer wie B.K.S. Iyengar oder T.K.V. Desikachar haben Sutra 4.27 in praxisnahe Ratschläge übersetzt. Iyengar interpretierte die Sutra etwa so, dass in den höchsten Stufen von dhyāna (Versenkung) immer noch „unterbewusste Samen vergangener Handlungen“ aufsteigen mögen. Er riet, diese mit freundlicher Gelassenheit zu beobachten – quasi wie Wolken, die vorüberziehen –, und sich nicht mit ihnen zu identifizieren. In seinem berühmten Werk Licht auf die Yogasutras betont Iyengar, dass solche Momente der Ablenkung eigentlich Gelegenheiten sind: Sie machen uns bewusst, was noch unaufgelöst ist. Jeder aufsteigende Samskara gibt die Chance, ihn zu erkennen und endgültig aufzulösen. Desikachar schrieb ähnlich, dass man diese „Lückenfüller-Gedanken“ willkommen heißen solle, denn sie zeigen ehrlich den Fortschrittsstand: Wo noch ein Eindruck hochkommt, da ist noch Arbeit zu tun.
Spannend ist, dass auch westliche Wissenschaftler Parallelen ziehen. Die Kognitionswissenschaft betrachtet etwa das Phänomen des Mind-Wandering – des umherschweifenden Geistes – als etwas, das aus gespeicherten Eindrücken gespeist wird. Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass das Gehirn in Ruhe automatisch in persönliche Erinnerungen, Zukunftspläne etc. abschweift. Das Default Mode Network knüpft quasi ständig Geschichten aus unserem Leben zusammen, sobald wir nicht mit einer Aufgabe beschäftigt sind.
Meditation zielt darauf ab, genau diese automatische Aktivität herunterzufahren. Und tatsächlich: Hirnstudien an Meditierenden zeigen eine geringere Aktivität dieses Netzwerks, was mit weniger spontanen Gedanken und mehr Gegenwärtigkeit einhergeht. Einfach gesagt: Wo Patanjali von reduzierten Samskaras spricht, messen Neurologen reduzierte Standardnetz-Aktivität. Beide meinen in gewisser Betrachtunsweise dasselbe: ein Geist, der nicht mehr dauernd in alten Eindrücken schwelgt, sondern frei von „Gedankenlärm“ ist. Kognitionsforscher Reddy & Roy (2018) beispielsweise entwickelten ein Modell der Meditation als Prozess der „Geräuschreduktion“ im Geist – ausdrücklich inspiriert von Patanjalis Konzept der Samskaras. Sie sehen verschiedene Meditationsformen als Werkzeuge, unterschiedliche Arten von „geistigem Rauschen“ (Gedanken, Emotionen etc.) zu verringern, bis ein rauschfreier Urzustand erreicht ist. Das entspricht eventuell Patanjalis Versprechen am Ende des Yogaweges.
Darüber hinaus lassen sich Brücken zur Psychologie schlagen. Das Konzept der Saṁskāras erinnert an Freuds Unbewusstes oder Jungs „Komplexe“, die aus vergangenen Erlebnissen gespeist das aktuelle Verhalten beeinflussen. Moderne Therapeuten betonen: Unverarbeitete Erfahrungen tauchen früher oder später wieder auf – sei es in Träumen oder in Trigger-Momenten im Alltag. Die Praxis der Achtsamkeit und Meditation wird heute denn auch therapeutisch eingesetzt, um Menschen zu helfen, verborgene innere Muster zu erkennen und aufzulösen.
Neuere Forschungen zur Neuroplastizität zeigen, dass ausdauernde Meditationspraxis bei vielen Probanden die Vernetzungen im Gehirn nachhaltig verändern kann – weg von den Pfaden der Grübelei, hin zu neuen, klareren Bahnen. Das entspricht dem Yogaprinzip: Die alten Saṁskāra-Spuren werden durch die Praxis der Meditation aufgelöst. Patanjali erwähnt nämlich auch, dass die Erfahrung der Wahrheit (ṛtaṁbhara prajñā) einen eigenen Eindruck im Geist hinterlässt, der alle anderen überlagert und schließlich ebenfalls zum Stillstand kommt (vgl. YS 1.50). Mit etwas moderner Sprache könnte man sagen: Positive Neuroplastizität durch Meditation löscht negative Konditionierungen – bis keine Konditionierung mehr übrig ist, nur noch ungefiltertes Gewahrsein.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-27
Rainbowbody: Verständnis und Praxis im Umgang mit Samskaras
Ein Yogi – so erinnert uns Rainbowbody – muss immer dort beginnen, wo er tatsächlich steht. Nicht in der idealisierten Zukunft, nicht im Wunschbild eines „fortgeschrittenen Zustands“, sondern im ehrlichen Kontakt mit der gegenwärtigen Erfahrung. Es ist verführerisch, an dem Punkt anfangen zu wollen, an dem man „eigentlich schon sein möchte“. Doch spirituelle Reifung entsteht nur, wenn man die Realität des eigenen Geistes akzeptiert – mit all ihren Prägungen, Gewohnheiten und Schatten.
Das heißt konkret: Die Samskaras, also die gespeicherten Eindrücke und Muster im Geist, dürfen nicht verdrängt oder bekämpft werden. Sie sollen bewusst erkannt und angenommen werden. Erst dieses Anerkennen macht Transformation möglich. Wenn du die aufsteigenden Inhalte deines Geistes mit Gewahrsein betrachtest, ohne sie zu verurteilen, beginnst du, sie wirklich zu verstehen – und damit verlieren sie ihre Macht. So wird der Übende furchtlos: Er flieht nicht mehr vor den „samsarischen Gewohnheiten“, sondern schaut ihnen direkt ins Gesicht.
Durch eine konsequente und klare Praxis lösen sich mit der Zeit die verbliebenen Samskaras – also die alten Prägungen – auf. Das geschieht nicht durch Gewalt oder Verdrängung, sondern durch stetige Präsenz und Selbstbewusstheit.
In einem weiterführenden Abschnitt betont Rainbowbody: Die Aufgabe des Yogis ist es, den Inhalt des Geistes zu leeren und zu reinigen, indem er sich im reinen Bewusstsein selbst verankert. Zuerst geschieht das durch Selbsterkenntnis, dann durch die stille Erfahrung des reinen Gewahrseins. Wenn dieses Gewahrsein stabil geworden ist, verliert sogar Viveka, die unterscheidende Weisheit, ihren Zweck – denn sie war ein Werkzeug, um die Störungen von Samskaras, Kleshas, Unwissenheit, Karma und Vasanas zu beseitigen. Ist das Werk getan, wird selbst das Werkzeug hingelegt.
So beschreibt Rainbowbody einen Weg, der von bewusster Auseinandersetzung über Läuterung bis hin zu einem Zustand jenseits aller Praxis führt – einem Sein, das frei ist von den Mustern, die einst das Bewusstsein trübten.
In der Meditation
Setz dich hin, atme, vielleicht spürst du sogar diese herrliche Klarheit: dein Geist still, wie ein See bei Sonnenaufgang. Und dann – zack – springt plötzlich ein alter Gedanke herein. Vielleicht der Ärger über die Kollegin, vielleicht die Erinnerung an den Schokokuchen von gestern. Genau das ist 4.27 in Aktion: Die Unterscheidungskraft macht kurz Pause, und die alten Speicher rufen laut „Hallo, ich bin auch noch da!“.
Wie übst du das?
- Nicht erschrecken. Du sitzt nicht falsch, du meditierst nicht schlecht. Das Auftauchen ist Teil des Spiels.
- Schau hin, ohne zu füttern. Der Gedanke wird, wenn du dich nicht von ihm vereinnahmen lässt, wieder vergehen.
- Spüre die Lücke. Erkenne: Da war Klarheit, dann kam eine Unterbrechung, und jetzt bist du wieder im Bewusstsein davon. Schon dieses Sehen ist Praxis.
Ein Bild zum Mitnehmen
Stell dir den Geist vor wie einen Fluss, der schon fast frei von Schmutz ist. Aber am Rand schwimmen noch ein paar alte Äste. Ab und zu wird einer in die Mitte gespült. Du musst ihn nicht packen oder bekämpfen. Beobachte ihn, bis er von selbst weitergetragen wird.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Im Alltag
- Beispiel 1: Streit. Du hast dir vorgenommen, gelassen zu bleiben. Alles läuft gut – bis jemand im Auto schneidet. Alte Muster: Ärger, vielleicht ein Fluch. Genau da kannst du üben: Aha, da war die Lücke, die Samskaras haben übernommen. Atme, erkenne es, und wenn’s geht, lass die Hand nicht gleich zur Hupe schnellen.
- Beispiel 2: Gewohnheiten. Du willst eigentlich abends nicht mehr ins Handy starren. Du hast klar unterschieden: Das tut dir nicht gut. Aber dann sitzt du doch da, der Daumen wischt. In diesem Moment spürst du Sutra 4.27 direkt: Die Unterscheidungskraft war kurz weg, der alte Impuls stärker. Üben heißt: Den Moment erkennen, nicht in Selbstkritik versinken, sondern die Hand wieder sinken lassen.
- Beispiel 3: Lob und Anerkennung. Du weißt, dass dein Wert nicht von anderen abhängt. Aber wenn dich jemand kritisiert, merkst du, wie die Stimme im Kopf loslegt. Genau da kannst du beobachten: Aha, alte Prägung meldet sich, aber ich muss ihr nicht folgen.
Versuche zudem diese Woche wieder einmal deinen Samskaras, deinen unbewussten Prägungen/Neigungen/Wünschen auf die Schliche zu kommen. Am besten führst du eine Liste in deinem spirituellen Tagebuch.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.27
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyasa beschreibt eine subtile Erfahrung, die viele Übende kennen:
Selbst wenn der Geist sich bereits stark auf die Unterscheidungskraft richtet – also die klare Einsicht, dass Purusha (das reine Bewusstsein) etwas völlig anderes ist als die Welt der Objekte und Gedanken – tauchen in den Pausen dieser Klarheit immer wieder andere Gedanken auf.
Es sind Gedanken wie:
- „Ich bin.“
- „Das gehört mir.“
- „Ich weiß.“
Mit anderen Worten: die alten Bekannten – Ego, Besitzansprüche, das Gefühl von Kontrolle. Vyasa macht deutlich: Diese Einwürfe kommen nicht „aus dem Nichts“. Sie stammen aus Samskaras, den gespeicherten Eindrücken und Gewohnheiten aus der Vergangenheit.
Er fügt hinzu: Diese alten Samen sind zwar bereits im Begriff, zerstört zu werden – doch solange sie nicht restlos verglüht sind, können sie in den Zwischenräumen immer noch ins Bewusstsein rutschen.
Was bedeutet das praktisch?
Wenn du meditierst oder sehr klar bist, kennst du vielleicht dieses Gefühl: Für einen Moment siehst du alles so durchdringend, dass kein Zweifel bleibt. Dann – fast wie ein Reflex – huscht ein Gedanke hinein: „Ach, das mache ich gut.“ Oder: „Das sollte ich mir merken.“ Zack, schon ist das Ich wieder auf der Bühne.
Vyasa beschreibt damit keinen Fehler, sondern ein natürliches Stadium des Prozesses. Es ist so, als würdest du ein Feuer auslöschen. Auch wenn die Flamme erloschen scheint, glühen die Kohlen noch eine Weile. Und manchmal springt noch ein kleiner Funken hoch.
Drei Einsichten für die Praxis
-
Erwarte keine glatte Kurve. Selbst auf fortgeschrittener Stufe wird es Rückfälle geben. Alte Prägungen klopfen an die Tür – sie wollen Aufmerksamkeit.
-
Erkenne die Muster. „Ich bin“, „Das ist mein“, „Ich weiß“ – das sind klassische Signaturen des Ego. Wenn du sie bemerkst, kannst du sie leichter ziehen lassen.
-
Übe Gelassenheit. Statt dich über diese Rückfälle zu ärgern, erinnere dich: Sie sind ein Zeichen, dass die alten Samen bereits schwächer werden. Ein letztes Aufbäumen.
So macht Vyasa mit seinen Worten klar: Auch in der Nähe der Befreiung bleibt der Mensch ein Mensch. Samskaras sind zäh, aber nicht unbesiegbar. Die Übung ist, sie zu erkennen – und mit jedem Aufsteigen verliert ihre Macht ein wenig an Gewicht.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-50: Dieses neue Wissen aus Nirvichara Sampatti erzeugte neue Eindrücke im Unterbewusstsein, welche die ungünstigen bisherigen Samskaras ersetzen
Yoga Sutra III-55: Das Wissen der höchsten Unterscheidungskraft befähigt den Yogi, alle Dinge in Raum und Zeit gleichzeitig ganzheitlich in voller Transzendenz zu erfassen
Yoga Sutra III-56: Wenn der Geist so rein (Sattva) wird wie das wahre Selbst (Seele, Purusha), erreicht der Yogi Befreiung (Kaivalya, Vollendung im Yoga)

Fazit: Die letzte Herausforderung auf dem Weg zur Freiheit
Yogasutra 4.27 erinnert uns daran, dass der Weg zur völligen geistigen Stille zwar gradlinig beschrieben, aber in der gelebten Erfahrung von kleinen Rückschlägen und Verzögerungen begleitet ist. Diese Rückschläge sind keine echten Rückfälle, sondern eher Nachzügler: die letzten Nachwirkungen früherer Erfahrungen, die ins Bewusstsein drängen. Die alten Kommentare – von Vyāsa bis Bhoja – versichern uns, dass diese letzten Hindernisse nicht mehr gefährlich sind, wenn wir sie mit der Fackel des Unterscheidungswissens beleuchten. Die modernen Stimmen – von Swami Satchidananda bis zur Neuroforschung – geben Patanjali Recht und übersetzen seine Lehre in die heutige Sprache: Alte mentale Muster können uns auf dem Meditationskissen überraschen, doch mit Achtsamkeit und Übung verlieren sie ihre Macht.
Für uns als Yoga-Praktizierende, seien wir Lehrende oder Schüler, liegt in Sutra 4.27 eine doppelte Botschaft. Zum einen: Hab Geduld mit dir. Es ist normal, dass dich während der Meditation Gedanken einholen. Das bedeutet nicht, dass du etwas „falsch“ machst – im Gegenteil, es bedeutet, dass du tief genug gehst, damit sich dein Unterbewusstsein zeigen darf. Zum anderen: Bleib wach und zuversichtlich. Die Tatsache, dass Samskaras auftauchen, heißt auch, dass du sie transformieren kannst. Jeder auftauchende Gedanke kann zum Brennmaterial für das Feuer der Erkenntnis werden. Die klassischen Lehrer haben uns Werkzeuge gegeben (Meditation, Unterscheidung, Loslösung), und die modernen Wissenschaften liefern zusätzliche Bestätigung und Verständnis, warum diese Werkzeuge wirken.
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-27
Gedanken, Samskaras, Kleshas und ihre Überwindung – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 27 und 28
Länge: 4 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Lücken im Nirbija Samadhi – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.27
Länge: 11 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34
Länge: 95 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


