Tadā viveka-nimnaṁ kaivalya-prāg-bhāraṁ cittam
तदा विवेकनिम्नङ्कैवल्यप्राग्भारञ्चित्तम्
(Yoga-)Philosophie wirkt manchmal trocken, doch Patañjalis Yogasutra 4.26 bringt eine verblüffend praktische Pointe: Wenn der Geist einmal die Klarheit der Unterscheidung gefunden hat, kippt sein ganzes Gewicht in Richtung Befreiung – wie ein Stein, der auf eine Schräge geschoben wird und dort von der Schwerkraft nach unten gezogen wird.
Der folgende Artikel bündelt klassische Kommentare, moderne Stimmen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sutra 4.26 und zeigt, wie sich diese alte Weisheit im Alltag spüren lässt: in Meditation, im Umgang mit Ärger oder einfach im Warten an der Kasse.
Kurz zusammengefasst
- Unterscheidungskraft (Viveka): Das Sutra 4.26 betont die Fähigkeit, zwischen dem unveränderlichen Bewusstsein und den wechselnden Inhalten des Geistes zu unterscheiden. Diese Klarheit ist die unmittelbare Vorstufe zur Befreiung.
- Kaivalya (Befreiung): Ist der Geist einmal von Viveka durchdrungen, richtet er sich fast wie von selbst auf Kaivalya, die völlige Unabhängigkeit des Bewusstseins, aus.
- Klassische Kommentare: Vyāsa, Vācaspati Miśra und andere Ausleger beschreiben den Wandel des Geistes von schwerfälliger Sinneslust hin zu einer „Schwere der Freiheit“.
- Moderne Deutungen: Zeitgenössische Lehrer wie Iyengar und Feuerstein verbinden den klassischen Kern mit praktischer Anwendung, während neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Meditation tatsächlich die Selbstzentrierung des Gehirns reduziert.
- Übersetzungsvarianten: Unterschiede in den Übersetzungen liegen vor allem in der Betonung – mal mehr auf „Unterscheidungstiefe“, mal mehr auf „absolute Befreiung“. Der Kern bleibt: Klarheit tendiert zur Freiheit.
- Praxis: Meditation und Alltagspraxis laden dazu ein, Gedanken und Projektionen von Tatsachen zu trennen. So lässt sich Viveka nicht nur auf dem Kissen, sondern auch an der Supermarktkasse üben.
- Vyāsa-Kommentar: Der Geist „kippt“ förmlich – was vorher Last war, wird irrelevant, was vorher mühsam schien, wird zur natürlichen Bewegung hin zur Freiheit.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Tada, tadâ = dann; in der Tat;
- Hi = wahrlich;
- Viveka = Unterscheidungskraft; Unterscheidung; unterscheidendes Gewahrsein; Unterscheidungsfähigkeit (zwischen Wirklichkeit und Schein); Scharfblick; Erkenntnis;
- Nimnam, Nimna = geneigt (hin) zu; vertieft; sich hinneigend; Tiefe; Verneigung; Neigung; Hinneigung; Neigung zu; Vertiefung; tendieren;
- Viveka-nimnam = geneigt zur Unterscheidung;
- Kaivalya = Befreiung; Auflösung des Ego hin zu Sat (Sein) Chit (Wissen bzw. Bewusstsein) Ananda (Wonne); Freiheit; Alleinsein; All-Eins-Sein;
- Prak, prāk = Richtung; Neigung;
- Bhara, bhāra = Gewicht; Masse;
- Kaivalya-Pragbharam, kaivalya-prâgbhâram = der Befreiung zustrebend;
- Chitta, chittam, citta = Verstand; Geist; Raum der Wahrnehmung; Bewusstheit; Bewusstsein;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Im vierten Kapitel des Yogasutra, dem Kaivalya-Pada, beschreibt Patañjali die Natur und die Ursachen von übernatürlichen Kräften (siddhis) und geistigen Transformationen. Diese Kräfte entstehen zwar durch Praxis, Asketentum oder Geburt, doch machen sie den Yogi noch nicht frei. Entscheidend bleibt die Unterscheidungskraft (viveka) zwischen dem Ewigen (Purusha) und dem Vergänglichen (Prakriti). Patañjali betont, dass karmische Prägungen auch nach Verwirklichung noch wirken können, doch durch Klarheit und Nicht-Anhaftung schwinden sie. Die Sutras führen Schritt für Schritt von der Erklärung geistiger Prozesse hin zur Betonung der Befreiung als Ziel, nicht der Macht.
Bis zu Sutra 4.26 steigert sich der Text zu einer klaren Pointe: Sobald der Geist durchdrungen ist von Viveka, richtet er sich natürlicherweise auf die Befreiung (Kaivalya) aus. Dieser Prozess wird als fast zwangsläufig beschrieben – wie eine natürliche Schwerkraft hin zum Wesentlichen. Der Yogi erkennt, dass alle Phänomene des Geistes vergänglich sind und nur das reine Bewusstsein unveränderlich bleibt. So kommt das Kapitel an einen Wendepunkt: von der Analyse der Kräfte und Illusionen hin zur endgültigen Ausrichtung des Geistes auf Befreiung.
Übersichtstabelle
| Abschnitt (Sutren) | Hauptthema | Kernaussage |
|---|---|---|
| 4.1–4.3 | Entstehung von Kräften | Übernatürliche Kräfte entstehen durch Geburt, Pflanzen, Mantras, Askese oder Meditation – sie sind jedoch nicht das Ziel, sondern Nebenprodukte. |
| 4.4–4.6 | Vielfalt des Geistes | Der Geist kann sich vervielfältigen und unterschiedliche Formen annehmen, bleibt aber Ausdruck derselben inneren Struktur; moralische Qualität bestimmt seine Richtung. |
| 4.7–4.11 | Karma und Eindrücke | Handlungen hinterlassen Spuren; selbst subtile Eindrücke wirken weiter, bis sie durch Erkenntnis und Auflösung des Begehrens erlöschen. |
| 4.12–4.15 | Zeit, Objekte und Wahrnehmung | Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren als Potenzial; Objekte erscheinen unterschiedlich je nach Wahrnehmung des Geistes. |
| 4.16–4.23 | Beobachter und Beobachtetes | Der Geist wird durch Purusha erleuchtet, verwechselt sich aber oft mit ihm; wahre Unterscheidung zeigt, dass Purusha und Citta getrennt sind. |
| 4.24–4.26 | Unterscheidung und Befreiung | Wenn der Geist klar unterscheidet, richtet er sich von selbst auf Befreiung aus – dies ist die unmittelbare Vorbereitung auf Kaivalya. |
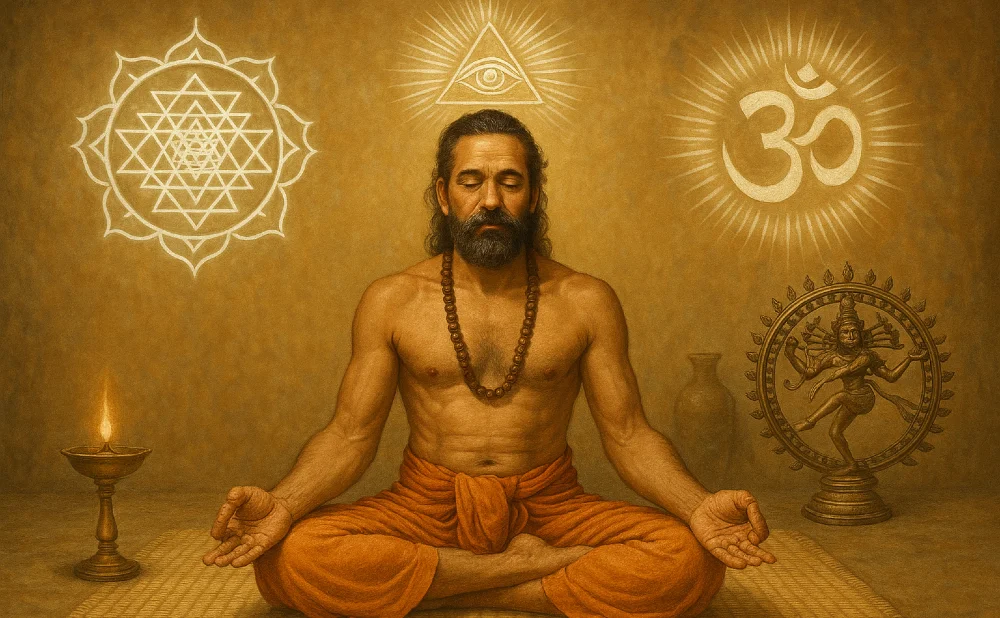
Yogasutra 4.26 – Unterscheidungskraft und Befreiung
Patañjali fasst in Sutra 4.26 den Zustand zusammen, der eintritt, wenn der Geist durch klare Unterscheidung durchdrungen ist. Wörtlich lautet der Sanskrit: tadā viveka-nimnaṃ kaivalya-prāgbhāraṃ cittaṃ. Sinngemäß heißt das etwa: „Dann richtet der Geist sich auf Unterscheidung aus und zieht (von selbst) zur Befreiung hin“ (Übersetzungsbeispiel). Anders formuliert: Sobald du den Unterschied zwischen dem reinen Selbst (Purusha) und den wechselnden Inhalten des Geistes erkennst, orientiert sich dein ganzes Bewusstsein naturgemäß auf Kaivalya – die (letztlich unantastbare) Befreiung. Diese Richtung des Geistes wird in manchen Übersetzungen als “Unterscheidungstiefe” beschrieben: Der Geist trägt dann förmlich eine neue, tiefe Qualität der Unterscheidungskraft in sich und steht unmittelbar vor dem Sprung in die Befreiung.
Übersetzungsvarianten
Die verschiedenen Übersetzungen dieser Sutra fassen sie je nach Schwerpunkt etwas anders. Eine wörtliche Fassung von Mitra etwa lautet: „Der Geist neigt sich der Unterscheidung zu und zieht zur absoluten Befreiung hin.” Eine andere Übersetzung spricht im Deutschen von „Unterscheidungstiefe“, betont also den erreichten Grad an Klarheit. Wieder andere heben Kaivalya hervor und sagen z. B. „absolute Befreiung zwischen Sehendem und Gesehenem“, um anzudeuten, dass die Befreiung gerade durch das Erkennen der Seher/Wahrnehmung-Dualität geschieht.
Trotz dieser Unterschiede läuft alles auf dasselbe hinaus: Viveka-khyāti (unerschütterliche Unterscheidungserkenntnis) führt zwangsläufig in Kaivalya (Befreiung). Ob man viveka-nimnam nun als „Vogel auf dem Scheitel“ interpretiert (der stets zur Unterscheidung fliegt) oder als „Mind inclined to discrimination“ – der Wille, die Wahrheit zu erkennen, und die Freiheit sind in Patanjalis Sicht untrennbar verbunden.
Schlüsselbegriffe
- Mit Viveka ist hier die Fähigkeit zur unerschütterlichen Unterscheidung gemeint. Im Yoga-Kontext ist das die subtile Einsicht, das Ewige (Purusha) vom Vergänglichen (Prakriti) zu trennen.
- Kaivalya heißt so viel wie Isolation oder Alleinsein des reinen Bewusstseins – ein Zustand völliger Freiheit jenseits aller Illusion.
- Citta meint den Gedanken-Geist oder das Bewusstsein selbst.
- Nimnam wird oft als „geneigt sein“ oder „geborstig“ übersetzt – hier also: Der Geist “neigt sich” dem Viveka zu.
Man kann sich das bildlich vorstellen: Der Geist war bisher schwer belastet durch Sinneseindrücke und Verstrickungen, doch nun wird er plötzlich “schwer mit Unabhängigkeit” (Vyāsa) – er wendet sich um und zieht dadurch naturgemäß in Richtung Befreiung. Kaivalya. Schauen wir uns diesen Begriff näher an.
Kaivalya
Sutra II-25 definiert Patanjali, was er mit Kaivalya meint:
Yoga Sutra II-25: Wenn die Unwissenheit (Avidya) endet, löst sich die Verbindung (Samyoga) mit der äußeren Welt auf – dadurch erlangt der Sehende absolute Freiheit (Kaivalya)
Der Sanskrit-Begriff Kaivalya steht für Erleuchtung und Freiheit und ist das letztendliche Ziel im Raja Yoga.
Vom Wortstamm her ist Kaivalya eine Vrddhi-Ableitung von kevala mit der Bedeutung selbstbezogen, allein, isoliert. Kaivalya wird auch mit Einsamkeit, Absonderung, Abgehobenheit, Losgelöstheit oder Isolation übersetzt.
In englischen Übersetzungen liest man oft “isolation” oder “aloneness” für Kaivalya, was irritierend und negativ klingt. Soll so die yogische Freiheit aussehen: allein und isoliert?
Warum “isolation”? Isolation kann auch als Abtrennung übersetzt werden. Wir haben in den Sutras zuvor gelesen: Gemäß der Yogalehre hat die gesamte Schöpfung (Prakriti) den alleinigen Zweck, damit wir Erfahrungen machen, damit wir den Kontext zu unserem Selbstverständnis erhalten (unser wahres Selbst zu erfahren) und schließlich als Trittbrett zur Befreiung zu dienen. Kaivalya wird dann als Absonderung des Purusha (Wahres Selbst, Seele) von Prakriti (Natur) verstanden. Wer dies erreicht, befindet sich permanent im Samadhi und ist vom Kreislauf der Wiedergeburten befreit. Die materielle Welt, Prakriti, wird dann so gesehen und erfahren, wie sie wirklich ist.
Ein Jivanmukti ist jemand, der diese Befreiung zu Lebzeiten erreicht hat. Sie/er ist dann noch in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt.
Weitere Sutras zu Kaivalya:
Yoga Sutra I-22: Der Wunsch/Wille/die Praxis kann schwach, mittelmäßig oder intensiv sein
Yoga Sutra II-25: Wenn die Unwissenheit (Avidya) endet, löst sich die Verbindung (Samyoga) mit der äußeren Welt auf – dadurch erlangt der Sehende absolute Freiheit (Kaivalya)
Yoga Sutra III-51: Wenn ein Yogi auch an diese (Allmacht, Allwissenheit …) nicht anhaftet wird der letzte Samen des Bösen zerstört und vollständige Befreiung (Kaivalya) erlangt
Yoga Sutra III-56: Wenn der Geist so rein (Sattva) wird wie das wahre Selbst (Seele, Purusha), erreicht der Yogi Befreiung (Kaivalya, Vollendung im Yoga)
Yoga Sutra IV-31: Mit den Ende aller Verschleierungen und Unreinheiten erlangt der Yogi unendliche Erkenntnis und alles bisher – als normaler Mensch – Gewusste wird als winzig und unbedeutend erkannt
Yoga Sutra IV-33: Krama, das Kontinuum bzw. die Abfolge von Momenten und die damit verbundene Transformation, wird vom Yogi erkannt, wenn die Wandlungen der Gunas enden
Yoga Sutra IV-34: Das Ziel des Purushas, unseres wahren Selbstes, ist das Aufgehen der Gunas in die Prakriti, der Urnatur, und seine Rückkehr zu Kaivalya, der absoluten Freiheit. Purusha, ruht dann in seiner wahren Natur. Hier endet die Yogalehre – iti.
Viveka - Unterscheidungskraft
Viveka wird meist mit Unterscheidungskraft, manchmal auch mit Urteilskraft (englisch: discrimination) übersetzt. Viveka setzt sich aus den Wortstämmen der Vorsilbe vi (Bedeutung: ohne, nicht, wider) und veka (abgeleitet vom der Wurzel vic (विच्) mit der Bedeutung: urteilen, trennen, abtrennen) zusammen.
Was soll unterschieden werden? In der Regel wird darunter verstanden, zwischen
- Ewigem und Vergänglichem,
- Wirklichkeit und Unwirklichkeit,
- Wirklichkeit und Illusion,
- Selbst und Nicht-Selbst (Atman und Anatman)
- auf Begierden gründendem Vergnügen (Kama) und Wonne oder Glückseligkeit (Ananda)
- Echtem (Unwandelbarem und Ewigem) und Unechtem (Wandelbarem und Zeitweiligem)
unterscheiden zu können. Beziehungsweise beides zu erkennen und die Dinge und Erlebnisse jeweils zuordnen zu lernen.
Das Betätigungsfeld von Viveka kann sehr weit ausgedehnt werden. Hierin fällt unter anderem das ganze Feld der Ego-Identifizierung. Im Yoga und anderen spirituellen Lehren ist es essenziell, dass du erkennst, dass du nicht deine wandelbare Persönlichkeit oder gar nur dein Körper bist.
Aber Viveka soll auch den Schleier der Maya durchbrechen, der Illusion der Wirklichkeit. Zum Beispiel, indem du bedenkst, dass die Welt da draußen nicht so ist, wie du diese über deine Sinnesorgane wahrnimmst und in deinem Gehirn zusammensetzt. Das ist alles nur ein Konstrukt der Wirklichkeit. Und dann ist da vom Yoga-Aspiranten noch zu erkennen, was förderlich für die Erreichung von Kaivalya ist und wo man lieber einen großen Bogen drum macht bzw. was man tunlichst unterlassen sollte.
In der Yogaphilosophie gibt es vier geistige Praktiken (Sadhana Chatushtayas), die zur Erreichung von Kaivalya geübt werden sollten:
- Hier besprochenes Viveka
- Vairagya (Verhaftungslosigkeit, nichts begehren, nichts ablehnen),
- Shatsampad [Die sechs Errungenschaften: Shama (Gleichmut), Dama (Kontrolle der Sinne), Uparati (das Zurückziehen der Sinne), Titiksha (Duldungskraft), Shraddha (Glaube), Samadhana (geistige Ruhe)] und
- Mumukshutva (das Verlangen nach Befreiung, der letzte Wunsch, der alle anderen Wünsche ersetzt, der aber am Ende auch aufgegeben werden muss, um Kaivalya zu erreichen)
Auf der Seite von Rainbowbody lesen wir von einem etwas anderen Viveka-Verständnis. Dort steht: „Das Wort Viveka wird oft missverstanden, weil es im authentischen Yoga ganz anders verwendet wird als im Samkhya-Kontext, da es ein Zustand des Gewahrseins/der Weisheit ist, der die begriffliche und intellektuelle Analyse besiegt hat, nicht einer, der von solchen beherrscht wird. Im Samkhya wird das Wort Viveka am häufigsten als unterscheidendes Gewahrsein in einem dualistischen Kontext übersetzt, z. B. bei der Unterscheidung zwischen dem Realen und dem Unrealen …”
Kaivalya-Pragbharam – der Befreiung zugeneigt
Wer die von Patanjali so oft hervorgehobene Kraft der Unterscheidung trainiert und diese sich immer mehr aneignet, dessen Geist neigt sich Kaivalya, der Erleuchtung, Freiheit, entgegen.
Das klingt einleuchtend. Wenn ich durch intensive Selbstbeobachtung erkenne:
Ich bin nicht meine Gedanken und nicht meine Gefühle!
Dann beginne ich eher damit, zu schauen, was ich denn stattdessen bin. Schon bin ich Kaivalya entgegen geneigt.
Unser Geist (Chitta) – Gegner oder Diener?
Sukadev sagt bei der Besprechung dieser Sutra, irgendwann werde man bei der Selbsterforschung erkennen: “... dass Chitta selbst dir zur vollen Befreiung verhehlen will … Chitta will dich gar nicht binden … Chitta neigt zur Unterscheidungskraft, zur Befreiung.” Dann könne man aufhören, gegen den eigenen Geist zu kämpfen, und ihn stattdessen geschickt auf dem Weg zur Erleuchtung einsetzen.
Ähnlich äußert sich Iyengar, wenn er schreibt, dass unser Bewusstsein „hell“ wird, wenn „die erhabene Intelligenz aufleuchtet“. Dieses Licht zieht Citta wie ein Magnet zum Ursprung, zum „Seher“. Vorher würde das Bewusstsein eher den „Freuden der Welt“ zugeneigt sein.
Govindan schreibt, dass, wenn nur noch „ein ganz dünner Schleier der Unwissenheit“ zwischen Wahrem Selbst und Nicht-Selbst verbleibe, der Prozess von Viveka, dem Unterscheiden, nahezu automatisch in Richtung höchstem Samadhi beim Yogin voranschreite.
Klassische Kommentare
Schon Vyāsa, Patañjalis Hauptkommentator, erläutert 4.26 mit einem starken Bild: Zuvor war der Geist „schwer von sinnlichem Genuss“ und neigte ins Dunkel der Unwissenheit; nach der Unterscheidungskundigkeit kehrt sich dies um. „Er ist nun schwer mit Unabhängigkeit und strebt nach unterscheidendem Wissen“. Anders gesagt: Nachdem du die wirkliche Substanz erkannt hast, fällt die falsche Ego-Schwere ab und eine neue Gewichtung tritt ein – das Bewusstsein richtet sich voll auf die Befreiung aus. Mehr zu Vyasas Auslegung unten.
Vācaspati Miśra, ein anderer klassischer Kommentator, schreibt zur Sutra knapp: „Der Geist ist dann hin geneigt zur Unterscheidung und zieht zur absoluten Unabhängigkeit hin“. Beide Kommentatoren bestätigen also denselben Kern: Unterscheidungskraft und Unabhängigkeit (Kaivalya) gehen Hand in Hand.
(Bhoja, König und Gelehrter des 11. Jahrhunderts, kommentiert zwar die angrenzenden Sutras intensiv, seine Überlieferung in 4.26 ist aber umstritten. In den klassischen Quellen dominieren daher vor allem Vyāsa und Vācaspati.)
Moderne Auslegungen und Gedanken
Moderne Yogameister und Philosophen knüpfen oft an diese klassische Deutung an, würzen sie aber mit zeitgenössischem Flair. So spricht etwa der Mystiker Osho metaphorisch vom Strom der Erkenntnis: Sobald der Suchende „einmal in den Strom gefallen“ sei, werde er “zum Ozean getragen” – er müsse nichts weiter tun, das pure Bewusstsein führe ihn automatisch zum Ziel. Dieses Bild betont denselben Gedanken wie Patañjali: Ist die Unterscheidungskraft erlangt (man ist „im Fluss“), führt der weitere Weg fast wie von selbst zur Befreiung.
Auch neuere Übersetzer verstehen viveka-nimnam oft sehr dynamisch. So liest ein zeitgenössischer Kommentar: „Dann neigt der Geist zur höchsten Unterscheidungskraft und strebt nach absoluter Befreiung zwischen dem Sehenden und dem Gesehenen.” Hier wird das „Gravitieren” besonders hervorgehoben: Der Geist „schwebt“ sozusagen in Richtung Befreiung.
Diese Formulierung erinnert an moderne Erklärungen aus der Bewusstseinsforschung: Wenn Ego-Programme des Gehirns schwächer werden, richtet die Aufmerksamkeit sich automatisch mehr auf Klarheit aus. Studien zeigen, dass intensive Achtsamkeits- oder Meditationspraxis die Selbstbezüglichkeit des Geistes verringert (etwa durch Reduktion der Aktivität im so genannten Default-Mode-Network) und gleichzeitig die präfrontale Entscheidungs- und Aufmerksamkeitskontrolle stärkt. Man könnte also sagen: Mit wachsendem Viveka verschiebt sich das „Gewicht“ im Gehirn – vom automatisch kreiselnden Ego hin zu klarer Beobachtung. In Anlehnung an Sutra 4.26 wirkt das dann wie eine sanfte Gravitation in die Befreiung: Je klarer die Unterscheidung, desto stärker ist der „Zug“ zum reinen Selbst.
Aus philosophischer Sicht ist 4.26 eine Bestätigung des Samkhya-Grundgedankens, dass Purusha (das reine Bewusstsein) und Prakriti (Materie/Gedanken) grundsätzlich verschieden sind. Viveka ist hier eben das Erkennen dieses Unterschieds. Kaivalya ist in Samkhya wie oben besprochen die völlige Isolation des Purusha von den Gunas der Natur. Der Kommentator Bhāviveka (im Bhasya-Vivarana erläutert) beschreibt Kaivalya so: Das Selbst „erstrahlt von selbst, wird frei von allen Unreinheiten und isoliert sich“. Dies unterstreicht, dass Kaivalya kein Hinzukommen von etwas Neuem ist, sondern der vollständige Wegfall aller Verblendung – genau jenseits dessen, was Viveka erschließt. Der entscheidende Punkt bleibt also die Erkenntnis (samyagdarśana): Wie es heißt, genügt manchmal ein einziger Durchblick (eine unerschütterliche Unterscheidung), um alle Kleshas (Verblendungen) zu durchschauen und Kaivalya zu erfahren.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-26
Wenn du Yogasutra 4.26 wirklich üben willst, dann geht es weniger darum, die Worte im Kopf hin und her zu wälzen, sondern die Richtung deines Geistes in der Praxis zu spüren. „Der Geist neigt sich zur Unterscheidung und strebt zur Befreiung“ – das klingt hochtrabend. Aber in Meditation und Alltag kannst du es ganz konkret erfahren.
In der Meditation
Setz dich hin, atme, lass den Alltag erstmal aus der Hand fallen. Dann beginne bewusst zu unterscheiden: Was ist gerade wirklich da – Atem, Körper, Geräusch im Hintergrund – und was ist nur eine Geschichte, die dein Geist dazu spinnt? Wenn du merkst: „Ah, dieser Gedanke erzählt mir, ich sei unruhig“, dann hast du schon den Unterschied erkannt. Gedanken sind Inhalte. Du bist der Beobachter. Genau das meint viveka: unterscheiden lernen zwischen der fließenden Oberfläche und dem stillen Grund.
Ein Beispiel: Stell dir vor, dein Kopf hämmert, weil du dich in einer Diskussion verrannt hast. In der Meditation taucht diese Szene wieder auf. Anstatt sie nachzuspielen, sag dir innerlich: „Das ist nur Erinnerung, kein Fakt im Jetzt.“ Schon neigt sich dein Geist zur Unterscheidung. Diese feine, kleine Wende – das ist die Spur Richtung Freiheit.
Kannst du vielleicht sogar erkennen, dass und wie dein Geist zum Erkennen deines "Wahren Selbst" beitragen will?
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Im Alltag
Die Übung endet nicht auf dem Kissen. Im Alltag wird’s erst spannend. Hier wieder die typischen Übungen: Du stehst an der Supermarktkasse, jemand drängelt sich vor. Sofort will dein Geist urteilen: „Unverschämt!“ Hier kannst du 4.26 üben: Spür den Impuls, atme, und frag dich: Was ist Tatsache? Jemand steht vor dir. Was ist Projektion? Dein Ärger, deine Geschichte über Respekt. Wenn du diesen Unterschied klar siehst, hat dein Geist sich schon in Richtung Freiheit bewegt. Du bist nicht mehr nur Sklave deiner automatischen Reaktionen.
Noch ein Beispiel: Beim Yogaunterricht korrigiert dich jemand. Dein Ego will vielleicht sofort sagen: „Das stimmt doch gar nicht.“ Hier wieder die Gelegenheit: Unterschied zwischen Beobachtung (jemand spricht) und Interpretation („Ich bin schlecht“). Bleib bei der Tatsache, löse die Geschichte. Diese Momente sind kleine Freiheitsübungen im Alltag.
Manchmal fühlt sich das Ganze nicht heroisch an, sondern fast banal. Aber genau so ist es: Freiheit beginnt mit dem unscheinbaren, aber wiederholten Akt des Erkennens. Bis dieser Akt wie von selbst geschieht. Wie ein Stein, der auf einer Schräge ins Rollen kommt.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.26 – über den Wandel des Geistes
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyāsa beschreibt in seinem Kommentar zu Yogasutra 4.26 einen bemerkenswerten Umschwung:
„Der Verstand, der zuvor schwer beladen war von sinnlichen Genüssen und geneigt zur Unwissenheit, wendet sich nun in die entgegengesetzte Richtung. Er wird schwer von Unabhängigkeit und neigt zum unterscheidenden Wissen.“
So klingt es in einer wörtlichen Übersetzung. Doch der Sinn erschließt sich leichter, wenn man die Worte etwas entfaltet:
-
Vorher: Der Geist war wie ein Gefäß, das von Begierden und Sinneslust überquoll. Schwer, träge, fast wie von einer unsichtbaren Schwerkraft nach unten gezogen. Dieses Gewicht zog ihn immer wieder in Richtung Täuschung und Verstrickung.
-
Jetzt: Mit wachsender Klarheit verändert sich die Schwerkraft. Der Geist trägt nun das Gewicht der Unabhängigkeit. Er ist – paradox, aber sehr plastisch – „schwer“ von Freiheit. Und genau dieses neue Gewicht zieht ihn in die andere Richtung: hin zu Viveka, der Unterscheidungskraft.
Vyāsa will damit sagen: Sobald du den Unterschied zwischen dem, was wirklich dein Selbst ist, und dem, was nur Erscheinung im Geist ist, klar erfasst, kippt das ganze innere System. Das, was vorher als Genuss lockte, wirkt plötzlich wie ein Ballast. Und was früher anstrengend erschien – nüchternes Hinschauen, Disziplin, Unterscheidung – wird auf einmal zu einer natürlichen Bewegung, fast wie ein Magnet, der den Geist nach oben zieht.
Wie sich das anfühlen kann
In der Praxis ist dieser Wechsel nicht unbedingt ein Knall, eher ein langsames Umstimmen. Stell dir vor, du bist lange von Zucker abhängig gewesen – die süßen Dinge haben dich angezogen, fast magisch. Mit der Zeit merkst du, dass sie dich müde machen. Irgendwann spürst du: „Eigentlich zieht mich Frisches, Leichtes, Klarsichtiges mehr an.“ Genau das beschreibt Vyāsa. Der Geist hat seine „Geschmacksrichtung“ gewechselt.
Kernbotschaft
- Unwissenheit und Begierde waren das alte Schwergewicht.
- Unabhängigkeit und Unterscheidung sind das neue.
- Der Geist selbst ändert dadurch seine Richtung – nicht mehr zur Verstrickung, sondern zur Befreiung.

Fazit: Geisteszustand und Praxis
Sutra 4.26 beschreibt keinen theoretischen Zustand, sondern ein lebendiges Erlebnis: Wenn du in der Meditation oder im Alltag plötzlich eine Lücke zwischen deinem wachen Verstand und deinem wahren Selbst spürst, hat sich viveka eingestellt. Du „fällst in den Strom“, und dieser zieht dich auf einmal zu neuen Ufern – ganz im Sinne von Osho’s Wasser-Bild. Klassische Kommentatoren betonen dabei: Ist die Erleuchtung nah, lösen sich Zweifel und Furcht auf (wie ein Stein, den man aus dem Wasser hebt). Der Geist „genießt jetzt die Schwere der Unabhängigkeit“ und ist allein mit seiner Klarheit.
Für Yogapraktizierende bedeutet das konkret: Hat man lange genug unermüdlich an Viveka gearbeitet (etwa durch Meditation und Selbstbeobachtung), kommt der Moment, da die Unterscheidung „wie von selbst“ präsent sein soll. In diesem Augenblick spürst du, wie dein Geist ruht – weil er das Spiel des Egos durchschaut. Technisch gesprochen lösen sich die Gedankenspiralen auf und – vielleicht kann man es so ausdrücken – die neuronalen Netzwerke des Fokus übernehmen die Führung. In dem Augenblick spürt man die Befreiung vielleicht weniger als ein Ereignis von außen, sondern eher als völlige Gelassenheit: Der Geist ist kaivalya-prāgbhāra – bereit zur Befreiung und ihr schon ganz nahe.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-49: Das Wissen aus Nirvichara Samapatti ist von höherer Art als das Wissen, das aus Gehörtem, Gelesenem oder mittels Schlussfolgerung gewonnen wurde
Yoga Sutra II-25: Wenn die Unwissenheit (Avidya) endet, löst sich die Verbindung (Samyoga) mit der äußeren Welt auf – dadurch erlangt der Sehende absolute Freiheit (Kaivalya)
Yoga Sutra II-26: Die Entwicklung und ununterbrochene Anwendung einer reinen Unterscheidungskraft (Viveka) beendet die Unwissenheit
Yoga Sutra II-55: Dadurch wird die Beherrschung der Sinne gemeistert
Yoga Sutra IV-29: Wer den höchsten Bewusstseinszustand erlangt hat und weiterhin zu jeder Zeit seine Unterscheidungskraft beibehält und dabei frei von allen Wünschen bleibt, erlangt Dharma-Megha-Samadhi, erhält einen "Regen von Tugenden"

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-26
Ruhe des Geistes führt zur Selbsterkenntnis – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 22 bis 26
Länge: 9 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Das Erreichen von Kaivalya – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.26
Länge: 11 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34
Länge: 95 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


