kæaña-pratiyogî pariñâmâparânta-nirgrâhyaï kramaï
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रार्ह्यः क्रमः
Die vorletzte Sutra. Der erleuchtete Mensch erkennt das Wesen der Zeit.
Dieser Artikel bietet dir nicht nur eine philosophische Einführung in Yogasutra 4.33 und dessen Kommentare, sondern auch Werkzeuge zur direkten Erfahrung deines eigenen Zeitbewusstseins. Du wirst erahnen (oder sogar verstehen?), wie die Begriffe kṣaṇa, krama und pariṇāma zusammenwirken – und wie du in Meditation oder Alltag kleine Brücken schlagen kannst, um die Lehre selbst nachzuempfinden.
Kurz zusammengefasst
- Abfolge (Krama)
Krama ist die Reihenfolge von Augenblicken, die sich erst offenbart, wenn Veränderung endet.
Im Zustand vollständiger Ruhe wird die Zeit als Ganzes erkannt – nicht mehr als endloser Fluss. - Moment (kṣaṇa)
Der kṣaṇa ist der kleinste momentane Zeitpunkt, an dem eine Veränderung spürbar wird.
Einzelne kṣaṇas ergeben erst in der Summe das Erleben von Ablauf. - Veränderung (pariṇāma)
Alle phänomenale Welt ist durch Wandel (Guṇas) bestimmt.
Solange diese Wandlung aktiv ist, bleibt das Zeitgefühl erhalten. - Ende der Wandlung (aparānta)
Wenn die dynamischen Prozesse zur Ruhe kommen, endet das Zeitbewusstsein.
Der Moment dieses Endes offenbart die bisherige Abfolge. - Ewige vs. Weltliches
Der puruṣa ist dauerhaft, unveränderlich – jenseits der Abfolge.
Die Guṇas sind ewig in ihrer Substanz, aber wandelbar in Erscheinung. - Dualität der Wahrnehmung
Für weltliche Wesen läuft die Abfolge weiter.
Für den Weisen, der die Illusion erkannt hat, ist sie aufgehoben. - Neurowissenschaftlicher Resonanzraum
Moderne Forschung deutet an, dass Bewusstsein in diskreten Zeitfenstern operiert.
Der Eindruck eines kontinuierlichen Zeitflusses könnte eine höhere Synthese sein.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
kṣaṇa-pratiyogī pariṇāma-aparānta-nirgrāhyaḥ kramaḥ
Wörtlich und grammatikalisch:
- Kshana, kṣaṇa, kṣaṇa = Augenblick; Moment; (idealer) Zeitpunkt; Grundeinheit der Zeit;
- Pratiyogi, pratiyogī, pratiyogî = das, was etwas „entgegengesetzt entspricht“ oder „im Gegensatz steht zu“; entsprechend; zusammenhängend; Gegner; in Beziehung zueinander; in Bezug auf; in Korrelation zu; der Auflöser; der Neutralisierer; in Wechselbeziehung stehen; Gegenpart;
- Parinama, pariṇāma, parinâma = Wandlung; Veränderungsprozess; Wechsel; Wandel; Veränderung; Umwandlung; Transformation;
- Aparanta, aparānta, aparânta = (am, das) Ende; Tod; das Aufhören; das letzte Stadium;
- Nirgrahyah, nirgrâhyah, nirgrāhyaḥ = erfassbar; wahrnehmbar; ersichtlich; herauszufinden; erfassen; erkennbar; aber auch: beendet, aufhören, verschwinden;
- Kramah, krama = Reihenfolge; sukzessiver Verlauf; Vorgang; Aufeinanderfolge; Wandlung; Abfolge (von Ereignissen); Folge; Sequenz; Schritte; Zeitablauf;
→ Wörtliche Gesamtbedeutung: „Krama (die Abfolge) ist das, was dem Augenblick entspricht (bzw. ihm entgegengesetzt ist) und am Ende der Wandlungen (pariṇāma) wahrgenommen wird.“

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Das vierte Kapitel des Yoga Sūtra – das Kaivalya Pāda – behandelt die letzte Stufe des yogischen Weges: die vollständige Befreiung (Kaivalya). Es beginnt mit der Frage, wie übernatürliche Fähigkeiten (siddhis) entstehen, und unterscheidet, ob sie durch Geburt, Drogen, Mantras, Askese oder Meditation erworben werden. Doch Patanjali stellt klar: Solche Kräfte sind Nebenprodukte, keine Ziele. Entscheidender ist, die Wurzeln der karmischen Bindungen zu verstehen und aufzulösen. Der Yogi erkennt, dass selbst das Ich-Bewusstsein nur eine Funktion der Guṇas ist. Die Trennung zwischen Geist (citta) und reiner Wahrnehmung (puruṣa) wird zunehmend durchschaut.
In den mittleren Sutren wird die Natur von Zeit, Veränderung und Wahrnehmung untersucht. Alles Existierende wandelt sich durch die Guṇas in unzähligen Momenten (kṣaṇas). Was wir als Kontinuität erleben, ist die Abfolge dieser winzigen Wandlungen. Mit fortschreitender Meditation erkennt der Übende die Mechanik des Wandels selbst – bis in Sutra 4.33 die Lehre gipfelt: Wenn die Wandlungen der Guṇas enden, endet auch das Erleben von aufeinanderfolgenden Momenten. Zeit löst sich in Bewusstheit auf.
| Abschnitt (Sutra-Bereich) | Thema | Kernaussage |
|---|---|---|
| 4.1 – 4.3 | Ursprung der Siddhis (übernatürlichen Fähigkeiten) | Fähigkeiten entstehen durch Geburt, Kräuter, Mantras, Askese oder Meditation; sie sind aber nur Nebenprodukte des Weges, nicht das Ziel. |
| 4.4 – 4.6 | Vielfältigkeit des Geistes und Ich-Idee | Der Geist kann sich vervielfältigen; dennoch bleibt das Bewusstsein eins. Das Ego ist nur eine Manifestation von Geistaktivität, kein unabhängiges Selbst. |
| 4.7 – 4.11 | Karma und seine Auflösung | Der erleuchtete Yogi schafft kein neues Karma. Frühere Eindrücke (saṁskāras) lösen sich, sobald die Ursache (Unwissenheit) aufgelöst ist. |
| 4.12 – 4.16 | Vergangenheit, Gegenwart und Realität der Dinge | Vergangene, gegenwärtige und zukünftige Erscheinungen existieren potenziell gleichzeitig; Veränderung ist nur eine Wandlung der Guṇas. |
| 4.17 – 4.22 | Bewusstsein und Wahrnehmung | Objekte werden durch Geist und Bewusstsein erkannt. Der Geist ist an sich unbewusst – er leuchtet nur durch den puruṣa (das reine Bewusstsein). |
| 4.23 – 4.29 | Erkenntnis, Unterscheidungskraft, Samādhi | Durch anhaltende Unterscheidung zwischen Geist und puruṣa reift der Zustand des dharmamegha-samādhi: das Wissen um alle Dinge und das Erlöschen des Begehrens. |
| 4.30 – 4.33 | Ende der Wandlungen – Auflösung der Zeit | Mit dem Stillstand der Guṇas enden Leid, Karma und Zeit. Die Abfolge der Momente (krama) wird nur am Ende der Wandlungen erkennbar. |
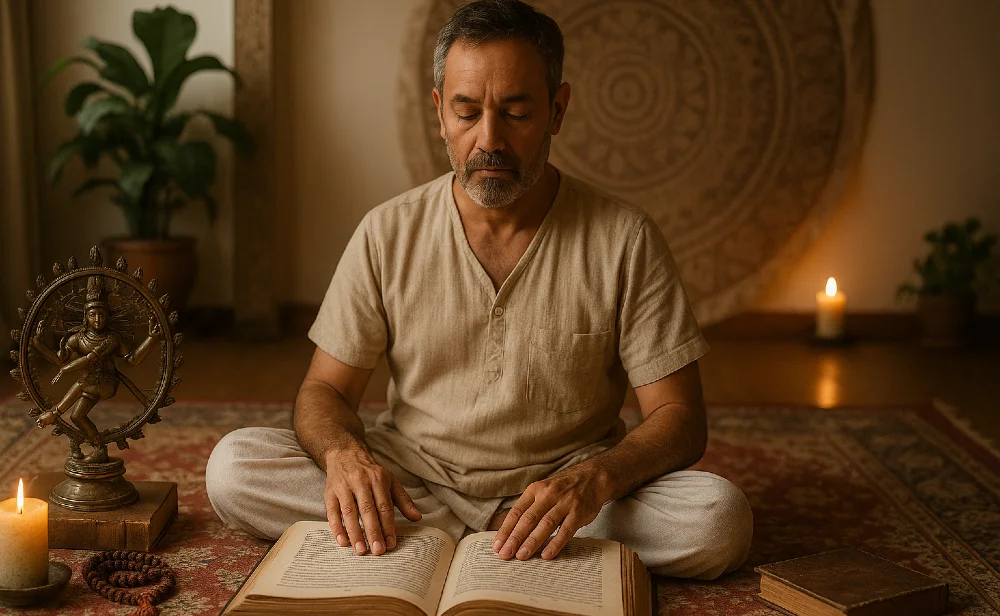
Yogasutra 4.33 – Krama als Abfolge der Momente
Yogasutra 4.33 definiert Krama als die zeitliche Abfolge von Momenten, die erst „am Ende“ aller Guṇa‑Vorgänge wahrnehmbar wird. In Sanskrit heißt es: kṣaṇapratiyogī pariṇāmāparāntanirgrāhyaḥ kramaḥ. Übersetzt etwa: „Krama (Reihenfolge) ist das, was den Augenblicken (kṣaṇa) entspricht und am Ende der Wandlungen erkennbar ist.“ Verschiedene Übersetzer formulieren es leicht unterschiedlich, aber allen Varianten ist gemeinsam: Krama bezeichnet eine durchgehende Folge von Augenblicken, die wir erst in dem Moment „sehen“, wenn die Veränderungsprozesse (pariṇāma) aufgehört haben. Während das kṣaṇa der einzelne Moment ist, hebt das Sutra hervor, dass nur in der Ruhe „am Aparānta“ der Wandelvorgänge die Abfolge der Momente als Ganzes wahrgenommen wird.
🕉️ Der Sanskrittext – Begriff für Begriff
kṣaṇa (क्षण) – der Moment
Etymologie: von der Wurzel kṣan, „vergehen, dauern, blitzen“.
Ein kṣaṇa ist die kleinste, unteilbare Einheit von Zeit. In buddhistischer Philosophie (besonders im Abhidharmakośa) gilt er als „atomarer Moment“ des Daseins – alles entsteht und vergeht in kṣaṇas.
Im Yoga-Kontext bedeutet kṣaṇa der „Augenblick des Erkennens“, der kleinste Punkt, an dem eine Wandlung feststellbar wäre.
Kommentar Vyāsa:
Ein kṣaṇa ist „die kleinste messbare Veränderung“ – der Moment, in dem etwas seine Qualität wechselt. Die Summe vieler kṣaṇas ergibt krama.
Praxisebene:
Wer meditativ Zeitlosigkeit erfährt, bemerkt manchmal, dass der Geist sonst ununterbrochen „von kṣaṇa zu kṣaṇa“ springt – wie ein Filmprojektor, der Einzelbilder zu Bewegung verschmilzt.
Die Yogapraxis zielt darauf, diese Sprünge zu erkennen – und schließlich zu stoppen.
pratiyogī (प्रतियोगी) – das Gegenstück, das Entsprechende
Wortbedeutung: „das, was etwas begleitet oder widerspiegelt“. In Logik und Grammatik bedeutet pratiyogin „Korrelat“ oder „das, was das Gegenteil zu etwas bildet“.
Im Sutra heißt es kṣaṇa-pratiyogī, also „dem Augenblick entsprechend“ oder „Gegenstück des Augenblicks“.
Patanjali deutet damit: Krama ist das Gegenstück zum einzelnen Moment – nicht der Moment selbst, sondern die Abfolge vieler solcher Momente.
Kommentar Bhoja:
Er betont: „So wie ein Schatten zum Licht gehört, gehört krama zum kṣaṇa – untrennbar, aber nicht identisch.“
Es ist das, was den Momenten Gestalt gibt – wie die Zeitlinie zum Punkt.
pariṇāma (परिणाम) – Wandlung, Veränderung
Etymologie: von der Wurzel nām (sich beugen, sich verwandeln) mit Präfix pari- (vollständig, ringsum).
Im Yoga bedeutet pariṇāma die ständige Transformation der Guṇas – der drei Grundqualitäten von Natur: sattva (Klarheit), rajas (Aktivität), tamas (Trägheit).
Vyāsa erklärt:
„Die Guṇas wandeln sich unaufhörlich, und mit jeder Wandlung entsteht ein neuer kṣaṇa.“
Diese „Wandlungen“ sind das, was wir als Zeit empfinden.
Philosophische Bedeutung:
Pariṇāma ist der Mechanismus, durch den das Universum – und der Geist – Bewegung erfahren.
Wenn diese Bewegungen enden (wie in 4.32 gesagt wird: guṇānāṃ pratiprasavaḥ – „die Rückkehr der Guṇas in ihr Gleichgewicht“), endet auch Zeit, Veränderung, Wahrnehmung.
aparānta (अपरान्त) – das Ende, der Abschluss
Zusammengesetzt aus: a-parānta, wörtlich „nicht-jenseitig“ oder „das Ende der Folge“.
In klassischem Sanskrit bezeichnet aparānta das Ende eines Zyklus, das letzte Stadium eines Prozesses.
Hier: das Ende der pariṇāmas – also der letzte Moment des Wandlungsflusses, in dem keine weitere Veränderung folgt.
Vyāsa nennt ihn den Punkt, „an dem die Abfolge der Guṇas stillsteht“.
Vergleich: Im Buddhismus taucht aparānta als Begriff für „Lebensende“ oder „Ende einer Weltperiode“ auf.
Im Yoga meint es subtiler das Ende jeder dynamischen Aktivität – die vollkommene Ruhe der Naturkräfte.
nirgrāhyaḥ (निर्ग्राह्य) – erkennbar, wahrnehmbar
Von der Wurzel: grah = „ergreifen, begreifen, erkennen“.
Mit Präfix nir- = „vollständig, gänzlich“.
Also: „vollständig erfassbar“, „in seiner Gesamtheit erkennbar“.
Damit ist gemeint: Die Abfolge (krama) ist nicht während des Wandels erfassbar, sondern erst, wenn der Wandel vollendet ist.
Solange man in der Bewegung steckt, sieht man keinen Verlauf – man ist der Verlauf. Erst im Stillstand wird der Verlauf sichtbar.
Beispiel Vyāsa:
„Wie man die Alterung eines Tuchs erst erkennt, wenn es alt geworden ist, so wird Krama erst erkannt, wenn die Wandlungen geendet haben.“
krama (क्रम) – Abfolge, Reihenfolge
Etymologie: von der Wurzel kram, „gehen, schreiten“.
Bedeutet: Schritt, Stufung, Reihenfolge, sukzessive Ordnung.
Im yogischen Sinn: die „geordnete Sequenz der Veränderungen“.
Krama ist das „Tempo der Natur“ – die Art, wie Dinge sich entfalten, altern, vergehen.
Philosophisch:
Krama ist nicht „Zeit“ im westlichen Sinne, sondern der wahrgenommene Rhythmus der Wandlungen. Zeit ist erlebte Abfolge von Pariṇāmas.
Vyāsa:
„Krama ist der ununterbrochene Fluss der Augenblicke (kṣaṇānāṃ anuvṛttiḥ).“
Er wird „am Ende der Wandlungen“ erkennbar, weil dann nichts Neues mehr die Wahrnehmung überlagert.
Vācaspatimiśra:
„Krama ist die Summe der vergangenen Veränderungen, welche in ihrem letzten Stadium als Kontinuität erfasst werden.“
Praxisbezug:
Im Zustand des Samādhi verlangsamt sich dieser Fluss. Man sieht, wie sich ein Gedanke nach dem anderen ablöst – und erkennt schließlich die Stille zwischen den Momenten.
Wenn auch diese Zwischenräume verschwinden, ist Krama ganz erkannt – und damit die Illusion von Zeit durchschaut.
Weitere Sutras zu Krama:
Yoga Sutra III-23: Die Folgen einer Handlung (Karma) zeigen sich entweder sofort oder ruhen erst und zeigen sich später – Samyama über das eigene Karma führt zur Vorahnung des Zeitpunktes des eigenen Todes
Yoga Sutra III-53: Durch Samyama auf den Augenblick und die Abfolge von Augenblicken erlangt der Yogi jenes Wissen, das auf der so gewonnenen Unterscheidungskraft beruht
Yoga Sutra IV-32: Dann (wenn Dharma-Megha-Samadhi erreicht wurde) enden für den Yogi die Veränderungen in der Natur durch die drei Gunas, weil diese ihren Zweck erfüllt haben
Zusammensetzung inhaltlich
„kṣaṇa-pratiyogī pariṇāma-aparānta-nirgrāhyaḥ kramaḥ“
Krama ist das, was den Augenblicken entspricht – die Abfolge, die am Ende aller Wandlungen erkennbar wird.
Das Sutra beschreibt also einen Bewusstseinszustand, nicht nur ein philosophisches Konzept. Man könnte vielleicht sagen: Wenn die Guṇas (Naturkräfte) zum Stillstand kommen, endet der fortlaufende Prozess des Werdens (pariṇāma). Erst in diesem Stillstand, wenn keine neue Veränderung entsteht, wird die ganze Reihe der Veränderungen als eine erkannt – Krama.
Das ist ein Moment höchster Erkenntnis: das Durchschauen der Zeit selbst.
Wie ist dieser Vers zu verstehen? Moderne Deutungen
Sukadev deutet diesen Vers als (weiteren) Beleg für die Ansicht Patanjalis, dass unser Leben wie ein Film abläuft. Alles ist eigentlich vorherbestimmt.
„Wir leben in einem Traum Gottes.”
Dies würde der Yogi nun erkennen.
Zeit, so schreiben viele Kommentatoren, verliert seine Abfolge. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – für den Yogin verschmilzt alles zu einem. Um beim Filmgleichnis zu bleiben: Der Film liegt komplett als Rolle/digitale Datei vor. Aber wenn man ihn Bild für Bild abspielt, entsteht (die Illusion von) Zeit.
Iyengar (S. 322): “Wenn die Wandlungen der Gunas aufhören, endet auch die ununterbrochene Bewegung der Augenblicke, und die Zeit bleibt stehen.” Denn der Eindruck, Zeit würde vergehen, entsteht durch die Bewegungen der Gunas. Da der Yogi diese nun durchschaue, sei er frei von dieser Betrachtung. Denn ein vollkommener Yogi lebe im Augenblick und "lässt sich nicht auf Bewegungen ein”.
Feuerstein fühlt sich bei dem hier von Patanjali geschilderten Zeitkonzept an “moderne Ideen zur diskontinuierlichen Natur der Zeit” und an Konzepte wie das “Raum-Zeit-Kontinuum” erinnert.
Zeitgenössische Interpreten betonen auch den erlebten Aspekt dieser Abfolge. Zum Beispiel sagt Osho, Krama sei „der Prozess der quantenhaften Abfolge von Wandlungen von Moment zu Moment, der am Ende der Transformationszyklen der drei Guṇas wahrnehmbar wird“. Er vergleicht die Welt mit einem Filmprojektor, dessen Laufzeit gestoppt wird, wenn die Guṇas zur Ruhe kommen – dann erkenne der Yogi den zugrundeliegenden Zeitfluss.
Eine Übersetzung bringt es so auf den Punkt: „Am Ende dieser Transformationen kann dieser kontinuierliche Fluss tatsächlich als eine Ansammlung diskreter Momente verstanden werden.“. Das illustriert, dass wir in meditativer Tiefe die Illusion eines fortlaufenden Zeitstroms überwinden: Es offenbart sich eine Abfolge von einzelnen Augenblicken, nicht ein unausgesetzter Fluss.
Welche Erfahrung hattest du bereits in Meditation?
Parallelen und Reflexion
- In der Sāmkhya-Philosophie ist pariṇāma das Prinzip aller Existenz – alles wandelt sich ständig. Aparānta ist das Zurückkehren ins Urgleichgewicht (pratiprasava).
→ Krama wäre dort der „Pfad der Evolution und Devolution“ der Guṇas. - In der buddhistischen Abhidharma-Schule heißt es ähnlich: Nur die Aufeinanderfolge von Momenten (kṣaṇas) lässt uns eine „Welt“ wahrnehmen; wenn dieser Fluss erkannt und überschritten wird, bleibt nur die Leere (śūnyatā).
- In moderner Philosophie und Neurowissenschaft spricht man davon, dass Bewusstsein in diskreten Frames (30–40 Hz) abläuft – genau wie ein Strom von kṣaṇas. Der „Film“ der Welt entsteht erst durch Integration, also durch Krama.
Klassische Kommentierungen
Vyāsabhāṣya (8.–9. Jh.) interpretiert Sutra 4.33 in sankhya-philosophischem Kontext. Er erklärt, dass Krama der ununterbrochene Strom von Momenten sei, der erst „am Ende“ der Guṇa‑Änderungen aufgegriffen wird. Als Bild benutzt er ein Tuch: Ein neues, gut erhaltenes Tuch sieht immer frisch aus, solange es keinem Wandel unterliegt; nur „am Ende“ aller Veränderungen wird es altersschwach – genau dadurch wird ihm erst die Sequenz der Momente bewusst. Oder wie Vyāsa es sagt: „Die Abfolge ist der ununterbrochene Fluss der Momente; sie wird vom letzten Ende, dem Aufhören der Veränderungen, erfasst. Ein Tuch, das nicht die Abfolge der Momente durchlaufen hat, gibt seine Neuheit nicht auf und wird nicht auf einmal alt.“. Das bedeutet: Ohne sukzessives Altern bliebe das Tuch immer neu – die Abfolge (Krama) zeigt sich nur, wenn wirklich keine weiteren Wandlungen anstehen.
Mehr zu Vyāsas Kommentar findest du unten.
Vācaspati Miśra (11. Jh.) bestätigt diese Sicht. Er fasst das Sutra ähnlich: Krama ist die kontinuierliche Reihenfolge von Momenten, die man erst erkennt, wenn alle pariṇāma aufgehört haben. Auch er nutzt das Tuch-Beispiel: Selbst ein sorgfältig verwahrtes neues Tuch wird über Jahre hinweg allmählich alt und zerbrechlich – erst am „letzten Ende der Änderung“ ist die sukzessive Alterung offensichtlich. Das zeigt, dass es tatsächlich einen ununterbrochenen Abfolge-Prozess gibt. Wörtlich: „Bei einem neuen, sorgfältig aufbewahrten Tuch wird das Alter erst nach langer Zeit sichtbar … Dies ist das letzte Ende der Veränderung. Deshalb existiert eine Abfolge der Veränderungen“. Er weist darauf hin, dass Krama also alle bleibenden Dinge durchdringt; sogar im scheinbaren Stillstand (z. B. in prākṛti als urwüchsiger Urgrund) besteht eine qualitative Abfolge.
Vācaspati betont auch: Da Pradhāna (Urstoff/Prākṛti) ewig ist, kann man in ihm keinen sukzessiven Übergang annehmen – aber bei den mit Qualitäten (Guṇas) ausgestatteten Phänomenen schon. Alles, was permanent ist, weist verborgen ein Kontinuum auf. (Puruṣa selbst ist ja unveränderlich; für ihn gilt kein Übergang.)
Im Zusammenhang mit 4.33 knüpfen beide Kommentatoren an Sutra 4.32 an: Dort heißt es, nach Erreichen von dharmamegha-samādhi hätten die Guṇa ihr Ziel erfüllt und könnten keinen einzigen Moment (kṣaṇa) mehr aufrechterhalten. Vācaspatimīśra vermerkt dazu: „Die Guṇas haben ihr Ziel erreicht und alle Veränderungen enden. […] Sie können sich keinen einzigen kṣaṇa mehr erhalten“. Das Sutra 4.33 folgt daraus: Wenn keine Wandlungen mehr geschehen, sehen wir schließlich, was bis dahin in kṣaṇa‑Schritten geschehen ist – eben die ganze Abfolge (Krama) als Einheit.
Buddhistische Anklänge und Sāmkhya
Interessanterweise weist Klostermaier darauf hin, dass Patanjalis Zeittheorie in diesem Zusammenhang stark dem buddhistischen kṣaṇikavāda gleicht. Im Buddhismus gilt der Moment (kṣaṇa) als kleinste tatsächliche Realität, und auch hier entstehen Zeit und Kausalität erst durch eine Aneinanderreihung so vieler Augenblicke. Patanjali drückt das nicht genauso aus, aber die Nähe fällt auf: Die „echten“ Objekte liegen im unvergänglichen Bewusstsein – alles andere „überlagert sich“ im kṣaṇa.
Und in der Sāmkhya-Philosophie, auf der Yoga aufbaut, wird kāla ebenfalls mit einer Folge von Guṇa-Veränderungen erklärt. Zwar tritt hier auch der Begriff apavarga (Befreiung) auf – analog zu Patanjalis kaivalya – doch zentral ist die Idee: Mit dem Ende aller Guṇas‑Dynamik bleibt nur noch das stetige Sein, in das die Kettenglieder der Zeit eingehen. Patanjali formuliert es in YS 4.33 daher explizit: Mit dem Ende der Guṇa‑Transformationen ist Krama erreicht.
Zeitwahrnehmung nach Neurowissenschaften
Spannend ist, wie moderne Forschung das Sutra stützt. Neurowissenschaftler beschreiben unser Erleben tatsächlich als in Zeitfenster unterteilt. Seit dem 19. Jh. wird vermutet, dass wir Zeit in schubweisen Momenten wahrnehmen. Ernst Mach schätzte bereits 30 ms als kleinste wahrnehmbare Zeiteinheit. Heute wissen wir: Das Gehirn verarbeitet Sinnesreize in ~30–40 ms breiten „Packets“. Innerhalb solch eines Zeitfensters ist subjektiv keine Vorher-Nachher-Differenz möglich – es ist atemporal. Erst wenn eine neue Welle von Nervenimpulsen einsetzt (bei etwa 30–40 Hz), entsteht wieder ein erlebbarer Moment.
Zahlreiche Experimente stützen dieses Modell: Wir können akustische Impulse unter 3–5 ms nicht getrennt hören, visuelle Bilder nur bis ca. 20–30 ms Abstand als getrennt sehen. Reaktionszeit-Studien zeigen zudem, dass Menschen bevorzugt in 30–40 ms-Schritten reagieren. Diese EEG-Oszillationen sind notwendig für Bewusstsein – ohne sie kann unser Hirn keine konsistenten Erlebniseinheiten aufbauen. Der erfahrene Kontinuumseindruck entsteht erst, wenn das Gehirn diese Mini-Momente (wie Filmframes) zu größeren Einheiten zusammenfügt.
Tatsächlich umfasst unsere subjektive Gegenwart etwa 2–3 Sekunden. Innerhalb dieser ~3 s bündeln sich viele kurze 30–40 ms-Fenster zu einem „momentanen Jetzt“. Erst wenn eine längere Pause dazwischen ist, erleben wir Ereignisse als getrennt. In diesem Sinne ist der vermeintlich fortlaufende Fluss der Zeit nur eine mentale Konstruktion. Wie Rüdiger Vaas zusammenfasst: „Der stetige Fluss der Zeit ist … eine Abstraktion oder Konstruktion, keine subjektive Erfahrung: physikalische Zeit und erlebte Zeit sind nicht deckungsgleich.“.
Diese Befunde legen nahe, dass Patanjalis Idee kein bloß poetischer Einfall war: Bewusstsein operiert tatsächlich in diskreten Momenten, und ein Gefühl von „Zeit“ entsteht erst durch höhere Verarbeitung (Erinnerung, Antizipation, Kontext). In einem tiefen Samadhi jedoch, wenn alle Denkimpulse zur Ruhe kommen, bricht dieses mehrsekündige Erleben laut Patanjali zusammen – es bleibt nur Krama: die erkannte Abfolge der bereits verstrichenen Augenblicke.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-33
Das klingt vielleicht etwas paradox, aber um Yogasutra 4.33 wirklich zu verstehen, musst du aufhören, sie verstehen zu wollen.
Diese Sutra spricht von etwas, das sich zeigt, wenn nichts mehr zu tun bleibt: wenn die Wandlungen der Guṇas enden, wenn also Körper, Geist, Gefühle, Erinnerungen, sogar die subtilen Schwingungen des „Ich“ zu Ruhe kommen. In der Praxis heißt das: nicht mehr tun, sondern nicht mehr eingreifen.
Klingt einfach? Ist es natürlich nicht. Aber die folgenden Übungen sollten dich dem Verständnis näherbringen:
🌿 In der Meditation
Setz dich hin. Nicht, um etwas zu erreichen. Sondern um zu schauen, was passiert, wenn du aufhörst, ständig etwas zu wollen.
Beobachte, wie Gedanken auftauchen. Einer nach dem anderen. Jeder Gedanke – ein kṣaṇa, ein winziger Moment. Und du sitzt mittendrin wie jemand, der einem alten Filmprojektor zuschaut. Einzelne Bilder, die sich so schnell abwechseln, dass sie wie Bewegung wirken.
Jetzt versuch nicht, die Gedanken zu stoppen. Das wäre wieder Bewegung. Lass sie einfach kommen, und vor allem: erkenne die Abfolge. Nicht den Inhalt – die Dynamik.
Vielleicht merkst du irgendwann: Zwischen zwei Gedanken gibt es etwas, das nicht denkt. Ein stilles, klares, lebendiges Etwas. Wenn du in diesem „Zwischenraum“ bleibst, beginnst du zu spüren, was Patañjali meint:
Die Empfindung von „Zeit“, von „nacheinander“, fällt weg.
Es gibt kein Vorher und Nachher mehr.
Nur Bewusstsein, das sich selbst schaut.
Das ist keine spektakuläre Erleuchtung. Eher wie wenn ein Geräusch plötzlich verstummt und du erst danach merkst, wie laut es vorher war.
Diese Pause ist eventuell das Tor zu dem, was die Sutra beschreibt.
Ein kleiner Übungstipp:
Achte auf die winzigen Übergänge – das Ein- und Ausatmen, der Punkt, an dem Einatmen aufhört, bevor Ausatmen beginnt. Der Moment, wo ein Gedanke endet, bevor ein neuer anrollt. Diese Spalte ist das aparānta, das „Ende der Wandlung“. Wenn du da kurz verweilst, fällst du aus dem gewohnten Fluss. Manchmal fühlt sich das an, als würde etwas in dir „klicken“ – als würde die Zeit für einen Augenblick aussetzen.
☀️ Im Alltag
Im Alltag geht’s um dasselbe, nur im dichten Nebel.
Wenn du morgens zu spät dran bist, im Verkehr stehst und dein Geist rattert – beobachte den Film. Du bist nicht nur im Auto, du bist auch Zuschauer deiner eigenen inneren Szenenfolge.
Frag dich: Wer erlebt das eigentlich gerade?
Wenn du das ernsthaft tust, löst sich der Zorn oder die Hektik oft für einen Moment auf. Und in dieser Lücke – genau da – zeigt sich das, was Patanjali meint: Die „Abfolge der Momente“ wird durchschaubar, sie verliert ihre Macht über dich.
Oder im Gespräch: Du willst etwas sagen, spürst, dass du gleich platzt.
Stopp.
Bevor du sprichst, schau diesen winzigen Moment an, in dem die Worte noch nicht losgeschickt sind. Das ist ein gelebtes aparānta.
Wenn du ihn erkennst, entscheidest du frei.
Das ist eine mögliche Alltagspraxis dieser Sutra – nicht das Denken, sondern das Sehen des Denkens.
🌌 Warum bringen uns diese Übungen dem Verständnis näher?
Patañjali sagt im Grunde: Zeit ist ein Konstrukt der Veränderung. Wenn du die Veränderung stilllegst, bleibt Bewusstsein – zeitlos, unzerteilt, frei.
Das ist keine Flucht aus der Welt, sondern ein anderes Verhältnis zu ihr.
Du beginnst zu leben, als wärst du gleichzeitig Beobachter und Spieler.
Der Alltag wird nicht verschwinden, aber er verliert dieses Ziehen – als müsstest du überall hinterherlaufen.
Manchmal reicht ein einziger klarer Moment, um das zu spüren:
Wenn du morgens im ersten Licht sitzt, der Atem flach ist, und du merkst, dass die Zeit gerade nicht vergeht. Sie ruht. Und du ruhst mit ihr.
Dann weißt du, was Patañjali meint – nicht im Kopf, sondern in jeder Zelle.
Kurz gesagt:
Übe, die Abfolge der Veränderungen zu sehen, ohne sie zu kommentieren.
Übe, die Lücken zwischen den Momenten zu spüren.
Übe, nichts zu wollen.
Und irgendwann, vielleicht beim Abwasch oder im Bus, merkst du: Es gibt gar nichts, das du festhalten musst. Die Zeit vergeht – aber du nicht.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
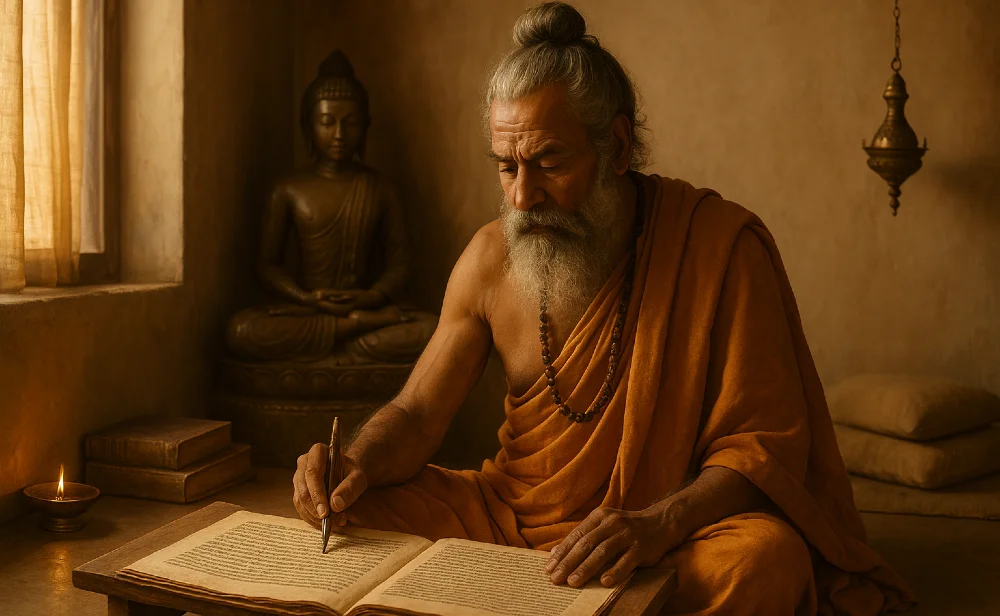
Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.33 – über die Abfolge der Momente
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyāsa, der älteste bekannte Kommentator der Yoga-Sūtras, schreibt zu einer grundlegenden Frage: Was ist eigentlich diese „Abfolge“ (Krama)? – und hat sie jemals ein Ende? Wir haben oben seine Erklärungen schon einmal kurz zusammengefasst. Das das Ganze aber nicht einfach zu verstehen ist, erläutere ich seinen Kommentar hier noch einmal näher.
Im Folgenden findest du eine sinngemäße, aber sprachlich entwirrte und kommentierte Fassung seines Kommentars. Der ursprüngliche Sinn bleibt erhalten, die Formulierung jedoch bringt ihn näher an heutiges Denken und Empfinden.
🔹 Die Abfolge der Momente
Vyāsa sagt:
Die Abfolge (krama) ist der ununterbrochene Fluss von Augenblicken. Sie wird sichtbar, wenn die Veränderungen aufhören – so, als ob man am Ende eines Prozesses zurückblickt und erst dann erkennt, dass eine Abfolge stattgefunden hat.
Er vergleicht das mit einem Stück Stoff:
Ein Tuch, das keinem Wandel unterliegt, bleibt ewig neu. Nur wenn es Schritt für Schritt altert, zeigt sich, dass Zeit vergangen ist.
Erst wenn das Altern vollendet ist – also am Ende der Veränderung –, wird die Abfolge der Momente als Ganzes erkennbar.
Das klingt sehr theoretisch, ist aber unmittelbar erfahrbar: Wenn du etwa einen Menschen nach Jahren wiedersiehst, fällt dir plötzlich auf, wie er sich verändert hat. Währenddessen, im Alltag, hast du den Wandel nicht bemerkt. Abfolge ist also das, was sich erst im Rückblick offenbart.
🔹 Ewiges im Wandel
Vyāsa unterscheidet zwei Arten von „Dauerhaftem“ (nitya):
-
Das ewig Vollkommene – das ist der puruṣa, das reine Bewusstsein, unveränderlich, immer dasselbe.
-
Das ewig Wandelnde – das ist die prakṛti, die Natur und ihre Eigenschaften (guṇas).
Beide sind „dauerhaft“, weil ihre Substanz nicht zerstört werden kann. Nur die Erscheinungsformen wechseln.
Du könntest sagen: Das Meer bleibt Meer – auch wenn die Wellen kommen und gehen.
🔹 Ende der Wandlung – oder nicht?
Nun stellt Vyāsa eine philosophisch reizvolle Frage:
Hat diese Abfolge von Veränderungen – das ewige Spiel der Guṇas – ein Ende, oder nicht?
Seine Antwort ist überraschend differenziert:
-
Bei den Erscheinungen, also in der sichtbaren Welt, hat die Abfolge ein Ende.
Wenn Veränderungen aufhören, endet auch die Wahrnehmung von Zeit.
-
Bei den Eigenschaften selbst, also in ihrer „ewigen Natur“, hat sie kein Ende.
Denn die Guṇas sind nie wirklich zerstört – sie kehren nur in ihr Gleichgewicht zurück.
Und dann zieht Vyāsa einen kühnen Vergleich:
Wie bei der Frage „Hat das Universum ein Ende?“ lässt sich auch diese nicht pauschal beantworten.
Für den Weisen, der Erkenntnis erlangt hat, endet die Abfolge der Welt, weil er sie als Projektion durchschaut.
Für alle anderen endet sie nicht, weil sie weiterhin in ihr handeln, leiden und sich verändern.
So wie man sagen kann, dass „alles, was geboren wird, auch sterben muss“ –
aber dann wieder differenzieren muss: Der Erleuchtete, der alle Begierden überwunden hat, wird nicht mehr geboren.
Für ihn ist der Kreislauf der Wandlungen vollendet.
Für die übrigen Wesen läuft das Rad weiter.
🔹 Der doppelte Blick
Vyāsa lehrt hier nicht in Rätseln, sondern zeigt eine Art doppelten Blick:
Auf der einen Ebene läuft die Abfolge der Zeit endlos weiter – Tag und Nacht, Geburt und Tod, Freude und Schmerz.
Auf der anderen Ebene gibt es eine Wirklichkeit, die jenseits davon steht: das reine Bewusstsein (puruṣa), das nie geboren wurde und nie vergeht.
Er deutet an: Wenn du als Übender still wirst, wenn du dich nicht mehr vollständig mit den Wandlungen der Welt identifizierst, dann siehst du, wie die Abfolge der Momente – dieses rastlose Werden – sich in etwas Größerem auflöst.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra II-18: Die wahrgenommenen Objekte sind aus den 3 Gunas mit den Eigenschaften Klarheit, Aktivität und Trägheit zusammengesetzt, bestehen aus Elementen und Wahrnehmungskräften – alles Wahrgenommene dient der sinnlichen Erfahrung und der Befreiung
Yoga Sutra II-23: Der Sinn der (scheinbaren) Verbindung (Samyoga) unseres wahren Selbstes (Purusha) mit der äußeren Welt (Prakriti) besteht darin, dass wir unsere wahre Natur und deren Kräfte erkennen
Yoga Sutra III-13: Durch die transformierenden Prozesse erklären sich die Veränderungen in der Form, der Zeit und dem Zustand der Elemente und der Sinnesorgane
Yoga Sutra III-15: Veränderungen in der Abfolge sind die Ursache für die Verschiedenheit der Verwandlung der Dinge
Yoga Sutra III-53: Durch Samyama auf den Augenblick und die Abfolge von Augenblicken erlangt der Yogi jenes Wissen, das auf der so gewonnenen Unterscheidungskraft beruht

Zusammenfassung der Perspektiven
- Übersetzungsvarianten: Das Sutra wird ähnlich wiedergegeben („Abfolge des Moments … erkennbar am Ende der Wandlung“), doch Wortwahl variiert („Gegenteil des Augenblicks“ vs. „Zerlegung diskreter Momente“). Fundamentaler Widerspruch besteht nicht; alle Deutungen betonen, dass Krama als Kontinuum von Momenten nur bei Beendigung der Guṇa‑Prozesse aufscheint.
- Schlüsselbegriffe: kṣaṇa (Moment), pariṇāma (Veränderung), aparānta (Ende), nirgrāhya (wahrnehmbar) und krama (Abfolge) sind die zentralen Termini. Zusammen beschreiben sie, dass man eine geordnete Zeitfolge („Krama“) erst erkennt, wenn die dynamische Vorgangskette („pariṇāma“) aufhört.
- Klassische Kommentare: Vyāsa und Vācaspati erklären Krama als „ununterbrochenen Fluss von Augenblicken“, erkennbar am Abschluss der Wandlungen. Das berühmte Tuch-Beispiel veranschaulicht, dass Neues erst durch eine Serie von Momenten altert. Die Lehre liegt nahe buddhistischer Momentanismus und greift sankhya-philosophische Ideen auf.
- Neuzeitliche Sicht: Moderne Forscher belegen, dass das Bewusstsein tatsächlich in ~30 ms-Einheiten abläuft, unsere bewusste Gegenwart aber mehrere Sekunden umfasst. Die „Kontinuität“ ist demnach eine Projektion des Geistes – genau wie Patanjali es in 4.33 nahelegt.
In der Praxis bedeutet das: Im erlangten Kaivalya (dem Ziel des Yoga) hört die Zeit auf, ihre übliche Form zu zeigen. Ein Yogi, der Samādhi erreicht, erlebt keine vor- und nachfolgenden Augenblicke mehr, sondern eine Art Aufgehobensein der Zeit. Erst in diesem zeitlosen Zustand wird ihm Krama, die unsichtbare Kette der ehemaligen Momente, als Ganzes bewusst.
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-33
Dharma Megha Samadhi und Kaivalya – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 29 bis 34
Länge: 13 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Das komplette Verstehen von Zeit – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.33
Länge: 8 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34
Länge: 95 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


