tataḥ kṛtārthānaṁ pariṇāma-krama-samāptir-guṇānām
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्
In den letzten drei Versen des Yogasutras beschreibt Patanjali, wie für einen erleuchteten Menschen das normale Dasein endet, sich Raum, Zeit und Welt auflösen, das Streben endet. Am Ende soll eine vollkommene Freiheit warten.
Dieser Artikel führt dich dorthin, wo Patanjali leise wird: zu dem Moment, in dem die Welt ihr Werk getan hat und die inneren Rädchen aufhören zu klicken. Du bekommst eine klare Landkarte – von den klassischen Kommentaren bis zu Übungen, die du heute ausprobieren kannst.
Kurz zusammengefasst
- Sutra 4.32 – Kernidee: Wenn die Guṇas (Sattva, Rajas, Tamas) ihren Zweck – Erfahrung (bhoga) und Befreiung (apavarga/kaivalya) – erfüllt haben, endet ihre Abfolge von Wandlungen.
- Dharma-megha-samādhi: Der „Wolken-Zustand“ markiert die Reife: Kleśas und Karma sind verbrannt, das Wissen wird grenzenlos, das „Optimieren“ fällt weg.
- Klassische Kommentare: Vyāsa betont das Ausklingen der Naturkräfte; Vācaspati Miśra präzisiert die Abfolge (krama); Bhoja akzentuiert geistige Ruhe – alle fokussieren das Zurückziehen der Prakṛti.
- Wichtige Begriffe: Guṇa, pariṇāma (Wandlung), krama (Abfolge), puruṣa (Seher), prakṛti (Natur), viveka-khyāti (Unterscheidungskraft).
- Praxis in der Meditation: Erkennen → Erlauben → Nicht-Eingreifen. Mikro-Stille zwischen Atemphasen wahrnehmen; „Zweck erfüllt – für jetzt“ als innerer Marker.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Tatah = dadurch; dann; darauf; daher; daraus;
- Krta, kṛta = erfüllt; gemacht; getan; das Produkt von; daraus gemacht; das Ergebnis;
- Arthana, arthāna, arthanam, artha = Zweck; Sinn; Ziel;
- Kritarthanam, kritârthânâm = nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben;
- Parinama, parinâma = (von den) Veränderungen; Wandel; Umwandlung; Verschiebung; der übliche Gang des Wandels; Transformation;
- Krama = Vorgang; Folge; Wandlung; Abfolge; lineare Ordnung; Reihe;
- Samapthih, samâptih, samāptiḥ = das Ende; ist beendet; Beendigung; Vollendung; Abschluss; Beendigung; Schluss;
- Gunas, gunânâm = der drei Gunas; die drei Grundeigenschaften der Natur; Wirkkräfte; von den grundlegenden Kräften der Natur;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Im Kaivalya-Pāda entfaltet Patañjali, wie Befreiung entsteht, und rückt die Mechanik des Geistes ins Zentrum. Die Sutren 4.1–4.3 erklären die Herkunft von Siddhis (angeboren, durch Kräuter, Mantra, Askese, Samādhi) und ordnen sie als Nebenprodukte natürlicher Verwandlungen (pariṇāma) ein: Übung ist nur Anstoß – die eigentliche Entfaltung leistet Prakṛti. 4.4–4.6 untersuchen die Genese des Citta (aus Ahaṁkāra hervorgehend, mannigfaltig), stets „beleuchtet“ vom Puruṣa. 4.7–4.11 zeichnen das Gesetz von Karma, Saṁskāras und Kleśas nach: Für den Yogi sind Handlungen weder weiß noch schwarz, weil Anhaftung versiegt; Samen von Erfahrung reifen, solange Ursache–Wirkung wirkt. 4.12–4.18 vertiefen Zeit und Wahrnehmung: Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft bestehen als Formen der Guṇas; dasselbe Objekt wird verschieden wahrgenommen; der Geist ist erkennbar, aber nicht der Seher selbst. 4.19–4.22 betonen: Das Citta ist nicht selbstleuchtend; Erkenntnis geschieht nur im „Licht“ des Puruṣa; in tiefer Sammlung fällt die Gleichzeitigkeit von Erkennen und Erkanntem auseinander.
4.23–4.28 beschreiben den Reifepunkt: Der Geist spiegelt Puruṣa klar, viveka-khyāti (ununterbrochene Unterscheidungskraft) ist stabil, die letzten Hindernisse – inklusive der Siddhis – werden als Ablenkungen erkannt. 4.29–4.31 gipfeln im dharma-megha-samādhi: Kleśas und Karma sind ausgebrannt, das Wissen wird grenzenlos, und das Erkennbare ist praktisch erschöpft. Mit 4.32 kommt die Pointe: „Wenn der Zweck erfüllt ist, enden die Wandlungen der Guṇas.“ Die Natur hat gelehrt, was zu lernen war; der Zweck – Erfahrung (bhoga) und Befreiung (apavarga/kaivalya) – ist erreicht, daher verstummt die Abfolge der Veränderungen.
| Abschnitt (Sutra-Range) | Hauptthema | Kernaussage | Schlüsselbegriffe |
|---|---|---|---|
| 4.1–4.3 | Ursprung der Siddhis und Rolle von Prakṛti | Siddhis entstehen auf verschiedenen Wegen; Übung setzt nur den Impuls, die Verwandlungen (pariṇāma) leistet die Natur. | Siddhi, pariṇāma, Prakṛti, nimitta (Anlass) |
| 4.4–4.6 | Entstehung und Vielfalt des Citta | Der Geist geht aus Ahaṁkāra hervor, erscheint vielfach, ist aber stets vom Puruṣa „erhellt“. | Citta, Ahaṁkāra, Puruṣa |
| 4.7–4.11 | Karma, Saṁskāra, Kleśa | Für den Yogi sind Handlungen nicht-dual (weder „weiß“ noch „schwarz“); Eindrücke tragen Erfahrung fort, bis die Ursachen erschöpft sind. | Karma, Saṁskāra, Kleśa, vāsanā |
| 4.12–4.14 | Zeit als Folge von Guṇa-Wandlungen | Vergangenheit und Zukunft bestehen potenziell; Formen entstehen durch Verschiebungen der Guṇas. | sattva–rajas–tamas, dharmin/dharma, pariṇāma |
| 4.15–4.18 | Wahrnehmung, Objektivität, Seher | Dasselbe Objekt wird verschieden wahrgenommen; der Geist ist erkennbar, der Seher (Puruṣa) bleibt unveränderlich. | pramāṇa, vikalpa, Puruṣa, citta-vṛtti |
| 4.19–4.22 | Nicht-Selbstleuchten des Citta | Citta erkennt nicht aus sich; Erkenntnis erfolgt nur im „Licht“ des Puruṣa; in tiefer Sammlung fällt Gleichzeitigkeit weg. | prakāśa, saṁyoga, samādhi |
| 4.23–4.28 | Reife der viveka-khyāti & letzte Hindernisse | Der Geist spiegelt Puruṣa klar; Siddhis werden als Ablenkungen erkannt; Rest-Kleśas vergehen. | viveka-khyāti, upasarga (Störungen), vairāgya |
| 4.29–4.31 | dharma-megha-samādhi | Mit dem „Tugend-Wolken-Samādhi“ verbrennen Kleśas/Karma; Wissen wird grenzenlos, das Erkennbare nahezu erschöpft. | dharma-megha, karmāśaya, jñāna |
| 4.32 | Ende der Guṇa-Wandlungen | Zweck erfüllt: Die Abfolge der Veränderungen stoppt; Prakṛti zieht sich zurück – Voraussetzung für Kaivalya. | Guṇa, pariṇāma-krama, kaivalya, bhoga/apavarga |

Yogasutra 4.32 – Wenn die Wandlungen der Gunas enden
„Dadurch verschwinden die Veränderungen durch die drei Gunas, weil sie ihren Zweck erfüllt haben.“ – So lautet eine mögliche Übersetzung von Yogasutra IV 32. Dieses Sutra steht fast am Ende von Patañjalis Yoga Sutra und beschreibt einen Zustand höchster Ausgeglichenheit und Stille: Die dynamischen Vorgänge der Natur kommen zum Erliegen, sobald ihr Zweck erreicht ist. Es markiert den Höhepunkt des Yoga-Wegs, an dem die „Guṇas“ – die Urqualitäten der Natur – ihre Aufgabe erfüllt haben und sich zurückziehen. Was bedeutet das im Klartext? Warum sollte die Natur plötzlich stillstehen? Und was sind diese geheimnisvollen „Guṇas“ überhaupt? Im Folgenden wollen wir die Aussage des Sutra erläutern, zentrale Begriffe definieren und sowohl klassische Kommentare als auch moderne Deutungen und wissenschaftliche Erkenntnisse heranziehen, um Patanjalis kryptische Worte mit Leben zu füllen.
Übersetzungsvarianten und Schlüsselbegriffe des Sutra
Yogasutra IV 32 wird je nach Quelle leicht unterschiedlich wiedergegeben, ohne dass sich der Kerngehalt wesentlich ändert. Zum Vergleich einige Beispiele aus verschiedenen Übersetzern:
- Swami Satchidananda: Dann beenden die Gunas die Abfolge ihrer Wandlungen, da sie ihren Zweck erfüllt haben.
- I. K. Taimni: Die drei Gunas haben ihren Zweck erfüllt, der Prozess der Veränderungen kommt zum Abschluss.
- Edwin Bryant: Folglich kommen die unablässigen Wandlungen der Gunas zum Stillstand, da ihr Zweck nun erfüllt ist.
Manche Übersetzungen heben also das “Ende der Abfolge von Veränderungen” hervor, andere sprechen von “Abschluss des Veränderungsprozesses” oder “Stillstand der Wandlungen”. Allen gemeinsam ist die Aussage:
Etwas ist erreicht, woraufhin die Aktivitäten der Gunas enden.
Was sind die Gunas?
In der Philosophie des Yoga und des Schwestersystems Sāṃkhya sind die drei Guṇas die grundlegenden Qualitäten der Natur:
- Sattva (Reinheit, Licht, Balance),
- Rajas (Aktivität, Bewegung, Energie) und
- Tamas (Trägheit, Dunkelheit, Masse).
Alle materiellen und mentalen Vorgänge entstehen durch das dynamische Zusammenspiel dieser drei Kräfte. Man kann sich die Gunas vereinfacht wie drei Stränge vorstellen, aus denen das Gewebe der Wirklichkeit geflochten ist – mal dominiert der eine, mal der andere. Veränderungen (pariṇāma) im Yoga-Sinne sind also die ständigen Wandlungen und Umschwünge im Verhältnis dieser Gunas zueinander, die unsere gesamte erfahrbare Welt – einschließlich unserer Gedanken und Emotionen – hervorbringen.
“Krama” – die Abfolge der Veränderungen: Das Sutra betont, dass die Abfolge (krama) der Veränderungen endet. Normalerweise folgt eine Veränderung auf die nächste, Augenblick für Augenblick, was wir als Zeitablauf erfahren. Patañjali definiert an anderer Stelle Zeit sogar als „ununterbrochene Folge von Veränderungen“. Unsere Wahrnehmung von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft entsteht dadurch, dass die Gunas unaufhörlich neue Zustände hervorbringen – ähnlich wie ein Film aus Einzelbildern Bewegung und Zeit erschafft.
Wenn nun diese Folge stoppt, bedeutet das: Die Zeit steht still – zumindest aus der Perspektive des Befreiten. Der Yogi ist nicht mehr dem Strom der Veränderungen unterworfen; er tritt in einen zeitlosen Zustand ein.
Welcher Guṇa-Zustand prägt deinen Alltag aktuell am stärksten?
Der “Zweck” der Gunas
Worin besteht nun der erwähnte Zweck, den die Gunas erfüllen müssen? Patañjali hat bereits früher im Werk (im Sutra 2.18) eine klare Antwort gegeben: “die Welt (Prakṛti) existiert, um Erfahrung (bhoga) zu ermöglichen und zur Befreiung (apavarga, kaivalya) zu führen”.
Mit anderen Worten, all die Wechselspiele der Natur dienen zwei großen Zielen:
- Erstens sollen sie der Bewusstseinsinstanz – im Yoga Purusha genannt, das reine Selbst oder Bewusstsein – vielfältige Erfahrungen bieten, und
- zweitens soll Purusha dadurch letztlich Erleuchtung bzw. Befreiung erlangen, wenn alle Lektionen gelernt sind.
Bhoga (Erfahrung/Genuss) und Apavarga (Befreiung/Erlösung) sind also der Doppelsinn und Doppelnutzen des Lebens und der Welt aus Yogasicht. Diese Idee stammt aus der Sāṃkhya-Philosophie und wird in den Yoga-Sutren übernommen.
Ist dieser Zweck erreicht – hat Purusha genug erfahren und die Befreiung erlangt – dann haben die Gunas „nichts mehr zu tun“.
Sie haben dem bewussten Selbst alles geboten, was zu bieten war.
Genau diesen Moment beschreibt Yogasutra 4.32: “tataḥ kṛtārthānāṁ pariṇāma-krama-samāptiḥ guṇānāṁ” – „Dann (tataḥ), wenn [die Gunas] ihren Zweck erfüllt haben (kr̥tārthānām), kommt die Abfolge (krama) der Verwandlungen (pariṇāma) der Gunas zum Abschluss (samāptiḥ).“ Die klassische Kommentarliteratur macht deutlich, dass mit „dann“ (tataḥ, „dadurch“) die vorherigen Sutras gemeint sind: Es bezieht sich auf das Erreichen des dharma-megha-samādhi, des mysteriösen „Tugend-Wolken-Samadhi“ und dem anschließenden Enden aller Leiden und dem Karma sowie dem Auflösen aller Verschleierungen. Dieses extrem hohe Samadhi (eine Art erleuchtender Überbewusstseinszustand) gilt als unmittelbarer Vorbote der völligen Befreiung. Sobald dieser Zustand aufzieht wie eine Gnaden-Wolke am Himmel, ist das Werk der Gunas getan.

🧘♂️ Der Weg zur Befreiung – Stufen im Yogasutra
Klicke auf eine Stufe, um mehr zu erfahren.
Die Gunas verändern sich nicht mehr
Also: Wenn ein Mensch den höchsten Samadhi (hier Dharma-Megha-Samadhi genannt) erreicht hat, hören die drei Gunas, gemäß yogischer Lehre die drei Grundeigenschaften der Natur, auf sich zu verändern. Der Yogin, so Govindan (S. 183) verharre dann im vierten Zustand (turiya). Er ist nicht mehr betroffen oder abhängig von den drei grundlegenden Kräften der Natur.
Neben dem unendlichen Wissen wie in der Sutra zuvor beschrieben kommen die Gunas, bzw. die materielle Welt für den erleuchteten Menschen zur Ruhe. Die Gunas haben ihren Zweck erfüllt. Aber der Yogi könne die Gunas weiterhin nutzen, wie es ihm gefällt. Wie einen Diener, so Iyengar. Aber der Yogi wird nicht mehr durch die Gunas beeinflusst oder verwirrt.
Die Verbindung von Natur (Prakriti) und dem wahren Selbst (Purusha) löst sich auf, so Sukadev.
Skuban schreibt (S. 271), dass für jemanden, der den Yoga-Zustand des "citta vritti nridodha", des Zuruhebringens der Gedanken (beschrieben in Sutra I-2), erreicht habe, die Welt aufhöre zu existieren, wie das auch in Sutra II-22 geschildert wird.
Ein solcher Mensch lebe im ewigen Jetzt, es gibt für ihn kein Morgen oder Gestern.
Wie ist das zu verstehen? Sukadev erläutert: Für einen im Leben erleuchteten Menschen, den Jivanmuktti, hört der Wandel in der Welt nicht auf. Aber dieser Wandel berührt den Jivanmukhti nicht mehr. Schmerz, Wut, Trauer, Freude, Müdigkeit– all das ist noch da, wird wahrgenommen, aber die/der Erleuchtete identifiziert sich nicht mehr damit.
Es gibt dafür auch den Begriff „Triguṇātita“ – jemand, der die Gunas überwunden hat.
In der Bhagavad Gita heißt es in Vers 14.26:
„Wer sich in vollem hingebungsvollem Dienst engagiert, der unter allen Umständen unfehlbar ist, transzendiert sofort die Modi der materiellen Natur und gelangt so auf die Ebene von Brahman.“
Rainbowbody: „Hier wird die Ich-Welt der egoischen Getrenntheit - die Welt der scheinbaren und scheinbar getrennten Formen - aufgebrochen (nirguna), weil ihre zugrunde liegende wahre Natur als interdependent (nicht aus einem getrennten Selbst bestehend) als swarupa=sunyam offenbart wird. In Wirklichkeit Tat Tvam Asi (Das bist du!).”
Willst du wirklich zum Ziel des Yoga?
R. Palm macht (S. 230) auf einen interessanten Aspekt aufmerksam: “So pendelt die thematische Gewichtung der letzten Sutras auffallend zwischen Erwachen und Unterscheidungsschau … und Aufhören der Materie … hin und her, als wollte Patanjali ein letztes Mal klarstellen, worauf man sich eingelassen hat.” Das Wort “Kritarthanam” könne sich auch auf Yogis beziehen, deren Zweck sich erfüllt habe …
Was die klassischen Kommentare sagen
Die traditionellen Kommentatoren der Yoga-Sutren – allen voran Vyāsa (der Verfasser des ältesten Yoga-Bhāṣya), später Gelehrte wie Vācaspati Miśra, Bhoja und andere – haben Sutra 4.32 ausführlich erläutert. Dabei herrscht im Kern bemerkenswerte Einigkeit, aber es gibt unterschiedliche Betonungen und Bilder, die das Verständnis bereichern.
Vyāsa: Die Gunas ziehen sich zurück, Purusha ist befreit
Vyāsa erklärt, dass mit dem Einsetzen des dharma-megha-samādhi alle Aufgaben der Gunas erfüllt sind. Sie haben Purusha sowohl Genuss als auch Erlösung verschafft – damit gibt es keinen Grund mehr, dass die Urkräfte weiter aktiv bleiben. Er formuliert geradezu dramatisch: Haben die Gunas den Zweck von Erfahrung und Befreiung erfüllt, „so bleibt für sie kein Zweck mehr übrig. Sie können sich nicht einmal mehr für einen einzigen Augenblick aufrechterhalten“. Mit anderen Worten: Die Kräfte der Natur entfallen im selben Moment, da das Bewusstsein vollkommen erwacht ist. Nichts treibt die Show weiter an.
Vyāsa betont auch, dass die Guṇas im Geist (Chitta) die treibenden Kräfte hinter Körper und Sinnen sind. In allen bisherigen Stadien des Lebens haben Sattva, Rajas, Tamas das Rad der Wiedergeburten und Erfahrungen angetrieben – den Strom von Geburt und Tod nennt er es. Doch nun, da Purusha’s Bestimmung erfüllt ist, kommen diese Vorgänge zum Halt. Die “verschiedenartigen Verwandlungen” der Natur – alles Wechselspiel, das von einer Lebensform zur nächsten führt – hören für immer auf. Swami Vivekananda bringt es in seinem Kommentar prägnant auf den Punkt: „Dann kommen all die verschiedenen Verwandlungen der Qualitäten, die von einer Daseinsform zur nächsten wechseln, für immer zum Erliegen.“. Kein neues Karma, keine neuen Hüllen oder Identifikationen mehr: Purusha ruht in sich selbst.
Ein berühmtes Bild aus der Sāṃkhya-Tradition veranschaulicht diesen Moment: Prakṛti (die Natur) wird mit einer Tänzerin verglichen. „So wie eine Tänzerin aufhört zu tanzen, nachdem sie sich dem Publikum gezeigt hat, genauso zieht sich die Urnatur zurück, nachdem sie sich dem Selbst offenbart hat.“. Die Gunas haben ihren letzten Tanz getanzt. Der Zuschauer – das Selbst – ist zufrieden, hat genug gesehen. Der Vorhang fällt.
Mehr zu Vyasas Kommentar unten.
Vācaspati Miśra: Das Ende der Folge und der Moment des Übergangs
Vācaspati Miśra, der im 9. Jahrhundert Vyāsas Erläuterungen im Tattva-Vaiśāradī-Kommentar weiter auslegte, unterstreicht die Logik und Konsequenz dieses Sutra. Er diskutiert, warum es überhaupt Sinn ergibt, von einer „Abfolge der Veränderungen“ zu sprechen, die enden kann.
Hier schimmert eine Debatte mit den Buddhisten durch: In der buddhistischen Philosophie jener Zeit galt der Geist als Abfolge momentaner Ereignisse ohne bleibendes Substrat – alles fließt von Moment zu Moment, nichts dauert an. Einige buddhistische Denker behaupteten, jeder Gedanke sei völlig getrennt vom nächsten, der Geist also reine Vergänglichkeit.
Vācaspati (in der Tradition Vyāsas) hält dem entgegen, dass es sehr wohl eine Aneinanderreihung (krama) von Veränderungen gibt, die einen Zusammenhang bilden – sonst könnte man kein geordnetes Erleben, keine Kontinuität und kein zielgerichtetes Ende dieser Folge denken.
Patañjali definiert deshalb im folgenden Sutra (4.33) genauer, was mit der Abfolge gemeint ist: Zeit und Wandlung sind greifbar als Kette von Momenten, und man erkennt das Ganze erst retrospektiv am Ende der Sequenz. Diese Betonung der Erkennbarkeit des Wandlungs-Prozesses im letzten Moment ist auch eine philosophische Spitze gegen die radikale Momentlehre – sie sagt: Doch, es gibt eine Kette, die man sogar durchschauen kann, wenn man bis zum Schluss aufmerksam bleibt.
Für den Yogi bedeutet das praktisch: Im Moment der Befreiung blickt man auf den gesamten Fluss der Veränderungen zurück und durchschaut ihn in Gänze. Damit verliert er seine Macht. Die Kette reißt. Das Rad der Zeit steht still.
Bhoja: Yoga als Zustand vollkommenen Friedens
Der mittelalterliche Gelehrte König Bhoja (11. Jh.) kommentierte die Yoga-Sutren im Rāja-mārtāṇḍa und betonte insgesamt stark die mentale Dimension des Yoga. Für Bhoja bedeutet Yoga im Kern "völlige Ruhe des Geistes" – eine Zustandsbeschreibung des inneren Friedens. In diesem Licht versteht er auch Sutra 4.32: Wenn die Gunas ihren Dienst getan haben und sich nicht länger gegenseitig anstacheln, dann kehrt der Geist in seinen absolut friedvollen Urzustand zurück.
Bhoja legt Wert darauf, dass am Ende nicht Nichts bleibt, sondern Frieden. Es ist wie ein See, dessen Oberfläche vollkommen glatt wird: keine Wellen der Gedanken mehr, keine Windstöße der Leidenschaften, sondern klares, ungestörtes Sein. Das ist für ihn Yoga – und genau das passiert, wenn die Gunas in ihr Gleichgewicht zurücksinken. Bhojas Interpretation unterscheidet sich nicht grundsätzlich von Vyāsas, ist aber farbloser in metaphysischer Hinsicht: Er konzentriert sich weniger auf die ontologische Trennung von Purusha und Prakriti, sondern auf den erfahrbaren Zustand “völliger Geistesruhe”, den ein Jivanmukta (Befreiter) erreicht.
Andere klassische Kommentatoren wie Vijñāna Bhikṣu (16. Jh.) im Yoga-vārttika schließen sich dem Wesenskern an: Sobald Kaivalya (absolutes Alleinsein des Bewusstseins) erreicht ist, lösen die Gunas ihre Manifestation auf. Im darauffolgenden Sutra (4.34) beschreibt Patanjali ja ausdrücklich, dass die Gunas “in ihren Ursprung zurücksinken” (pratiprasava) und Purusha in seinem wahren Wesen ruht. Die klassischen Lehrer erläutern, dass dieser Rückzug in den Ursprung bedeutet: Die Naturkräfte verbleiben als Potential im Hintergrund (equilibrium), ohne noch einmal auszubrechen. Die Welt dreht sich für den Befreiten nicht mehr weiter. Aus seiner Sicht ist alles erledigt.
Interessant ist, dass keine der traditionellen Schulen hier einen Widerspruch sieht: Obwohl im Alltag die Gunas für alle Nicht-Erleuchteten natürlich weiterwirken, erlebt der verwirklichte Yogi keine zwanghafte Gunawirkung mehr. Aus seiner Perspektive ist das Spiel vorbei. Ob und wie die Welt an sich weiterexistiert, darüber schweigen die Yoga-Sutren.
Einige Kommentatoren, vor allem aus theistischen Richtungen, fügen jedoch die Idee hinzu, dass göttliche Gnade hier eine Rolle spielt: So war König Bhoja z.B. auch offen für die Auffassung, dass die Gnade Ishvaras (des Höchsten) dem Yogi den letzten Schritt erleichtert. So heißt es, der “Regenwolken-Samadhi” schenke wie eine Wolke göttlichen Regens die Frucht der Vollkommenheit – woraufhin alle Bemühung endet und die Natur zur Ruhe kommt. Egal ob man es nun als Gnade oder bloß als natürliches Geschehen ansieht – das Ergebnis ist identisch: die Natur hat ausgefunktioniert.
Neuspirituelle Auslegungen und zeitgenössische Gedanken
In modernen Kommentaren und Interpretationen wird Sutra 4.32 ebenfalls lebhaft diskutiert. Häufig versucht man, Brücken zur Psychologie oder anderen spirituellen Bildern zu schlagen, um den alten Text greifbar zu machen.
Ein Beispiel: Die Rudra Meditation-Schule verknüpft Patanjalis Aussage mit dem Symbol der Göttin Kālī – ein kreativer Versuch, den Vorgang mythisch zu veranschaulichen. Kālī, die schwarze Göttin, stehe hier für die Kraft der Illusion (Māyā) und der Zeit. Sie bringt durch die drei Gunas die ganze Welt in Bewegung – Kālī tanzt den Tanz der Schöpfung, kleidet die Seelen in verschiedene Körper und hüllt sie in Unwissenheit (Avidyā).
Doch dieselbe Kālī ist auch diejenige, die am Ende die Zeit “verschlingt”: Mit ihrem Schwert der Weisheit kappt sie den Kopf der Unwissenheit und beendet den Tanz. Das “Fließen der sukzessiven Veränderungen” – so nennt dieser Kommentar ausdrücklich die Aktivität der Gunas – wird von der göttlichen Mutter schließlich gestoppt.
Übrig bleibt Zeitlosigkeit, das wahre Selbst (Shiva-Bewusstsein) leuchtet auf, unverhüllt von der täuschenden Bewegung. – Diese Interpretation ist poetisch und etwas unorthodox für die nüchterne Yoga-Philosophie, aber sie stützt die Kernaussage des Sutra mit anschaulichen Bildern: Die Gunas sind wie Kālīs Energien, und im Zustand der Befreiung nimmt die göttliche Kraft ihnen den Antrieb; das Rad der Zeit kommt zum Stillstand, die Illusion der Veränderung löst sich auf.
Auch modernere Gurus und Autoren betonen oft den Aspekt der Erfahrung. Einige sagen vereinfacht: Wenn du alle Lektionen des Lebens gelernt hast, stellt das „Universum“ die Prüfung ein. In der Yoga-Welt ist es beispielsweise verbreitet, Sutra 4.32 so zu interpretieren: Solange deine Seele noch etwas erfahren oder begreifen muss, dreht sich das Rad – aber in dem Moment, wo wirklich alles erkannt ist, wird die Welt still. Dann gibt es nichts mehr zu erreichen, keinen Impuls mehr für weitere Gedanken, weitere Geburten. Diese Sicht deckt sich mit dem traditionellen Konzept von Karmas und Kleshas: Sämtliche Eindrücke und unbewussten Antriebe (Saṃskāras), sämtliche Leidenschaften und Unwissenheit (Klesha) sind im Zustand des dharma-megha-samādhi verbrannt. Nichts treibt einen mehr in neue Unruhe.
Manche neu-spirituellen Lehrer beschreiben diesen Endzustand fast paradox: Einerseits als Leere, andererseits als Fülle. Leer, weil alle Bewegung erloschen ist; voll, weil das Bewusstsein nun in seiner Ganzheit ruht. In dieser Leere/Fülle verschwinde auch das gewöhnliche Ich-Gefühl. Neuere psychologische Abhandlungen über Erleuchtung vergleichen es mit einem dauerhaften Bewusstseinswandel: Das Ich, das ständig etwas will und tut, tritt in den Hintergrund oder löst sich auf, und was bleibt, ist Weite, Frieden und Klarheit.
Parallelen in der Wissenschaft: Der Geist im „Ruhe“-Zustand
Spannend ist, dass selbst die moderne Neurowissenschaft anfängt, Phänomene zu untersuchen, die verblüffend an Patanjalis Beschreibung erinnern. In letzter Zeit gab es Studien über Meditierende, die es angeblich schaffen, ihr Bewusstsein zeitweise vollständig auszuschalten – einen Zustand, den die buddhistische Tradition „nirodha-samāpatti“ nennt, wörtlich das „Eintreten in die Aufhörung“. Ein in der Theravada-Lehre bekannter Meditationsmeister, Delson Armstrong, konnte beispielsweise berichten, dass er willentlich bis zu sechs Tage am Stück in einer Art tiefster Versenkung verweilen kann, ohne jegliche bewusste Wahrnehmung. Für Außenstehende wirkt er in diesen Perioden so reglos und still, dass man meinen könnte, er sei tot – doch grundlegende Vitalfunktionen laufen weiter, nur eben extrem verlangsamt und ohne bewusste Registrierung.
Wissenschaftler haben Armstrongs Gehirnströme per EEG gemessen, während er in diesen Ruhe-Zustand eintauchte. Das Ergebnis: Das Gehirn zeigte eine ungewöhnliche Desynchronisation seiner üblichen Aktivitätsmuster. Normalerweise arbeiten verschiedene Hirnregionen in koordinierten Netzwerken zusammen; im Zustand der vollständigen Versenkung aber brachen diese Synchronisationen weitgehend auseinander – vergleichbar mit dem Effekt mancher Anästhetika, jedoch nicht wie im normalen Schlaf. Man könnte sagen, das Gehirn fährt seine „Modellierung der Welt“ soweit herunter, dass kein kohärentes Bewusstsein mehr konstruiert wird. Es entsteht neurophysiologisch eine Lücke, eine Pause im bewussten Erleben – eben Nirodha, Aufhören.
Das wirklich Bemerkenswerte: Nach dem Wiederauftauchen aus dieser bewusstseinsfreien Tiefe berichten Praktizierende von einem „tiefgreifenden Reset“ ihres Geistes. Sie fühlen eine enorme mentale Klarheit, Erleichterung und Frieden. Belastende mentale Muster scheinen wie weggewischt, man startet sozusagen bei Null, aber mit vollem Bewusstsein. Erfahrene Yogis und Buddhisten sagen, dieser Zustand lösche latente Konditionierungen aus und schwäche die Anhaftungen weiter – was die Befreiung vorbereite.
Auch das passt verblüffend gut zu Patanjalis Behauptung, dass nach dem dharma-megha-samadhi alle Kleshas und karmischen Samen verbrannt sind. Die moderne Forschung liefert hier erste Indizien, dass es physiologisch plausible Korrelate zu so einem „Reset-Erlebnis“ gibt. Natürlich bewegen wir uns da in Grenzbereichen, doch der Brückenschlag ist verlockend: Das jahrtausendealte Versprechen, dass völlige innere Stille eine tiefgreifende Verwandlung bewirkt, erhält wissenschaftliche Untermauerung.
Auch abseits solcher Extremzustände kennen viele Meditierende kleinere Vorgeschmäcker dieser Erfahrung. In der eigenen Praxis mag man schon flüchtige Augenblicke erlebt haben, wo der Geist so still war, dass das Zeitgefühl aussetzte. Vielleicht in einem intensiven Retreat, in der Endentspannung nach einer langen Yogapraxis oder sogar spontan in der Natur: Sekunden, in denen nichts sich regt, keine Gedanken, keine Wünsche – ein Gefühl von vollkommener Gegenwart und Frieden.
Solche Momente, so kurz sie sein mögen, sind wie ein Blick durchs Schlüsselloch auf das, was Sutra 4.32 in endgültiger Form beschreibt. Praxisnähe heißt hier: Die Worte des Sutra sind nicht bloß abstrakte Metaphysik, sie verweisen auf erfahrbare Qualitäten – tiefe Stille, zeitlose Gegenwärtigkeit, vollständiges Aufgehobensein allen Strebens. Ein Yogalehrer könnte sagen: Stell dir den stillsten Moment deines Lebens vor und potenziere ihn ins Unendliche – dann ahnst du, was gemeint ist.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-32
Hier geht’s um YS 4.32 in der Praxis: Wenn der Zweck erfüllt ist, enden die Wandlungen der Guṇas.
Im Kern kannst du zwei Dinge üben:
- (1) erkennen, welche Guṇa gerade führt (Sattva – klar, Rajas – getrieben, Tamas – schwer) und
- (2) nicht mehr antriggert sein von ihrem Wechselspiel. Du hörst auf, der inneren Wetterkarte hinterherzurennen. Mit der Zeit entsteht eine stille, unangestrengte Gleich-Gültigkeit: Die Natur tut, was sie tut – du bleibst.
Beginne hiermit:
Stelle dir vor, was es bedeuten könnte, wenn die drei Gunas für dich aufhören.
Wie du die Sutra in der Meditation übst
Ziel: Den Geist nicht reparieren, sondern den Zweck erkennen – und ihn dann sein lassen.
So geht’s:
-
Sitz einnehmen, Rücken lang, Kinn minimal zurück.
-
Ankommen: 12 ruhige Atemzüge zählen (Ein 1–Aus 1 … Ein 12–Aus 12).
-
Guna-Scan: Frage dich alle paar Atemzüge: „Worauf läuft mein System gerade?“
-
Sattva: weit, freundlich, leise hell.
-
Rajas: zackig, zielig, leicht elektrisiert.
-
Tamas: dumpf, klebrig, schwer.
-
-
Erkennen statt Eingreifen: Sag innerlich: „Zweck erkannt – Unterricht läuft.“ Du tust nichts. Beobachte, wie die Qualität von selbst weiterwandert.
-
Schlusspunkt: Letzte 2–3 Minuten nur Hören: Geräusche kommen/gehen. Nichts festhalten. Das ist der Geschmack von „Wandlungen enden“ – nicht, weil du drückst, sondern weil du nicht mehr mitfährst.
Woran du merkst, das du in die Tiefe gehst: Der Atem wird länger, die Stirn glättet sich, Zeitgefühl verdünnt sich. Du spürst Gegenwart, nicht Leistung.
Wie du die Sutra im Alltag übst
Guna-Tagebuch – 7 Tage, 1 Zeile
Notiere abends drei Punkte:
- Dominante Guṇa heute?
- Ein Moment, in dem du nicht reagiert hast.
- Wo konntest du „Zweck erfüllt“ sagen?
Nach einer Woche siehst du Muster. Du wirst dadurch gewandter im Nicht-Mitspielen des Ego-Spiels.
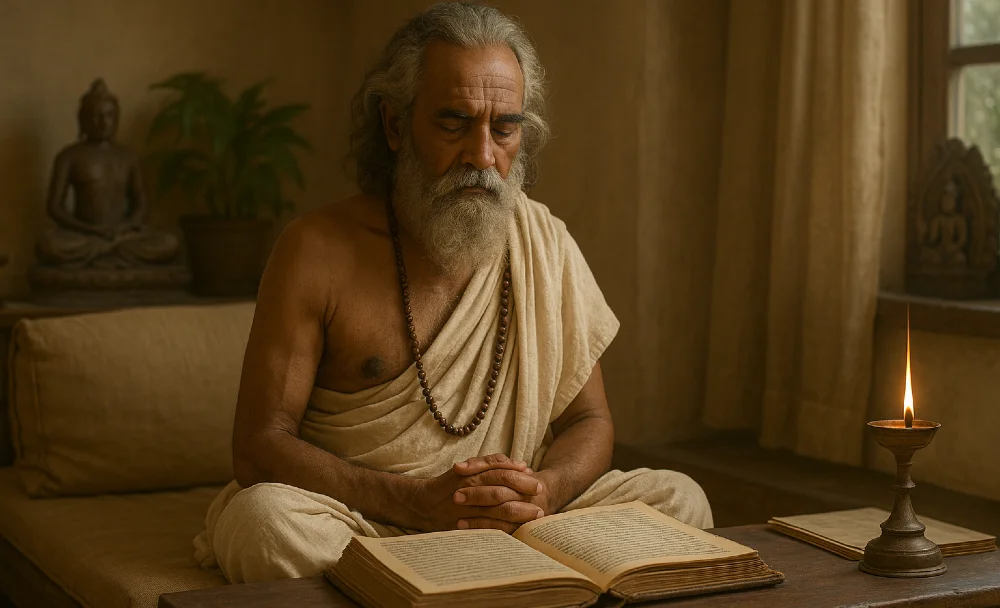
Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.32 – verständlich erläutert
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyasa schreibt:
„Infolge der "Wolke der Tugend" (samâdhi) erreichen die Guṇas ihr Ziel und ihre Abfolge der Umwandlung wird gestoppt. Denn wenn sie Erfahrung und Befreiung bewirkt haben und ihre Abfolge vollständig ist, können sie es nicht ertragen, auch nur für einen Augenblick zu bleiben."
Ausgangspunkt: Vyāsas Kommentar bezieht sich auf die Schlussphase des Yoga-Wegs: den dharma-megha-samādhi – wörtlich „Wolke der Tugend“. Gemeint ist ein besonders reiner, durchlässiger Samādhi kurz vor der endgültigen Befreiung.
Sinngemäße Erläuterung
Wenn die „Wolke der Tugend“ aufzieht – also dieser sehr klare Samādhi reift –, hat die Natur (prakṛti) ihren Zweck erfüllt: Sie hat dem Bewusstsein (puruṣa) Erfahrung ermöglicht und es zur Befreiung geführt. In genau diesem Moment kommt die Abfolge der Veränderungen der drei Guṇas (Sattva, Rajas, Tamas) zum Stillstand. Die Kräfte, die bisher alles Denken, Fühlen und Handeln bewegt haben, lassen ab – sie halten nicht einmal mehr einen Augenblick an der Erscheinung fest. Kurz gesagt: Das Getriebe der Natur legt den Gang heraus, weil nichts mehr zu bewirken ist.
Was Vyāsa damit sagt – in Klartext
-
„Wolke der Tugend“ (dharma-megha-samādhi): Ein Zustand, in dem Verdienste, Einsicht und Mitgefühl wie Regen niedergehen. Aus Praxis-Sicht: Ein Moment tiefen Genug-Seins – es fehlt nichts mehr.
-
Zweck erfüllt: Die Welt der Erscheinungen dient in der Sāṃkhya-Yoga-Sicht zwei Zielen: Erfahrung (bhoga) und Befreiung (apavarga/kaivalya). Sind beide erfüllt, haben die Guṇas keinen Auftrag mehr.
-
Ende der Abfolge: Die lückenlose Kette innerer Regungen (feine Guṇa-Wechsel) verstummt. Nicht durch Gewalt, sondern weil der Antrieb – Lernen, Erreichen, Sammeln – wegfällt.
-
Keine Restlaufzeit: Vyāsa betont die Radikalität: Die Guṇas „kümmern sich nicht einmal um einen Augenblick“ des Fortbestehens. Das bedeutet keine Vernichtung der Welt, sondern: Für den Befreiten verliert das Drängen der Natur seine Bindekraft.
Begriffe kurz erklärt
-
Guṇas: Grundqualitäten der Natur – Sattva (Klarheit), Rajas (Aktivität), Tamas (Schwere). Alles Körperliche/Mentale ist ihr Zusammenspiel.
-
pariṇāma-krama: Abfolge der Wandlungen – das „Einzelbilder-Flimmern“ unserer Erfahrung, das Zeitgefühl erzeugt.
-
bhoga & apavarga: Erfahrung & Befreiung – der Doppelsinn des Daseins in der Sāṃkhya-Yoga-Perspektive.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra II-18: Die wahrgenommenen Objekte sind aus den 3 Gunas mit den Eigenschaften Klarheit, Aktivität und Trägheit zusammengesetzt, bestehen aus Elementen und Wahrnehmungskräften – alles Wahrgenommene dient der sinnlichen Erfahrung und der Befreiung
Yoga Sutra II-19: Die Stufen der Eigenschaftszustände von den Grundbausteinen der Natur (den Gunas) sind spezifisch, unspezifisch, subtil-differenziert und undefinierbar.
Yoga Sutra II-21: Die Welt existiert nur für den Sehenden
Yoga Sutra II-22: Die Welt verschwindet für den, für den sie ihren Zweck erfüllt hat; für alle anderen existiert sie als gemeinsame Realität weiter
Yoga Sutra II-23: Der Sinn der (scheinbaren) Verbindung (Samyoga) unseres wahren Selbstes (Purusha) mit der äußeren Welt (Prakriti) besteht darin, dass wir unsere wahre Natur und deren Kräfte erkennen
Yoga Sutra II-24: Die Ursache dieser Verbindung (Samyoga) von wahrem Selbst und der äußeren Welt ist Unwissenheit (Avidya)
Yoga Sutra II-25: Wenn die Unwissenheit (Avidya) endet, löst sich die Verbindung (Samyoga) mit der äußeren Welt auf – dadurch erlangt der Sehende absolute Freiheit (Kaivalya)

Fazit: Wenn das Ziel erreicht ist, verstummt die Natur
Yogasutra 4.32 offenbart uns letztlich eine tröstliche und tiefsinnige Vision: Das Universum als Lehrer stellt seinen Unterricht ein, sobald der Schüler (das bewusste Selbst) gelernt hat, was es zu lernen gab. Die drei Gunas – jene Kräfte, die unser Dasein bunt, laut und bewegt gemacht haben – legen ihre Arbeit nieder, wenn wir zur inneren Ruhe gekommen sind. In klassisch-philosophischer Sprache heißt das: Prakriti hat ihrem Purusha gedient und zieht sich zurück. Was bleibt, ist Kaivalya, die Freiheit des Bewusstseins in seinem eigenen Wesen. Kein Zwang, keine Veränderung, kein Werden und Vergehen zwingen den befreiten Geist mehr.
Für Yoga-Praktizierende und Lehrende kann diese Sutra-Aussage enorm inspirierend sein. Sie erinnert daran, dass all unsere Mühen – die Disziplin auf der Matte, die Stunden in Meditation, die Selbstreflexion und Selbsterforschung – auf ein großes Ziel hinarbeiten: den Zustand völliger innerer Freiheit, in dem Unruhe für immer zur Ruhe geworden ist. Man könnte fast poetisch sagen: Ist die Reise vollendet, kommt auch der Wind zur Ruhe, der die Reisende trug.
Gleichzeitig steckt in der Formulierung eine gehörige Portion Demut und Staunen: Die Welt „verschwindet“ nicht, weil wir etwas erzwingen, sondern weil sie ihren Zweck von selbst erfüllt, wenn wir soweit sind. Es ist, als ob die Natur uns seit Anbeginn antreibt und formt und schließlich, beim Erwachen unseres Geistes, sanft die Hände von uns nimmt.
In diesem Sinne kann man Sutra 4.32 auch als kosmische Metapher lesen: Wenn wir unser Ziel erreichen, legt das Leben den Schalter um – vom Modus des Suchens und Werdens in den Modus des Seins.
Patanjalis nüchterne Aussage entpuppt sich bei näherem Hinsehen als hoffnungsvolle Botschaft: All das Kommen und Gehen, all die Unruhe hat ein Ende, und es dient einem guten Zweck. Die “drei Gunas” mögen uns ein Leben lang getrieben haben – doch schließlich führen sie uns an den Punkt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Dann dürfen sie gehen. Was bleibt, ist ein stilles, strahlendes Bewusstsein, verankert im eigenen Selbst – das eigentliche Ziel des Yoga.
Oder, um es mit einem Augenzwinkern zu formulieren: Wenn die Gunas ihren Dienst quittieren, hat der „Yogaschüler“ Feierabend – und das wahre Selbst kann endlich in den wohlverdienten Ruhestand treten. 🙏🏼
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-32
Dharma Megha Samadhi und Kaivalya – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 29 bis 34
Länge: 13 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Wiederherstellung des Gleichgewichts der Gunas – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.32
Länge: 7 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34
Länge: 95 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


