Hânam eshâm kleshavad uktam
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः
Mit dieser Sutra erhältst du eine Landkarte, wie du die letzten Fesseln des Geistes auflösen kannst. Wir erläutern das im Artikel durch klassische Kommentare, moderne Einsichten und praxisnahe Impulse. Hier findest du Klarheit darüber, was genau mit „Prägungen“ gemeint ist, wie die alten Meister sie verstanden haben – und wie du ihre Lehre im eigenen Geist erfahren kannst, mit Stille und Methode, nicht mit Idealismus. Denn jene letzten Fäden, die dich noch zurückhalten – sie sind lösbar.
Kurz zusammengefasst
- Methodische Analogie: Die letzten Samskaras (Eindrücke) werden mit denselben Praktiken gelöst wie die Kleśas. Der Weg zur Freiheit bleibt kohärent, von grob zu fein.
- Feuer der Erkenntnis: Durch ununterbrochene Viveka-Khyāti (Unterscheidungserkenntnis) „versengt“ man die Keimkraft vergangener Eindrücke, sodass sie keine Wirkung mehr entfalten.
- Eindrücke des Wissens: Auch die Rückstände des spirituellen Fortschritts bleiben zunächst bestehen, sind aber nicht hinderlich und lösen sich schließlich von selbst.
- Unterscheidungskraft festigen: Vācaspati Miśra betont, dass eine dauerhaft gefestigte Erkenntnis notwendig ist, damit Restimpulse gar nicht mehr entstehen.
- Finaler Zustand (Samadhi / Kaivalya): Bhoja spricht davon, dass bei idealem Zustand kein Gedanke mehr entstehen kann – die letzten Funken sind verglommen.
- Moderne Perspektiven: Neurowissenschaftliche Studien zu Neuroplastizität und Extinktionstheorie zeigen, dass das Gehirn durch gezielte Achtsamkeits- und Meditationspraxis neuronale Muster abschwächen kann.
- Praxisimpuls: Auch im Alltag – bei plötzlichen Gedanken oder Reaktionen – kannst du innerlich innehalten und bewusst loslassen; das ist das kleine „Feuer“ der Sutra im Hier & Jetzt.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Hanam, hânam, hāna = Beseitigung; Trennen; Aufgeben; Aufhören; Verlassen; Entsorgen; Loslassen;
- Esham, eshâm, eṣām = von diesen; dieser; von jenen;
- Klesha, kleśa = Bürden/Hindernisse auf dem spirituellen Weg; Gebrechen; Ursachen von Leiden;
- Kleshavat = wie die Kleshas; wie das der Leiden; wie die Belastung;
- Uktam = wurde beschrieben; besprochen; wie zuvor identifiziert; erwähnt;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Das vierte Kapitel (Kaivalya Pada) ist das Schlusskapitel des Yogasutra und behandelt die letzten Stadien der Befreiung – die völlige Unabhängigkeit des Bewusstseins (Kaivalya).
Patanjali beschreibt, wie außergewöhnliche Fähigkeiten (siddhis) und subtile Erkenntnisse entstehen, aber auch, dass sie nicht das Ziel, sondern Nebenprodukte spiritueller Reifung sind. Der Yogi soll sie mit Gleichmut betrachten, denn jede Bindung an sie hält ihn an das Wirkungsgefüge von Ursache und Wirkung gebunden. Entscheidend ist die Erkenntnis des Unterschieds zwischen Purusha (dem reinen Bewusstsein) und Prakriti (der materiellen Natur).
Im weiteren Verlauf zeigt Patanjali, wie das Bewusstsein, das durch Erkenntnis gereinigt wurde, immer stiller wird. Alte Prägungen (saṃskāras) tauchen nur noch gelegentlich auf, sobald Wachsamkeit nachlässt (4.27). In 4.28 schließlich wird erklärt, dass diese letzten feinen Eindrücke auf dieselbe Weise beseitigt werden, wie zuvor die Kleshas (geistigen Trübungen) – durch beständiges Unterscheiden (viveka-khyāti) und Losgelöstheit (vairāgya). Damit ist der Übergang zu den letzten Sutras vorbereitet, die das völlige Aufgehen des Geistes in Freiheit (Kaivalya) beschreiben.
| Abschnitt Nr. | Inhalt / Thema | Kernaussage |
|---|---|---|
| 4.1 – 4.3 | Entstehung übernatürlicher Fähigkeiten (siddhis) | Siddhis entstehen aus Geburt, Kräutern, Mantras, Askese oder Meditation – sie sind Begleiterscheinungen des Yoga, nicht sein Ziel. |
| 4.4 – 4.6 | Natur des Geistes und seiner Vielheit | Der Geist ist vielfältig, aber vom einen Bewusstsein (Purusha) erleuchtet. Jeder Gedanke hat seine eigene Spur (vṛtti, saṃskāra). |
| 4.7 – 4.11 | Karma, Eindrücke und Wiedergeburt | Handlungen hinterlassen Eindrücke, die zukünftige Erfahrungen bedingen. Befreiung bedeutet das Ende dieser karmischen Kette. |
| 4.12 – 4.17 | Zeit, Wahrnehmung und das Objektive | Zeit ist eine Folge geistiger Veränderungen. Dinge existieren unabhängig vom Wahrnehmenden, erscheinen jedoch verschieden nach Bewusstseinszustand. |
| 4.18 – 4.22 | Selbstwahrnehmung und Bewusstheit | Das Bewusstsein (Purusha) ist unveränderlich; der Geist kann sich selbst und andere Objekte nur durch seine Spiegelung darin erkennen. |
| 4.23 – 4.26 | Erkenntnisprozess und Läuterung des Geistes | Der Geist reflektiert Purusha und die Welt. Durch fortgesetzte Unterscheidung (viveka) wird er transparent und reiner. |
| 4.27 – 4.28 | Letzte Störungen und Auflösung der Prägungen | Selbst nach tiefer Erkenntnis können alte Eindrücke auftauchen; ihre Beseitigung geschieht wie bei den Kleshas – durch Erkenntnis und Nicht-Anhaften. |

Yogasutra 4.28 – die Beseitigung der Prägungen
Yogasutra 4.28 lautet sinngemäß: “Die Beseitigung dieser Eindrücke erfolgt so, wie die der Kleśas (Leidursachen) beschrieben wurde.” Damit knüpft Patanjali an vorherige Sutren an. Wir befinden uns im vierten Kapitel (Kaivalya Pada), das von den letzten Stufen auf dem Weg zur Inneren Freiheit handelt. In Sutra 4.27 wurde beschrieben, dass selbst in hohen meditativen Zuständen gelegentlich andere Gedanken auftauchen – Überbleibsel früherer mentaler Prägungen (saṃskāras). Sutra 4.28 liefert die beruhigende Antwort: Diese letzten, subtilen Eindrücke können auf die gleiche Weise überwunden werden, wie bereits die großen Ursachen des Leidens (die Kleśas) überwunden wurden.
Anders formuliert: Auch wenn ein Yogi schon sehr weit gekommen ist und die klare Unterscheidung (viveka) zwischen dem Selbst und den flüchtigen Bewusstseinsinhalten nahezu stetig präsent ist, können in kleinen „Lücken“ der Achtsamkeit noch alte Gedankenmuster aufblitzen. Das Sutra erinnert daran, dass man diese störenden Rest-Gedanken genauso behandeln soll wie frühere grobstoffliche Leiden: durch die Werkzeuge des Yoga – insbesondere die Meditation und das Licht der Erkenntnis. Im Grunde sagt Patanjali hier: Weiterüben! Es ist der letzte Feinschliff auf dem Weg zur völligen Freiheit des Geistes.
Schlüsselbegriffe: Kleśa und Saṃskāra
Um die Sutra zu verstehen, müssen wir ihre Schlüsselwörter klären. Patanjali spricht von „diesen Eindrücken“ und vergleicht sie mit den Kleśas.
- hānam (हानम्) – Beseitigung, Auflösung, das Lassen
Das Wort hāna kommt von der Wurzel √hā, „lassen, loslassen, aufgeben“. Es bedeutet nicht das aggressive „Ausmerzen“, sondern das Nachlassen, das natürliche Verschwinden einer Kraft, die keine Nahrung mehr bekommt.
In der Yogapsychologie ist hānam damit kein Kampfbegriff, sondern eher ein Prozess des Entziehens: Du gibst einer Gewohnheit keine Energie mehr, sie trocknet aus. Vyasa beschreibt es als das „Verlöschen durch Nicht-Ernährung“.
Man könnte auch sagen: hānam ist das Gegenteil von Festhalten – das aktive Nicht-Tun, das letztlich jede Fixierung löst. - eṣām (एषाम्) – dieser (Prägungen)
Grammatikalisch ist es der Genitiv Plural – „von diesen“.
Aber wer oder was sind „diese“? Patanjali verweist auf die „anderen Gedanken“ (anya-vṛtti) des vorangehenden Sutra 4.27: jene letzten feinen Bewegungen des Geistes, die aus alten saṃskāras stammen.
Eṣām meint also die Restprägungen, die noch aufsteigen, wenn der Yogi bereits weitgehend frei ist.
Mit diesem unscheinbaren Wort erinnert Patanjali daran, dass Befreiung kein binäres Ereignis ist („gebunden“ oder „erleuchtet“), sondern ein Prozess, in dem sich Schichten um Schichten lösen. - kleśavat (क्लेशवत्) – „wie die Kleshas“
Das Suffix -vat bedeutet „ähnlich wie“, „in gleicher Weise wie“.
Damit zieht Patanjali eine klare Parallele: Die Methode, mit der man Kleshas überwindet, gilt auch für die feineren Samskaras. Siehe nächster Abschnitt.
Hier steckt zugleich eine subtile Mahnung:
Wer meint, die Arbeit sei getan, nur weil die großen Leiden (Kleshas) besiegt sind, irrt. Auch der Rest – die feinen Eindrücke, die noch Spuren von Identifikation enthalten – muss „wie Kleshas“ behandelt werden. - kleśa (क्लेश) – Leid, Trübung, affektive Störung
Etymologisch kommt es von der Wurzel √kliś, „peinigen, quälen, plagen“.
Im Yoga sind Kleshas die Grundtrübungen des Geistes, die alles Leiden hervorbringen, mehr dazu ebenfalls im nächsten Abschnitt. - saṃskāra (संस्कार) – Eindruck, Prägung, Gewohnheitsspur
Wörtlich: das, was „gut geformt“ oder „zusammengefügt“ wurde – von sam-√kṛ, „zusammen-machen“. Saṃskāra (संस्कार) kann man hier mit Eindruck, Prägung oder latente Spur übersetzen. Gemeint sind die im Unterbewusstsein gespeicherten Eindrücke vergangener Handlungen, Erfahrungen und Gedanken, die unser Verhalten und Erleben weiterhin beeinflussen. Sie sind erst einmal neutral; sie können zur Unwissenheit führen oder zur Befreiung beitragen, je nachdem, womit sie gespeist werden.
Ein weiterer wichtiger Begriff im Kommentar zu 4.28 ist Viveka-khyāti, die ununterbrochene unterscheidende Erkenntnis. Damit ist die klare Wahrnehmung der Unterscheidung zwischen dem wahren Selbst (Purusha) und den Vorgängen der Natur (Prakriti) gemeint. Diese Erkenntnis ist das „Feuer“, von dem es heißt, es könne die Keime der Eindrücke ausbrennen. Sobald die Erkenntnis der Wahrheit lückenlos etabliert ist, verliert jeder falsche Eindruck seine Kraft. Die Praxis zielt also darauf ab, diese lückenlose Klarheit zu erlangen, sodass keine unbewussten Prägungen mehr dazwischenfunken können.
Die verschiedenen Übersetzungen dieser Sutra weichen inhaltlich kaum voneinander ab. Manche betonen die Analogie zu den Kleśas, andere referenzieren die entsprechenden Textstellen. Grundlegend unterschiedliche Deutungsarten gibt es hier nicht – Patanjalis Aussage ist ziemlich eindeutig. Unterschiede finden sich eher im Stil: ob von „Überwindung“, „Beseitigung“ oder „Abtöten“ der Eindrücke die Rede ist, ob diese Eindrücke als Störgedanken, Vorurteile oder neutral als latente Samskaras benannt werden. All das meint letztlich dasselbe: Diese letzten Spuren im Geist werden durch die gleiche yogische Praxis unschädlich gemacht, mit der man bereits die großen Leiden bezwungen hat.
Samskaras werden wie die Kleshas überwunden
Man könnte Samskaras als mentale Gewohnheitssamen beschreiben: Jeder Gedanke und jede Handlung pflanzt so einen „Samen“ ins Chitta (das Geistfeld), der später unter passenden Bedingungen wieder keimen kann – als neuer Gedanke, Impuls oder Reaktion. Im Kontext von Yogasutra 4.28 sind mit „diesen Eindrücken“ jene übrig gebliebenen Saṃskāras gemeint, die trotz fortgeschrittener Einsicht noch vorhanden sind und sporadisch störende Gedanken (pratyaya antarāṇi) erzeugen. Sie sind gewissermaßen die allerletzten mentalen Restprogrammierungen, die einen vom völligen Kaivalya (Befreiung) trennen.
Diese unterbewussten Eindrücke können vom Yogi genauso überwunden werden wie die Kleshas, die fünf Leiden. Iyengar vergleicht dieses Überwinden mit dem Ausgehen eines Feuers: der Yogi vermeidet es, Holz nachzulegen, so dass es langsam von selbst erlischt.
Die 5 Kleshas: Bürden, Ursache der Leiden
Diese Kleśas gelten als tief verwurzelte „Färbungen“ oder Prägungen des Geistes, die zu immer neuen leidvollen Erfahrungen führen. Das Entscheidende: Kleshas sind nicht bloß „Fehler“, sondern psychische Dynamiken, die sich selbst verstärken. Moderne Psychologen würden von emotionalen Schemata sprechen.
- Avidya – Unwissenheit oder Verwechslung, Verkennen der Wirklichkeit
Sie gilt als Mutter aller Kleshas, da aus Unwissenheit viel Leid entsteht.. - Asmita – Egoblaube
Ich-Verhaftung, das Gefühl „Ich bin der Handelnde“. Hierbei geht es um den nach yogischer Lehre irrigen Glauben, ein individuelles, begrenztes und sterbendes Wesen zu sein. Die Identifikation mit etwas, was NICHT unser wahres Selbst ist. - Raga – die Gier
Anhaften an Lustvolles, das zwanghafte „Ich will mehr“. Das Streben nach sinnlichen Erlebnissen: Wunsch, Verlangen, Begierde oder Sehnsucht etc. Habenwollen - aber auch Ablehnung von Dingen und Geschehnissen in unserem Leben: - Dvesha – Abneigung
Abneigung, Ablehnung des Unangenehmen. Unsere geistige Abwehr gegen für unschön eingestufte Erlebnisse und Erfahrungen. - Abhiniveshah – die Wurzel der Angst: das Anhaften am Leben
Angst vor dem Ende, der Drang, sich festzuhalten. Gemeint ist das Anhaften an der körperlichen Existenz. Hiervon soll selbst große Yogameister kaum lassen können. Abhinivesha gehört zu unseren tiefsten Instinkten.
Sutras zu den Kleshas. TAG muss ergänzt werden.
Wie werden die Kleshas überwunden?
Patanjali beschreibt im zweiten Kapitel (2.10–2.11), wie sie durch Meditation und Rückführung an ihren Ursprung (pratiprasava) aufgelöst werden.
Yoga Sutra II-10: Die subtilen Formen [der Kleshas, der schmerzbringenden Hindernisse] können überwunden werden, indem man sie zu ihrem Ursprung zurückführt
Über diese Worte wird bei den Kommentatoren des Yogasutra viel diskutiert. Die naheliegenste Auslegung besteht darin, jeweils nach dem ersten Auftreten bzw. der ursprünglichen Motivation zu forschen, sobald sich ein Klesha zeigt.
Yoga Sutra II-11: Die aktiven bzw. gröberen Formen (der Kleshas) werden durch Meditation überwunden
Laut Govindan und anderen sind auch folgende Sutras hilfreich bei der Überwindung der Kleshas:
Yoga Sutra II-1: Strenge Übungspraxis, Selbststudium und Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal) – das ist der Kriya-Yoga
Yoga Sutra II-2: Der Kriya Yoga vermindert die Leiden des Yogi und führt zu Samadhi
Yoga Sutra II-26: Die Entwicklung und ununterbrochene Anwendung einer reinen Unterscheidungskraft (Viveka) beendet die Unwissenheit
Rainbowbody: „Die Entstehung von Kleshas wird beseitigt, wenn ihr Entstehungsprozess erkannt und aufgegeben wird. … Entferne das Samskara und die Kleshas sind beseitigt.”
Dann folgt ...
Yoga Sutra IV-30: Dann folgt das Ende aller Leiden und des Karma
Yoga Sutra IV-31: Mit den Ende aller Verschleierungen und Unreinheiten erlangt der Yogi unendliche Erkenntnis und alles bisher – als normaler Mensch – Gewusste wird als winzig und unbedeutend erkannt
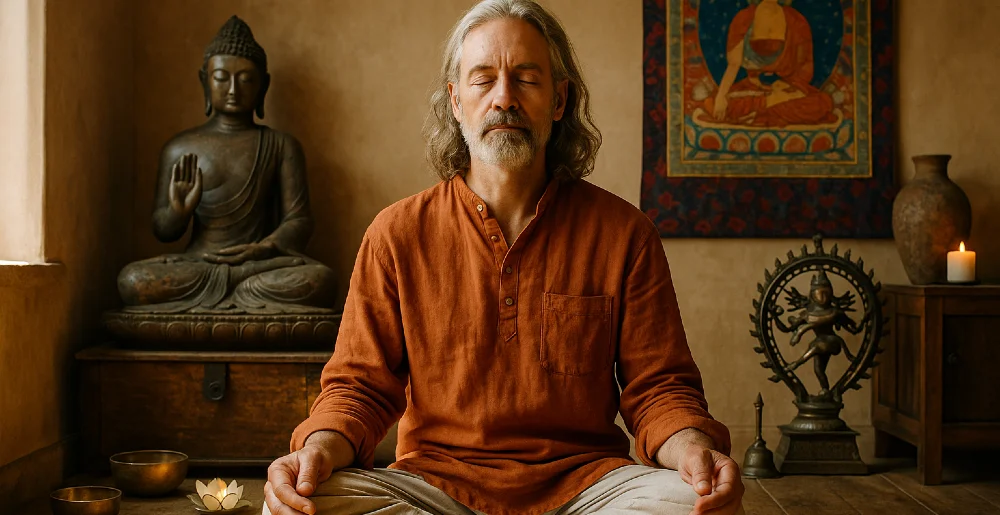
Klassische Kommentare: Von Vyāsa bis Bhoja
Die alten Meisterkommentare zu Yogasutra 4.28 liefern tiefe Einblicke, teils mit blumigen Vergleichen und feinen philosophischen Nuancen. Schauen wir uns an, wie bedeutende klassische Kommentatoren diese Sutra auslegen:
Vyāsa (ca. 5. Jh.): Als Verfasser des ältesten Yoga-Bhāṣya bildet Vyāsas Erklärung die Grundlage für alle späteren Kommentatoren. Zu 4.28 betont er das Bild vom verbrannten Samen: So wie die Kleśa-Leiden nicht mehr austreiben können, nachdem ihre Keimkraft durch das Feuer der Erkenntnis versengt wurde, können auch die angesammelten Energien früherer Eindrücke keine neuen Gedanken mehr gebären, wenn ihre Keimkraft durch das Feuer des Wissens verbrannt ist. Mit „Feuer des Wissens“ meint Vyāsa die lodernde Klarheit der unterscheidenden Erkenntnis (viveka), die jeden Samen der Unwissenheit zerstört. Interessanterweise fügt er hinzu, dass die Eindrücke der Erkenntnis selbst (also die Spuren, die das gewonnene Wissen hinterlässt) vorerst weiter bestehen, bis der Geist seine Aufgabe erfüllt hat. Sie stellen aber kein Problem dar und werden vom Kommentator “nicht weiter berücksichtigt” – denn diese letzten sattvischen (reinen) Eindrücke tragen nicht mehr zum Leid bei, sie sind vielmehr Ausdruck einer bereits weitgehend gereinigten Psyche. Mit anderen Worten: Hat das Feuer der Wahrheit einmal alle Unkrautsamen verbrannt, bleiben vielleicht noch Aschereste übrig, aber die brennen nicht mehr und können kein neues Unkraut schlagen.
Vācaspati Miśra (9. Jh.): In seinem Kommentar Tattva-Vaiśāradī vertieft Vācaspati die Dynamik der Gedankenrückstände. Er fragt zunächst ausdrücklich: Selbst wenn schon Unterscheidungswissen da ist – warum tauchen denn überhaupt noch andere Gedanken auf, und wie entfernt man sie endgültig, so dass sie nie wieder erscheinen? Seine Antwort: Solange die Erkenntnis (viveka-khyāti) noch nicht felsenfest etabliert ist, schlummern die latenten Tätigkeitsimpulse weiter im Hintergrund. Sie sind wie Glutnester, die gelegentlich aufflackern. Erst wenn die Erkenntnis voll durchdrungen ist, werden diese „anderen Gedanken“ restlos zerstört und können kein neues Leben mehr erlangen. Ursache dafür ist – wieder – das Brennen der Samen durch das Feuer der Erkenntnis. Vācaspati beschreibt regelrecht einen Kettenprozess der Eindrücke:
Die Rückstände der weltlichen Tätigkeit (alte saṃskāras) werden durch die entgegengesetzten Rückstände der Erkenntnis in Schach gehalten. Und die Rückstände der Erkenntnis wiederum werden durch die Kräfte der völligen Verinnerlichung (nirodha-śakti) zur Ruhe gebracht.
Damit spielt er auf den fortschreitenden meditativen Vertiefungsprozess an: Jeder meditative Nirodha-Zustand (das „Zur-Ruhe-Bringen“ aller Gedankenwellen) hinterlässt ebenfalls einen Eindruck – nämlich einen Samskara der Ruhe. Diese feinen Eindrücke der Meditation neutralisieren die alten Unruhe-Eindrücke.
Ganz witzig: Der Yogi benutzt also zunächst gewissermaßen einen guten Samskara, um einen schlechten zu beseitigen!
Vācaspati Miśra bezeichnet die verbleibenden Wissens-Samskaras deshalb poetisch als Keime einer höheren Wunschlosigkeit. Sie ziehen den Geist nicht mehr nach außen zu Sinnesobjekten, sondern halten ihn nach innen ausgerichtet. Sobald jedoch auch diese allerletzten, subtil positiven Eindrücke ihre Aufgabe erfüllt haben, erlöschen sie von selbst. Zurück bleibt ein absolut klarer, unbeweger Geist. Dieser Zustand wird dann in der nächsten Sutra als Dharma-megha-Samādhi beschrieben – der Samadhi, in dem alle Verdienste wie aus einer Wolke herabregnen und der Geist nichts Eigenes mehr begehrt.
Neben diesen Auslegungen haben auch andere Kommentatoren ähnliche Erläuterungen geliefert. Vijñāna Bhikṣu (16. Jh.) etwa, ein Vedanta-Gelehrter, interpretiert die Sutra im Lichte der Einheit von Purusha und Brahman und betont, dass letztlich Gotteserfahrung bzw. die Erkenntnis des wahren Selbst alle Samskaras verbrennt – eine Sichtweise, die die Bhakti-Note hinzufügt. Hariharānanda Āraṇya (20. Jh.) bestätigt in seinem berühmten Werk Yoga Philosophy of Patañjali, dass die durch Wahrheitswissen erzeugten Eindrücke stärker sind als die alten Gewohnheitsmuster und diese allmählich überschreiben. Er gebraucht das Beispiel eines angezündeten Räucherstäbchens: Der Duft der Wahrheit durchdringt den Geist so sehr, dass der alte Geruch verfliegt; schließlich erlischt auch der Räucherstäbchen-Duft (das Wissen selbst löst sich auf), und zurück bleibt geruchlose Klarheit. Alle klassischen Stimmen laufen also auf einen Kern hinaus:
Erst überdeckt Wissen die Unwissenheit – und am Ende braucht es weder Wissen noch Unwissenheit, nur noch Sein.
Praxisbezug und moderne Perspektiven
Theorie schön und gut – doch wie fühlt sich das an und was bedeutet es für die Yogapraxis? Man stelle sich vor: Du hast in tiefer Meditation Momente reiner Stille und Klarheit erlebt. Du glaubst, die alten Muster – Angst, Ärger, Gier – weitgehend gemeistert zu haben. Und dann, an einem schlechten Tag, taucht plötzlich doch wieder ein uralter Impuls auf: ein Anflug von Eifersucht vielleicht, oder ein irrationaler Angstgedanke. Fast möchte man verzweifeln: Warum meldet sich das jetzt noch? – Patanjali hätte wahrscheinlich gelassen gelächelt. Solche Momente sind normal auf dem Yogaweg. Diese letzten Samskaras sind wie die Glut unter der Asche: kaum sichtbar, aber noch da.
Die klassischen Lehrer raten: Geh genauso damit um, wie du es mit größeren Problemen geübt hast. Bleib achtsam, identifiziere dich nicht mit dem Gedanken, lass ihn kommen und gehen. Jeder dieser flüchtigen Eindrücke wird schwächer, wenn du ihm die Aufmerksamkeit entziehst und statt dessen im Licht der Unterscheidung verweilst. Es ist, als würde bei jedem Aufflackern sofort eine Portion Wasser darüber gegossen – zisch, und weg.
Ein klassisches Bild dafür: oben angesprochene geröstete Samen. Ungeröstete Samskara-Samen können jederzeit wieder ausschlagen und neues Karma hervorbringen. Doch wenn man sie röstet – in der Flamme der Yoga-Praxis und Erkenntnis – verlieren sie ihre Keimfähigkeit. Genau das bestätigt Yogasutra 4.28.
In moderner Sprache könnten wir sagen: Durch wiederholtes bewusstes Nicht-Reagieren auf einen Reiz werden die neuronalen Verknüpfungen, die diesem Reiz seine Macht geben, immer schwächer. Neurowissenschaftler sprechen hier von neuroplastischen Veränderungen. Was nicht genutzt wird, stirbt ab – das gilt auch für die Autobahnen im Gehirn, auf denen unsere Angst- oder Wutreaktionen rasen.
Meditation und achtsames In-sich-Hinein-Spüren ermöglichen es dem Gehirn, sich umzustrukturieren: Studien zeigen, dass schon acht Wochen Achtsamkeitstraining die Dichte der Amygdala (unseres „Angstzentrums“) vermindern können – korreliert mit geringerem Stressempfinden. Die Reaktivität auf Auslöser sinkt, während Verbindungen zum präfrontalen Cortex (Sitz der Vernunft) gestärkt werden. Anders gesagt: Was früher sofort einen Flächenbrand der Emotion auslöste, erzeugt nun vielleicht nur noch ein kurzes Aufflackern – oder gar nichts mehr. Die Angst-Klesha Abhiniveśa verliert ihren Stachel, wenn die entsprechenden neuronalen Muster durch Achtsamkeit immer wieder ins Leere laufen.
Interessanterweise hat die Psychologie für das „Unschädlichmachen“ alter Angstreaktionen einen Begriff: Extinktion. Damit ist gemeint, dass eine konditionierte Reaktion gelöscht wird, wenn der Auslöser wiederholt auftritt, ohne dass die gewohnte Konsequenz folgt. Ein Beispiel: Wenn jemand Angst vor Hunden hat (weil er vielleicht einmal gebissen wurde), kann durch behutsame, wiederholte Begegnung mit harmlosen Hunden die Angstreaktion ausgelöscht werden. Neuere Forschung zeigt, dass Achtsamkeitsmeditation diesen Extinktionsprozess sogar beschleunigen und stabilisieren kann. In einem Experiment ließ man Probanden Angstkonditionierungen (leichte Schocks nach bestimmten Bildern) wieder „verlernen“. Jene, die vier Wochen lang täglich meditiert hatten, behielten das Gelernte (nämlich dass keine Gefahr mehr droht) deutlich besser bei als Nicht-Meditierende – die Furcht kehrte bei den Meditierenden am nächsten Tag nicht zurück. Das klingt ganz danach, was Patanjali verspricht: Durch stetige Übung formt sich der Geist so um, dass selbst tiefsitzende „eingebrannte“ Reaktionen nicht mehr automatisch hochkommen. Die Samen sind verbrannt und können nicht mehr sprießen.
Für die Yogapraxis bedeutet das Sutra äußerst praktische Ermutigung: Jede Meditation, jede bewusste selbstreflektierte Handlung zählt. Selbst wenn du glaubst, es geht nichts mehr voran, laufen im Verborgenen Prozesse ab – alte Muster werden langsam entmachtet. Anfangs mag es sich zäh anfühlen wie das Unkrautjäten auf einem großen Feld. Doch mit jeder Runde wird der Boden reiner. Die klassischen Lehrer versichern uns, dass am Ende tatsächlich ein Zustand wartet, wo nichts mehr von alleine hochkommt. Dieser Zustand ist nicht kalt oder leer – er ist voll Präsenz ohne Zwang. Im Yoga-Vokabular heißt er nirbīja samādhi, der samenlose Geisteszustand, in dem alle Eindrücke, selbst die guten, zur Ruhe gekommen sind. Patanjali beschreibt ihn als Freiheit, als ursprünglichen Frieden.
Zum Schluss sei betont: „Genauso wie die Kleśas“ bedeutet, dass wir die gleichen Werkzeuge anwenden sollen, die uns schon bei größeren Leiden geholfen haben. Dazu gehören insbesondere die Prinzipien aus Kriyā-Yoga (Yoga der Handlung: Selbstdisziplin, Selbststudium, Hingabe) und die Praxis der acht Glieder des Yoga (Aṣṭāṅga), wie Patanjali sie im 2. Kapitel darlegt. Durch ethisches Leben, Körper- und Atemübungen, vor allem aber durch Konzentration, Meditation und tiefste Versenkung (samādhi) verfeinert sich unser Geist immer weiter. Die alten Yogis versichern, dass letztlich sogar die Samādhi-Erfahrung selbst – so erhebend sie ist – losgelassen wird, wenn alle Eindrücke entschwunden sind. Was bleibt, ist ein Bewusstsein, das sich selbst genügt, frei von Getriebenheit.
Yogasutra 4.28 mag technisch formuliert sein, doch es enthält einen tröstlichen Kern: Kein noch so hartnäckiger Eindruck muss für immer an uns haften. Mit dem gleichen Mut und der gleichen Geduld, mit der wir unseren großen Leiden begegnet sind, können wir auch die feinsten Schatten im Geist auflösen. Wie ein Meister-Gärtner hat der Yogi bereits die Dornen und Disteln beseitigt und kümmert sich nun um die unscheinbaren Schösslinge, die hier und da nachwachsen. Mit Achtsamkeit und Wissen als Werkzeuge werden auch diese entfernt – bis der Geist einem klaren, stillen See gleicht, in dem sich der reine Himmel des Selbst unverzerrt spiegelt.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-28: wie du die Sutra erfahren kannst
Vielleicht kennst du diesen Moment: Du sitzt in Meditation, atmest ruhig, alles ist klar. Und plötzlich kommt aus dem Nichts ein Gedanke hereingeschneit – ein alter Ärger, ein Geruch, eine Erinnerung, ein kleines, störrisches Ich will aber!. Genau das ist das Terrain von Sutra 4.28. Sie spricht davon, dass die letzten Prägungen, die Samskaras, nach und nach verschwinden – wenn du mit ihnen so umgehst, wie du gelernt hast, mit den Kleshas (den großen Geistesstörungen) umzugehen: durch Achtsamkeit, Erkenntnis und Nicht-Anhaften.
Klingt abstrakt? Dann lass uns das übersetzen in Meditationssprache und Alltagssprache.
In der Meditation – der feine Tanz zwischen Wahrnehmen und Nicht-Mitspielen
Wenn du sitzt, beobachtest du, was auftaucht: Gedanken, Bilder, Körperempfindungen. Und dann – manchmal ganz subtil – tauchen vertraute Muster auf. Vielleicht ein Gedanke wie: „Ich müsste besser meditieren.“ Oder: „Heute ist es besonders ruhig, ich bin wirklich weit gekommen.“
Beides sind Restprägungen – Überbleibsel von „Ich“-Bezogenheit, von Gewohnheit, zu werten, zu greifen, festzuhalten.
Die Übung? Erkenne sie, ohne mit ihnen zu tanzen.
Sag innerlich: „Ah, da bist du wieder, alter Reflex.“ Dann lass ihn durch dich hindurchziehen wie eine Wolke. Kein Drama, kein Kampf, kein „Ich darf das nicht denken“. Nur: sehen – und loslassen.
Das ist das hānam der Sutra: das „Loslassen durch Nicht-Füttern“.
Du entziehst dem alten Gedanken schlicht die Bühne. Er verliert Energie, wenn du ihn nicht aufführst.
Es ist kein heroischer Akt, eher eine ruhige, entschlossene Weigerung, den alten Mustern wieder Aufmerksamkeit zu schenken.
Je tiefer deine Stille wird, desto feiner werden diese Eindrücke. Anfangs sind es grobe Dinge: Ärger, Stolz, Eitelkeit. Später werden sie hauchdünn: der subtile Stolz auf die eigene Ruhe, die Sehnsucht, dass es „so“ bleibt.
Genau da wirkt die Sutra: Sie erinnert dich, selbst spirituelle Gewohnheiten nicht zu heiligen. Alles darf vergehen – auch das Gute.
Ein konkreter Übungsimpuls:
Wenn du bemerkst, dass du etwas festhalten willst (eine angenehme Empfindung, einen meditativen Zustand), bleib ganz still. Spür das Festhalten. Spür die Bewegung, die greifen will. Dann: entspann sie. So übst du das „hānam“, das subtile Loslassen, mitten im Moment.
Im Alltag – kleine Erleuchtungen zwischen Spülbecken und Büro
Die gleiche Mechanik funktioniert außerhalb der Meditation – nur sind die Bühnen lauter.
Im Alltag heißt Samskara: „Ich reagiere, bevor ich denke.“
Eit nutzen altbekannte Beispiele:
- Jemand kritisiert dich, und bevor du bewusst atmest, rechtfertigst du dich schon.
- Du scrollst auf dem Handy, obwohl du eigentlich Pause machen wolltest.
- Du bist freundlich, aber innerlich erwartest du Dank oder Anerkennung.
All das sind Konditionierungen – kleine Roboterprogramme, die im Kopf wohnen.
Sutra 4.28 lädt dich ein, diese Programme nicht zu bekämpfen, sondern zu durchschauen.
Wenn du merkst, dass du automatisch reagierst, halte kurz inne.
Atme. Spür den Körper. Und dann – handle bewusst. Oder gar nicht.
Zum Beispiel:
Du wirst getriggert. Sag innerlich: „Das ist ein alter Reflex. Ich muss ihn nicht füttern.“
Vielleicht atmest du zwei Sekunden länger. Vielleicht sagst du einfach nichts.
Dieser Moment der Nicht-Aktion ist ein Akt spiritueller Reinigung.
Kein großes Feuerwerk, kein Mantra, kein Lotusblütenduft.
Nur du, ein Atemzug – und die Entscheidung, nicht mitzuspielen.
So übst du die Sutra mitten im Leben. Und ja, das fühlt sich manchmal unbequem an – so, als würdest du gegen die Strömung schwimmen.
Aber mit der Zeit wird’s leichter. Alte Reiz-Reaktions-Ketten verlieren ihre Klebkraft.
Ein Gedanke kommt – aber er „besitzt“ dich nicht mehr. Eine Emotion flammt auf – aber sie verbrennt nichts mehr.
Das innere Labor
Wenn du magst, kannst du diese Übung als ein Experiment betrachten:
- Beobachte: Welche Situationen holen dich aus der Ruhe?
- Erforsche: Welches Bedürfnis liegt dahinter (gesehen werden, recht haben, sicher fühlen)?
- Übe: Innehalten, atmen, nicht reagieren – oder bewusst neu reagieren.
Siehe jede Störung im Aussen als Gelegenheit an, Gleichmut zu üben, innere Ruhe zu kultivieren, in die innere Mitte zurückzukehren. Wenn es dir in schwierigen Zeiten gelingt, vielleicht wird dir dann das achtsame Sein und die Meditation an “normalen” Tagen deutlich leichter fallen.
Je öfter du das tust, desto klarer erkennst du auch, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt.
In diesem Raum geschieht Yoga.
Und genau das ist der Erfahrungsraum von Sutra 4.28:
Du siehst, wie Prägungen entstehen, wie sie verblassen, und irgendwann – ganz unspektakulär – einfach keine Rolle mehr spielen.
Diese Sutra ist kein spirituelles Hochglanzversprechen, sondern ehrliche Handarbeit.
Sie sagt nicht: „Sei frei von allem.“
Sie sagt: „Übe dich darin, nichts mehr festzuhalten.“
Das ist still, unscheinbar, manchmal zäh – aber zutiefst befreiend.
Also: Setz dich hin. Spür den Atem.
Und wenn der alte Ärger wieder vorbeikommt, wink ihm freundlich zu.
Dann mach weiter.
Genau das ist Yoga in Aktion – das stille, klare, unaufgeregte hānam eṣām kleśavat uktam.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
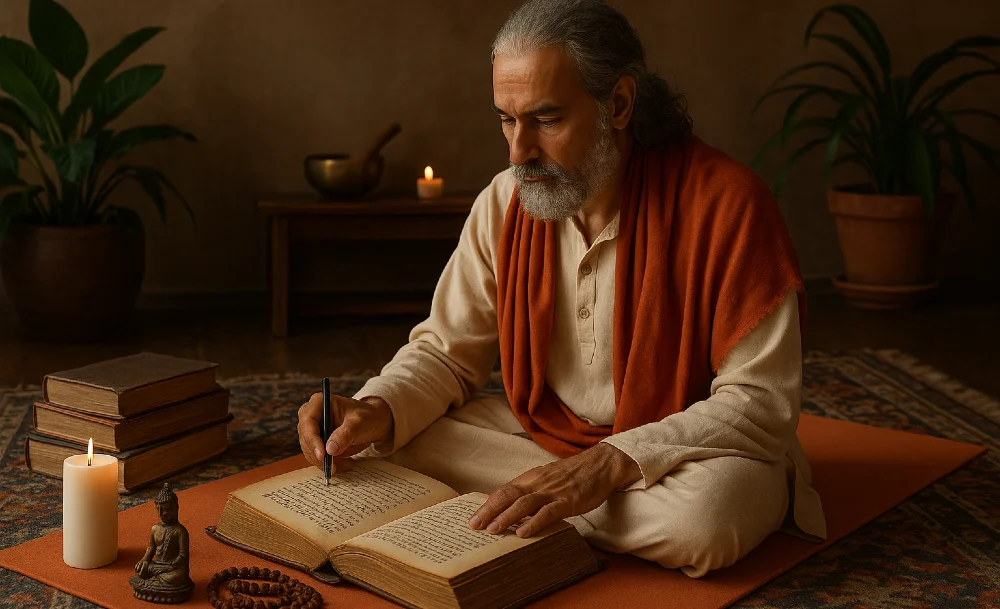
Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.28 – nähere Erläuterungen
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyasa, der älteste Kommentator des Yogasutra, beschreibt in seinem Kommentar zu Sutra 4.28 den Prozess, wie sich alte Eindrücke (Samskaras) auflösen. Die ursprüngliche Übersetzung lautet etwa:
„So wie die Leiden (Kleshas) nicht mehr aufkeimen können, wenn ihre Samenkraft versengt worden ist, so gebiert auch die konservierte Energie früherer Rückstände (Samskaras) keine Vorstellungen mehr, wenn ihre Samenkraft durch das Feuer des Wissens versengt wurde. Die Samskaras des Wissens leben jedoch weiter, bis die Aufgabe des Geistes erfüllt ist. Sie werden daher nicht berücksichtigt.“
Im Folgenden findest du eine erläuternde, sinngemäß interpretierte Fassung, die den philosophischen Gehalt beibehält, aber in verständlicher Sprache wiedergibt.
🔥 Das Feuer der Erkenntnis
Vyasa möchte sagen: Wenn der Mensch die Ursachen seines Leidens wirklich erkannt hat, dann verlieren diese Ursachen ihre „Keimkraft“.
Er benutzt dafür ein starkes Bild: Die Kleshas und Samskaras sind wie Samen, die nur dann wieder aufgehen, wenn sie nicht verbrannt sind.
Wenn aber die Flamme des Wissens – also tiefe Einsicht und Selbsterkenntnis – sie „versengt“ hat, dann können sie nichts Neues mehr hervorbringen.
Das bedeutet: Auch wenn alte Erfahrungen oder Gewohnheiten noch als Spuren im Geist existieren, haben sie keine schöpferische Macht mehr. Sie liegen da, leer, ausgedorrt, leblos – wie Samenkörner, die ihre Fruchtbarkeit verloren haben.
🌱 Was bleibt, wenn das Alte verbrannt ist
Vyasa unterscheidet zwischen zwei Arten von Eindrücken (Samskaras):
-
Die Eindrücke aus Unwissenheit – sie sind die Wurzel des Leidens.
-
Die Eindrücke des Wissens – sie entstehen durch Erkenntnis, Meditation und Unterscheidungskraft (viveka).
Die erste Art wird durch Erkenntnis ausgelöscht. Die zweite Art bleibt vorübergehend bestehen, bis der Geist seine Aufgabe erfüllt hat: nämlich das reine Bewusstsein (Purusha) von der Materie oder Natur (Prakriti) zu unterscheiden.
Vyasa sagt also: Selbst das Wissen hinterlässt noch Spuren. Aber diese Spuren sind nicht hinderlich. Sie sind wie der Restglanz eines erlöschenden Feuers – sie beleuchten, aber sie verbrennen nicht mehr.
Wenn die Aufgabe des Geistes – also das vollständige Erkennen des Selbst – vollendet ist, dann löst sich auch dieser letzte Rest auf. Der Geist hat dann nichts mehr zu tun, keine Objekte mehr zu erfassen, keine Gedanken mehr zu erzeugen. Er kommt zur Ruhe, ganz natürlich, ohne Zwang.
💡 Wie man sich das vorstellen kann
Stell dir vor, du hast jahrelang geübt, mit Ärger umzugehen. Früher bist du sofort explodiert, heute spürst du ihn noch, aber er durchdringt dich nicht mehr.
Die „Samen des Ärgers“ liegen irgendwo noch in dir, aber sie keimen nicht mehr, weil das „Feuer der Achtsamkeit“ sie ausgedörrt hat.
Vielleicht taucht noch ein Restreflex auf – aber er hat keine Kraft mehr, dich zu beherrschen.
Das ist der Moment, von dem Vyasa spricht: Der Ärger ist noch da, aber er ist zahnlos geworden.
🕊️ Der letzte Schritt
Was Vyasa mit der „Aufgabe des Geistes“ meint, ist vermutlich kein philosophisches Rätsel, sondern ergibt sich aus den Aussagen der Sutras zuvor. Es ist der Moment, in dem der Geist erkennt:
„Ich bin nicht der, der denkt. Ich bin das, was sich des Denkens bewusst ist.“
Ab da hat der Geist keinen Auftrag mehr, nichts zu ordnen, nichts zu analysieren, nichts zu kontrollieren.
Er zieht sich zurück, so wie ein Handwerker, der seine Arbeit beendet hat.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-30: Diese Hindernisse lauten körperliche Einschränkung, geistige Stumpfheit, Zweifel, Gleichgültigkeit, Faulheit, Haften an Dingen, falsche Anschauung und die Nichterreichung einer geistigen Stufe

Fazit
Yogasutra 4.28 erinnert uns daran, dranzubleiben. Die Erleuchtung kommt nicht unbedingt mit einem Knall, sondern eher allmählich, schrittweise, “allmählich wie das Beseitigen von Prägungen” – bis wir eines Tages feststellen, dass nichts Negatives mehr aufsteigen kann. Was für eine hoffnungsvolle Aussicht, die sowohl von den alten Weisen als auch durch moderne Wissenschaft gestützt wird! Es lohnt sich also, weiter zu üben – die Früchte dieser Bemühungen sind die Arbeit wert.
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-28
Gedanken, Samskaras, Kleshas und ihre Überwindung – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 27 und 28
Länge: 4 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Das Verschwindenlassen von Samskaras – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.28
Länge: 7 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34
Länge: 95 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


