Vaisheshika Sutra: Grundlagen, Zusammenfassung und Bedeutung
Ein Zustand frei von Freude und Schmerz
- Andere Namen: Vaisesikasutra; Vaisesika Sutra; Vaiśeṣika Sūtra, Kanada Sutra
- Hindu/ Vaisheshika-Schule
- 6 bis 2. Jhd. vor Christus oder 4. Jhd. nach Christus
Vaiśeṣika Sūtra (Sanskrit: वैशेषिक वैशेषिक्सूत), auch Kanada Sutra genannt, ist ein alter Sanskrit-Text, der die Grundlage der Vaisheshika-Schule in der Hindu-Philosophie bildet. Das Sutra wurde vom Hindu-Weisen Kanada verfasst, der auch als Kashyapa bekannt wurde. Einigen Gelehrten zufolge blühte er diese Schule sogar vor dem Aufkommen des Buddhismus auf, weil die Vaiśeṣika Sūtra weder den Buddhismus noch buddhistische Lehren erwähnt. Die Einzelheiten von Kanadas Leben sind jedoch ungewiss.
Wenn du dich fragst, wie frühe Denker das Universum, den Menschen und das Wissen systematisch durchdringen wollten – dann ist dieser Artikel genau richtig. Du bekommst einen klaren Überblick über das Vaisheshika Sutra, sein geistiges Fundament und seine Bedeutung für Philosophie, Naturwissenschaft und Selbstverständnis. Dabei geht es nicht nur um abstrakte Lehre, sondern darum, wie Denken, Handlung und Wirklichkeit zusammengehören.
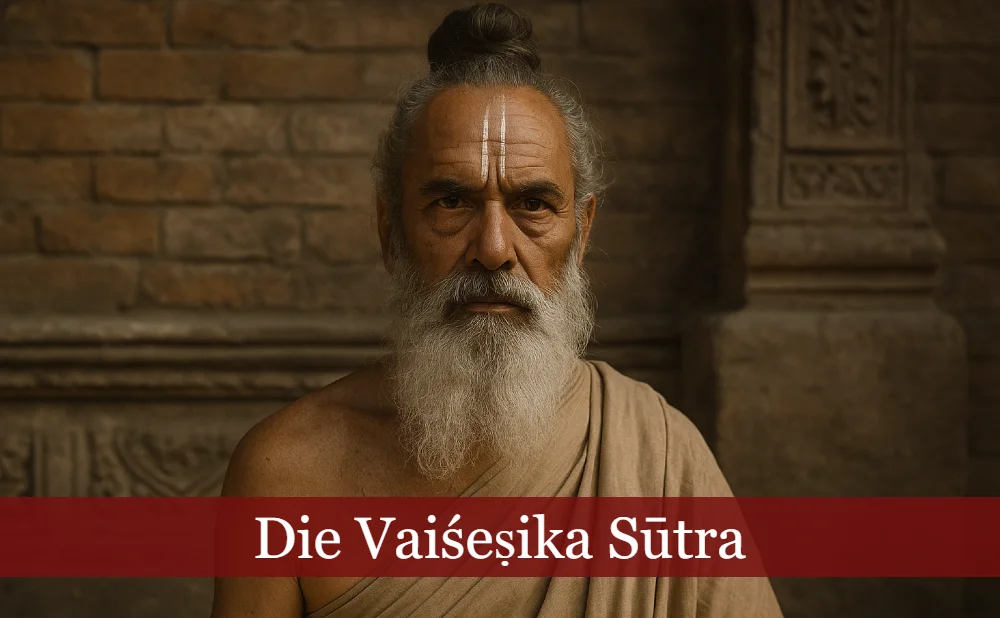
Kurz zusammengefasst
- Autor und Ursprung – Das Vaisheshika Sutra wurde vom Weisen Kaṇāda (auch Kashyapa genannt) verfasst und entstand wahrscheinlich zwischen dem 6. und 2. Jahrhundert v. Chr.
- Naturphilosophie & Atomismus – Es entwickelt eine Theorie, dass alles aus kleinsten, unteilbaren Teilchen (paramāṇu) besteht und Bewegung die Ursache aller Phänomene ist.
- Sechs Kategorien (Padārtha) – Die Realität wird systematisch gegliedert in Substanz, Eigenschaft, Bewegung, Allgemeinheit, Besonderheit und Inhärenz.
- Erkenntnis und Ethik – Wahrnehmung und Schlussfolgerung sind die Mittel der Erkenntnis; aus Wissen folgt Handlung, aus Handlung Wirkung – und damit moralische Ordnung (Dharma) und Befreiung (Mokṣa).
- Nicht-theistisch und realistisch – Das Werk spricht keinen personalen Gott an, sondern behandelt Naturgesetzlichkeit, Ontologie und Ethik mit Logik und Analyse.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.
Vaisheshika-Sutra – Ursprung, Inhalt und Bedeutung
Das Vaisheshika-Sutra (Sanskrit: वैशेषिकसूत्र, Vaiśeṣika Sūtra), auch Kaṇāda-Sutra genannt, ist das grundlegende Werk der Vaisheshika-Philosophie, einer der sechs klassischen Schulen (Shad Darshanas) der indischen Philosophie. Der Autor ist der Weise Kaṇāda Rishi, auch Kashyapa genannt. Das Werk entstand vermutlich zwischen dem 6. und 2. Jahrhundert v. Chr., wurde aber erst kurz vor Beginn unserer Zeitrechnung in seiner heutigen Form abgeschlossen.
Vaisheshika-Schule
Die Vaisheshika-Schule ist eine naturphilosophische Schule und eines der sechs klassischen Systeme der indischen Philosophie. Die Zeitspanne des Vaisheshika umfasst die ersten Jahrhunderte vor Christus bis etwa 700 n. Chr. Es handelt sich um eine Naturphilosophie und Lehre, deren Anliegen die Erfassung der natürlichen Phänomene war.
Ursprung und Ziel
„Sutra“ bedeutet wörtlich Faden oder Leitfaden – eine kurze, prägnante Form, in der grundlegende Erkenntnisse wie Perlen an einer Schnur zusammengefasst werden. Ähnlich wie das Yoga-Sutra für den Raja-Yoga oder das Brahma-Sutra für den Vedanta, bildet das Vaisheshika-Sutra den Leitfaden des gleichnamigen philosophischen Systems.
Das Ziel der Vaisheshika-Lehre ist es, die natürlichen Phänomene und Unterschiede der Wirklichkeit systematisch zu erfassen. Sie gilt als eine der ersten naturphilosophischen und wissenschaftlich orientierten Schulen der Weltgeschichte – rational, empirisch und zugleich spirituell.
Zeitliche Einordnung und Überlieferung
Das Werk entstand in den Jahrhunderten vor Christus und war bis etwa 700 n. Chr. prägend für die indische Philosophie. Da das Vaisheshika-Sutra keine Erwähnung des Buddhismus enthält, vermuten Forscher, dass Kaṇāda vor dessen Entstehung wirkte.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war nur ein einziges Manuskript bekannt, das von Śaṅkara Miśra im 15. Jahrhundert kommentiert wurde. Erst in den 1950er- und 1960er-Jahren wurden weitere, ältere Manuskripte entdeckt, die eine kritische Edition ermöglichten. Diese zeigen, dass das Werk über die Jahrhunderte Überarbeitungen, Abschreibfehler und Einfügungen erfuhr – ein Schicksal, das es mit vielen alten indischen Texten teilt.
Zentrale Lehre: Eine Philosophie der Natur und des Seins
Kaṇāda entwickelt im Vaisheshika-Sutra eine realistische Ontologie, die davon ausgeht, dass die Welt aus realen, erkennbaren Einheiten besteht. Seine Philosophie ist atomistisch und pluralistisch: Alles Dasein setzt sich aus kleinsten, unteilbaren Teilchen – den Atomen (paramāṇu) – zusammen. Vier Arten von Atomen (Erde, Wasser, Feuer und Luft) bilden durch Verbindung die sichtbare Welt. Dazu kommen Raum (ākāśa), Zeit (kāla), Richtung (diśā), unendliche Seelen (ātman) und Geist (manas) als weitere Grundbestandteile der Wirklichkeit.
Damit formuliert Kaṇāda eine der ältesten physikalischen Weltanschauungen:
- Bewegung ist die Ursache aller Phänomene.
- Atome sind ewig, sie verbinden sich zu Molekülen und lösen sich wieder.
- Alles Erkennbare gründet auf Bewegung und Beziehung.
Diese Denkweise begründet eine frühe Form von Naturgesetzlichkeit – frei von Mythen, jedoch offen für spirituelle Dimensionen.
Die sechs Kategorien (Padārthas)
Die gesamte Wirklichkeit lässt sich laut Kaṇāda in sechs Grundkategorien gliedern, die er padārtha („das, worüber gesprochen wird“) nennt:
- Substanz (dravya) – das Trägermedium der Eigenschaften.
- Eigenschaft (guṇa) – Farbe, Geschmack, Zahl, Nähe, Lust usw.
- Bewegung (karma) – Ursache jeder Veränderung.
- Allgemeinheit (sāmānya) – das Gemeinsame vieler Dinge.
- Besonderheit (viśeṣa) – das, was ein Ding einzigartig macht.
- Inhärenz (samavāya) – die unsichtbare Verbindung zwischen Ursache und Wirkung.
Diese Systematik ist die Grundlage für Kaṇādas Kausalitätslehre und seine Vorstellung eines geordneten, erklärbaren Universums.
Ethik und Erkenntnis
Das Vaisheshika-Sutra beginnt mit den Worten:
„Nun folgt die Erklärung des Dharma, des Mittels zu Wohlstand und Erlösung.“
Damit ist klar: Philosophie dient nicht nur dem Wissen, sondern der Befreiung (mokṣa).
Kaṇāda behandelt Themen wie:
- die Natur der Seele (ātman),
- den Prozess des Wissens (Wahrnehmung, Schlussfolgerung, Irrtum),
- den Zusammenhang von Bewegung, Ursache und Moral,
- und den Weg zu Erkenntnis und innerer Freiheit.
Interessanterweise erwähnt das Sutra keinen Gott (Īśvara) – es ist nicht-theistisch. Statt göttlicher Schöpfung steht die Ordnung der Natur im Mittelpunkt. Das Universum funktioniert nach ewigen Prinzipien, nicht nach göttlichem Willen.
Bedeutung und Wirkung
Das Vaisheshika-Sutra wurde früh kommentiert, u. a. von Prashastapāda (Padārtha Dharma Sangraha) und Maticandra (Daśa Padārtha Śāstra, auch in chinesischer Übersetzung von 648 n. Chr.).
Seine Ideen beeinflussten sowohl die Nyāya-Schule (Logik und Erkenntnislehre) als auch buddhistische und jainistische Philosophen. Besonders die buddhistische Sarvāstivāda-Schule und Nāgārjuna griffen Kaṇādas Begriffe und Denkweisen auf.
Seine Lehre ist damit eines der frühesten systematischen Versuche, die Welt rational, empirisch und moralisch zugleich zu verstehen – eine Verbindung von Physik, Logik und Ethik.
Zusammenfassung der Vaisesika Sutra
Quelle: E. Röer: Die Lehrsprüche der Vaiçeshika-Philosophie von Kaṇâda. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Band 21, Leipzig 1867, S. 309–420. PDF-Download. Online noch zu finden unter: https://web.archive.org/web/20230921085742/http://www.sarva-darshana.de/hinduismus/Shaddarshana/Vaisheshika-Sutra%20deutsch.pdf und die englische Ausgabe unter https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/vaisheshika-sutra-commentary.
Die Grundpfeiler der Wirklichkeit – Buch 1: Die Prädikabilien
Das erste Buch des Vaisheshika-Sutra ist wie der Bauplan einer philosophischen Weltmaschine. Kaṇāda will erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält – und er tut das mit fast mathematischer Präzision. Sein System gliedert alles Existierende in sechs Kategorien, die sogenannten padārthas: Substanz (dravyam), Eigenschaft (guṇa), Bewegung (karma), Allgemeinheit (sāmānya), Besonderheit (viśeṣa) und Inhärenz (samavāya).
Diese sechs sind keine trockene Theorie, sondern Bausteine für das Verständnis des Lebens – vom kleinsten Atom bis zur Seele. Kaṇāda will zeigen: Wissen über die Welt führt zur Befreiung, und die Grundlage dieses Wissens liegt im klaren Erkennen ihrer Kategorien.
Die Substanz ist das Trägermedium – sie hat Eigenschaften und kann Bewegung erfahren. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Zeit, Raum, Seele und Geist bilden die grundlegenden Substanzen.
Eigenschaften (Farbe, Geschmack, Zahl, Nähe, Ferne, Lust, Schmerz, Wille etc.) sind das, was einer Substanz „anhaftet“, ohne selbständig zu existieren.
Bewegung ist die Ursache von Veränderung – vom Fallen eines Apfels bis zur inneren Regung des Geistes.
Allgemeinheit und Besonderheit dienen dazu, die Dinge zu unterscheiden – das, was sie teilen, und das, was sie einzigartig macht.
Inhärenz schließlich beschreibt die unsichtbare Bindung zwischen Ursache und Wirkung – die Weise, wie Dinge „in“ anderen Dingen bestehen.
Kaṇāda geht weit über bloße Metaphysik hinaus: Er denkt kausal. Alles, was ist, hat Ursachen und Wirkungen. Nichts existiert unabhängig. So entsteht eine frühe indische Form von Naturgesetzlichkeit – rational, aber durchdrungen von spirituellem Sinn.
Im modernen Alltag lässt sich das übertragen: Dinge, Menschen, Emotionen – alles hängt zusammen. Ursache und Wirkung, Sein und Veränderung, Innen und Außen – sie sind Ausdruck derselben Logik, die Kaṇāda in philosophische Worte fasst.
Die sichtbare und unsichtbare Welt – Buch 2: Die Substanz
Das zweite Buch führt tiefer in die materielle Struktur der Welt. Hier geht es um die Elemente – Erde, Wasser, Licht (Feuer), Luft und Äther – sowie um Zeit und Raum.
Kaṇāda beschreibt jedes Element mit seinen spezifischen Eigenschaften:
- Erde: Farbe, Geschmack, Geruch, Tastbarkeit
- Wasser: Farbe, Geschmack, Flüssigkeit, Kälte
- Licht: Farbe, Wärme
- Luft: nur Tastbarkeit, unsichtbar, aber beweisbar durch Bewegung
- Äther (ākāśa): unsichtbar, aber Träger des Klangs – hier findet sich eine frühe systematische Erklärung von Schallübertragung.
Zeit und Raum werden nicht als „Dinge“, sondern als Rahmenbedingungen der Existenz verstanden. Zeit macht Veränderung möglich, Raum macht Trennung und Beziehung denkbar. Beide sind ewig, allgegenwärtig und nicht wahrnehmbar, sondern nur durch Vernunft erfassbar.
In diesen frühen Lehrsätzen liegt Erstaunliches: Kaṇāda erahnt, dass Raum und Zeit eigenständige Prinzipien sind – ein Schritt dahin wie Jahrtausende später Einstein sie mathematisch beschreibt.
Seine Betrachtung des Tons zeigt zudem ein frühes physikalisches Verständnis. Ton entsteht, wenn sich Luft bewegt; er ist nicht ewig, weil er entsteht und vergeht. Diese Idee – dass Klang Schwingung ist – bildet die Grundlage für spätere indische Klangphilosophie (śabda-vidyā).
Das zweite Buch führt auch den Gedanken der Einheit und Verschiedenheit fort: Jedes Element ist eigen, doch sie stehen alle in Beziehung. Wasser verdunstet, wird Dampf, fällt als Regen – ein Kreislauf, in dem Ursache und Wirkung ineinander übergehen.
Das ist nicht nur Philosophie, sondern eine frühe Form ökologischen Denkens: alles hängt mit allem zusammen.
Praktische Bedeutung heute
Was hat das mit dir zu tun?
Mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Kaṇādas Denken ist ein Werkzeug, um Zusammenhänge zu erkennen – zwischen Körper, Geist und Umwelt. Wenn du begreifst, dass jede Bewegung eine Ursache hat, dass jede Eigenschaft einer Substanz entspringt, lernst du, aufmerksam zu handeln. Das ist im Kern Dharma – bewusst leben, statt blind reagieren.
Das Bewusstsein und seine Quellen – Buch 3: Die Seele und der innere Sinn
Mit dem dritten Buch wechselt Kaṇāda von der äußeren zur inneren Welt. Nachdem die Elemente, Eigenschaften und Bewegungen der Materie beschrieben sind, fragt er nun: Wer erfährt das alles?
Hier tritt das Konzept der Seele (ātman) und des inneren Sinns (manas) auf – zwei der subtilsten und zugleich zentralsten Ideen des gesamten Systems.
Kaṇāda beginnt mit einer logischen Beobachtung: Wir nehmen Dinge wahr, wir denken über sie nach, und wir wissen, dass wir wissen. Diese Selbstwahrnehmung beweist, dass es etwas geben muss, das vom Körper verschieden ist – die Seele. Der Körper kann nicht Zeuge seiner selbst sein; das Bewusstsein ist also kein Nebenprodukt der Materie, sondern ein eigenständiges Prinzip.
Die Seele ist ewig, unteilbar und unveränderlich, doch sie ist im Körper wirksam durch den manas, den inneren Sinn oder Geist. Dieser manas ist winzig, atomar, und verbindet die Seele mit den Sinnesorganen.
Wenn du etwas siehst, hört oder fühlst, dann geschieht das, weil der manas zwischen Sinn und Seele eine Verbindung herstellt – wie ein Schalter, der Wahrnehmung überhaupt erst möglich macht.
Kaṇāda unterscheidet zwischen Wahrnehmung (pratyakṣa) und Schlussfolgerung (anumāna). Die Wahrnehmung entsteht, wenn Seele, Geist, Sinnesorgan und Objekt zusammenkommen. Fehlt eines davon, bleibt das Wissen aus.
So erklärt sich, warum du manchmal etwas „siehst“, aber es nicht wirklich wahrnimmst – der innere Sinn ist abgelenkt. Erkenntnis entsteht also nicht allein durch Sinnesdaten, sondern durch Aufmerksamkeit.
Diese Einsicht ist erstaunlich modern: Kaṇāda beschreibt hier im Grunde einen frühen Ansatz der kognitiven Psychologie. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Bewusstsein – alles sind Funktionen einer seelisch-geistigen Einheit, nicht bloß chemische Prozesse.
Er führt außerdem die Idee ein, dass es mehrere Seelen gibt – jede individuell, aber alle Teil derselben Wirklichkeit. Die Unterschiede im Erleben – Freude, Schmerz, Erinnerung – entstehen aus den unterschiedlichen Zuständen dieser Seelen und ihrer Verbindungen zu Körper und Geist.
Kaṇāda bleibt aber offen: in manchen Passagen klingt an, dass letztlich alle Seelen eins im Ursprung sind – eine Andeutung auf eine metaphysische Einheit, die später in der Vedānta-Tradition zentral wird.
Im Alltag übersetzt: Du bist nicht dein Körper und nicht deine Gedanken – du bist der, der sie beobachtet. Das ist keine religiöse Floskel, sondern eine präzise Analyse deiner Wahrnehmung.
Wer sich das bewusst macht, kann – so Kaṇāda – seine Reaktionen, sein Denken und sein Handeln schärfer erkennen. Selbsterkenntnis wird zu innerer Ordnung.
Die unsichtbaren Bausteine der Welt – Buch 4: Von den Körpern
Das vierte Buch führt zurück in die sichtbare Welt, diesmal auf mikroskopischer Ebene. Kaṇāda entfaltet hier die Atomlehre (paramāṇu-vāda), die als eine der ältesten der Menschheitsgeschichte gilt.
Er beginnt mit der Aussage: „Das Ewige ist seiend und unverursacht.“
Damit beschreibt er das Atom (paramāṇu) als die kleinste, unteilbare und ewige Einheit der Materie – etwas, das nicht weiter zerstört werden kann. Alle sichtbaren Dinge sind Verbindungen dieser Atome, und aus ihrer Kombination entstehen Körper, Stoffe und Bewegungen.
Schon über 1.000 Jahre vor der modernen Physik erkennt Kaṇāda, dass Dinge nicht kontinuierlich, sondern aus diskreten Einheiten bestehen. Diese Atome sind unsichtbar, haben aber bestimmte Eigenschaften wie Ausdehnung, Verbindung, Trennung und Bewegung.
Er unterscheidet dabei drei Arten von erzeugten Substanzen:
- Körper (wie Pflanzen, Tiere, Menschen)
- Sinnesorgane
- Gegenstände
Die Körper selbst können entweder aus einer Gebärmutter entstehen – also natürlich –, oder außerhalb davon, etwa durch karmische oder göttliche Ursachen. Letzteres klingt mystisch, bedeutet aber im Kontext: Es gibt Formen des Entstehens, die nicht auf physischer Fortpflanzung beruhen, sondern auf unsichtbaren Kräften (Verdienst, Bewusstsein, Wille).
Kaṇāda beschreibt die Verbindung der Atome nicht als Zufall, sondern als geordnetes Prinzip, das einer Art kosmischer Logik folgt. Man könnte seine Worte so deuten: Die Atome vereinen sich zu Molekülen, diese zu sichtbaren Körpern. Diese Struktur folgt der Gesetzmäßigkeit der Ursache und Wirkung, die bereits in Buch 1 angelegt ist.
Auch Bewegung spielt hier wieder eine Rolle. Kein Körper bleibt ohne Bewegung, ob gewollt oder ungewollt. Kaṇāda unterscheidet:
- Gewollte Bewegung entsteht durch den Willen der Seele – etwa das Heben einer Hand.
- Ungewollte Bewegung geschieht durch Naturgesetze – etwa das Fallen eines Steins oder das Fließen von Wasser.
Damit erfasst er sowohl physikalische Mechanik als auch psychische Dynamik. Jede Bewegung – sei sie innerlich oder äußerlich – folgt Ursachen.
Er führt sogar Beispiele an, die wie frühe Experimente wirken: Der Aufstieg des Wassers im Baum, das Fließen von Flüssigkeiten, die Bildung von Donner – alles wird mit Kausalität erklärt. Das ist eine frühe, naturphilosophische Beobachtung des Ökosystems: Natur als dynamisches Zusammenspiel aus Kräften, Stoffen und Geist.
Die Idee, dass Bewegung nicht zufällig ist, sondern Ausdruck einer verborgenen Ordnung, wirkt fast wie ein Echo moderner Physik: Kaṇāda beschreibt eine Welt der Energie und Interaktion, nicht der bloßen Substanz.
Im übertragenen Sinn kannst du diese Sichtweise nutzen, um dein eigenes Leben zu betrachten: Auch dort entstehen „Bewegungen“ – Gedanken, Gefühle, Ereignisse – aus unsichtbaren Ursachen. Wer sie erkennt, kann lernen, seine Energie bewusster zu lenken.
Praktische Anwendung – die Philosophie als Lebenskunst
Aus Buch 3 und 4 entsteht ein interessanter Bogen: Kaṇāda verbindet die innere Wirklichkeit der Seele mit der äußeren Struktur der Welt. Er zeigt, dass Erkenntnis kein bloßes Wissen ist, sondern ein Erkennen der Zusammenhänge zwischen Geist, Stoff und Bewegung.
Die Kraft der Bewegung – Buch 5: Bewegung (Karma)
Nach den Büchern über Seele und Körper wendet sich Kaṇāda nun der Bewegung zu – dem Prinzip, das Leben überhaupt erst dynamisch macht. Wenn die Seele Bewusstsein bringt und die Atome Substanz schaffen, dann ist Bewegung das Bindeglied zwischen beiden. Ohne Bewegung gäbe es keine Veränderung, keine Zeit, kein Werden.
Kaṇāda unterscheidet klar zwischen gewollter Bewegung und ungewollter Bewegung – ein Gedanke, der auch in moderner Psychologie und Physik erstaunlich aktuell wirkt.
Die gewollte Bewegung entsteht durch den Willen der Seele. Wenn du deine Hand hebst, geschieht das nicht zufällig – es ist das Ergebnis einer bewussten Verbindung von Seele, innerem Sinn, Körper und äußerer Materie. Die Handlung beginnt im Inneren und setzt sich durch physische Bewegung fort.
Kaṇāda erklärt das am Beispiel des Schlags mit einer Keule: Die Bewegung der Hand entsteht aus Wille und Kontakt mit dem Objekt, die Bewegung der Keule wiederum aus der Verbindung mit der Hand. Bewegung pflanzt sich fort, von einem Körper auf den anderen, immer nach den Gesetzen der Kausalität.
Diese Vorstellung ist fast wie eine philosophische Physik der Energieübertragung. Jede Bewegung, ob sichtbar oder unsichtbar, hat eine Ursache, eine Richtung und eine Wirkung.
Selbst das Fallen eines Gegenstandes – etwa eines Steins – geschieht aus innerer Notwendigkeit: durch die Schwere. Kein Zufall, kein Chaos – alles folgt Regeln.
Dann gibt es die ungewollte Bewegung, jene, die ohne bewussten Willen entsteht. Sie entspringt der Natur selbst: dem Wind, dem Fließen von Wasser, dem Aufsteigen der Säfte in Pflanzen, dem Donner, der aus der Begegnung von Wolke und Luft entsteht.
Kaṇāda nennt das daiva – das Geschick, die verborgene Ordnung. Sie ist nicht göttlich im westlichen Sinne, sondern ein Prinzip natürlicher Kausalität: die Summe aller Bedingungen, die eine Bewegung bestimmen, auch wenn du sie nicht siehst.
So beschreibt er eine Welt, die vollständig durch Ursachen bestimmt ist, aber nicht seelenlos. Denn auch ungewollte Bewegungen sind Teil der großen kosmischen Ordnung – Ausdruck eines feinen Gleichgewichts zwischen Materie, Geist und Zeit.
Interessant ist Kaṇādas Schlussfolgerung: Selbst das Denken ist eine Bewegung – allerdings des inneren Sinns. Wenn dein Geist sich auf ein Objekt richtet, „bewegt“ er sich dorthin.
Diese Idee verbindet das Physische mit dem Psychischen: Gedanken sind feine Bewegungen im Bewusstseinsraum, so wie Wind Bewegungen in der Luft sind.
Heute würden wir sagen: Energie folgt der Aufmerksamkeit. Was du denkst, wird zur Bewegung – und jede Bewegung hat Folgen.
Wer das versteht, erkennt, dass Selbstbeherrschung nichts Statisches ist, sondern die Kunst, Bewegung bewusst zu lenken.
Yoga-Definition von Kanada
Kanada gibt uns im fünften Buch auch eine der grundlegenden Definitionen von Yoga:
Vers 5.2.15:
Freude und Leiden entstehen als ein Ergebnis des Zusammenspiels von Sinnen, dem Geist und den Objekten.
Vers 5.2.16:
Wenn dies nicht geschieht, weil der Geist im Selbst ruht, gibt es keine Freude und kein Leid für jemanden, der verkörpert ist. Das ist Yoga.
Das Gesetz der Tat – Buch 6: Dharma und Adharma
Im sechsten Buch betritt Kaṇāda die moralische und spirituelle Ebene seines Systems. Wenn alles Bewegung ist, dann gilt das auch für Handlungen – und diese bringen Folgen hervor, die über das Sichtbare hinausgehen.
Hier führt er die Begriffe Dharma (das, was aufrichtet, ordnet, heilt) und Adharma (das, was zerstört, verwirrt, verletzt) ein.
Kaṇāda definiert Dharma nüchtern, nicht mystisch: Dharma ist das, was zur Erhebung und zum höchsten Gut führt – also Handlungen, die im Einklang mit der Ordnung des Kosmos stehen. Adharma ist das Gegenteil – das, was diese Ordnung stört.
Der Maßstab für richtiges Handeln ist dabei der Veda – nicht als Dogma, sondern als Ausdruck uralten Wissens. Kaṇāda sieht in den vedischen Lehren eine Quelle, aus der das Wissen um Ursache und Wirkung des Handelns hervorgeht.
Er sagt:
Die Worte des Veda haben Beweiskraft, weil sie von jenen ausgesprochen sind, die das Wirkliche erkannt haben.
Doch Kaṇāda bleibt kein blinder Gläubiger. Er analysiert das moralische Gesetz mit der gleichen logischen Strenge wie Naturgesetze. Er fragt: Wie entstehen Verdienst (puṇya) und Vergehen (pāpa)?
Seine Antwort: durch bewusste oder unbewusste Bewegungen der Seele – durch Verlangen und Abscheu.
Wenn du etwas tust, weil du etwas willst oder etwas ablehnst, schaffst du eine Bewegung im seelischen Raum. Diese Bewegung zieht Konsequenzen nach sich – in deinem Bewusstsein, in deinem Körper, in deiner Umgebung. So wie in der Physik jede Kraft eine Gegenkraft erzeugt, so ruft auch jede Tat ihre Wirkung hervor.
Kaṇāda zählt eine ganze Reihe von Handlungen auf, die Dharma fördern:
- Reinheit,
- Disziplin,
- Studium,
- Gebet,
- Opfergaben,
- Wohltätigkeit,
- Selbstbeherrschung.
Doch er betont auch, dass Motiv und Gesinnung entscheidend sind. Eine Handlung, die äußerlich gut aussieht, kann innerlich leer sein, wenn sie aus Eitelkeit geschieht. Umgekehrt kann ein schlichtes, ehrliches Tun einen tiefen moralischen Wert haben.
Dharma ist also kein starres Regelwerk, sondern ein Prinzip von innerer Ordnung und Bewusstheit. Es ist die Fähigkeit, im Einklang mit Ursache und Wirkung zu handeln – mit dem, was Kaṇāda als natürliche Ordnung des Seins begreift.
Adharma dagegen entsteht aus Unwissenheit und Getriebenheit. Wer seine inneren Bewegungen nicht kennt, reagiert blind – und schafft Leid.
Im Alltag lässt sich das so übersetzen: Wenn du achtsam handelst, erzeugst du Harmonie – in dir und um dich herum. Wenn du aus Gier, Angst oder Trotz handelst, bringst du Disharmonie hervor. Kaṇāda nennt das den unsichtbaren Fluss des Karmas.
Er erkennt außerdem, dass Verdienst und Vergehen sich nicht immer sofort zeigen. Manche Wirkungen entfalten sich erst in einem späteren Leben oder Moment. So wird das moralische Prinzip zur Gesetzmäßigkeit der Zeit – eine Art kosmisches Gedächtnis.
Praktische Anwendung – Bewegung und Moral als Selbstführung
Wenn du Kaṇādas Denken auf dich überträgst, erkennst du zwei Ebenen:
- die äußere Bewegung (Taten, Sprache, Körper, Umwelt),
- und die innere Bewegung (Gedanken, Impulse, Entscheidungen).
Beide sind untrennbar. Das, was du denkst, wird irgendwann Handlung. Und das, was du tust, formt wiederum dein Denken.
Das Spiel der Eigenschaften – Buch 7: Die Untersuchung der Eigenschaften
Im siebten Buch widmet sich Kaṇāda dem, was Dinge erscheinen lässt, wie sie sind: ihren Eigenschaften (guṇa). Wenn die Substanz das „Sein“ und die Bewegung das „Werden“ ist, dann sind die Eigenschaften das „Wie“ der Welt. Sie geben den Dingen Gestalt, Geschmack, Gewicht und Charakter.
Er unterscheidet eine Vielzahl von Eigenschaften: Farbe (rūpa), Geschmack (rasa), Geruch (gandha), Berührung (sparśa), Größe (parimāṇa), Zahl (saṁkhyā), Individualität (pṛthaktva), Verbindung (saṁyoga), Trennung (vibhāga), Priorität und Nachrang (paratva, aparatva) und viele mehr.
Damit legt Kaṇāda sozusagen den ersten systematischen Katalog der Eigenschaften an – eine Art frühe „Metaphysik der Wahrnehmung“.
Er stellt fest, dass Eigenschaften vergänglich sind, wenn sie zu vergänglichen Substanzen gehören, und ewig, wenn sie in unvergänglichen Substanzen wohnen (wie in der Seele oder im Raum). Alles, was du siehst, schmeckst oder fühlst, ist also Teil eines unaufhörlichen Prozesses: Die Form vergeht, aber das Prinzip der Eigenschaft bleibt bestehen.
So beschreibt Kaṇāda eine Welt, die dauernd in Wandlung ist, ohne je völlig zu verschwinden. Farbe verändert sich, Geschmack verfliegt, doch die Fähigkeit, wahrzunehmen, bleibt.
Besonders interessant ist sein Gedanke über Größe und Kleinheit. Er sagt: Beide sind relative Begriffe – etwas ist groß oder klein nur im Verhältnis zu anderem. So führt er das Prinzip der Relativität der Wahrnehmung ein, lange bevor die moderne Physik Relativität als Gesetz formulierte.
Er schließt: Der Äther und die Seele sind unendlich groß, weil sie allgegenwärtig sind, während der innere Sinn atomar klein ist, weil er nur im Körper wirkt. Zwischen diesen beiden Polen – dem winzigsten und dem unendlichen – entfaltet sich das Spiel der Eigenschaften, das die sichtbare Welt erschafft.
In modernen Worten: Kaṇāda liefert eine Art philosophische Physik des Erlebens. Alles, was du erfährst, ist eine Mischung aus Stoff, Energie, Form und Relation. Nichts steht für sich allein.
Wer diese Sichtweise auf den Alltag überträgt, erkennt: Auch menschliche Eigenschaften – Geduld, Zorn, Mitgefühl, Stolz – sind wandelbar. Sie gehören nicht „dir“, sondern sie wohnen in dir, so wie Farbe einer Blume anhaftet. Und wie jede Eigenschaft können sie gepflegt, gereinigt oder losgelassen werden.
Vom Einen und Vielen – Buch 8: Wissen und Erkenntnis
Das achte Buch führt von den Dingen zurück zum Denken – von der Welt der Eigenschaften zur Welt des Wissens. Kaṇāda fragt: Wie entsteht Erkenntnis?
Seine Antwort: Wissen ist eine Wirkung – es hat Ursachen, genau wie alles andere.
Die Ursache des Wissens liegt in der Substanz, wenn sie mit Eigenschaften und Bewegungen in Beziehung tritt. Wenn deine Sinne auf ein Objekt treffen, wenn Bewegung und Aufmerksamkeit zusammenwirken, entsteht Wissen. Es ist kein Wunder, kein Zufall, sondern ein regelhafter Vorgang.
Kaṇāda unterscheidet dabei zwischen dem Wissen als Prozess (das Erkennen) und dem Wissen als Ursache (die Grundlage für neue Erkenntnis).
Beispiel: Du erkennst, dass Feuer heiß ist. Dieses Wissen wird dann zur Ursache für dein Handeln – du meidest die Flamme.
Dieser Kreislauf beschreibt das, was Kaṇāda als kosmische Pädagogik des Lebens versteht: Alles, was geschieht, dient letztlich dazu, Bewusstsein zu vertiefen.
Er beschreibt außerdem, dass Wissen von Allgemeinem und Besonderem abhängt. Wenn du einen Baum siehst, erkennst du „Baumheit“ (das Allgemeine) und zugleich „diesen Baum hier“ (das Besondere). So entsteht konkrete Erkenntnis: aus dem Zusammenspiel von Gemeinsamkeit und Einzigartigkeit.
In diesem Denken liegt eine tiefe psychologische Wahrheit: Wir begreifen die Welt nur, indem wir Muster erkennen. Kaṇāda zeigt in gewissem Sinne auch, dass das Streben nach Wissen kein kalter Intellekt ist, sondern ein lebendiger Prozess des Erkennens von Zusammenhang und Differenz.
Für dich bedeutet das: Erkenntnis wächst, wenn du lernst, das Allgemeine im Besonderen zu sehen – etwa, wenn du in einem Konflikt nicht nur die Situation siehst, sondern das menschliche Muster dahinter.
Das Wissen jenseits der Sinne – Buch 9: Gewöhnliches und transzendentales Wissen
Im neunten Buch hebt Kaṇāda das Denken auf eine höhere Ebene. Er unterscheidet zwei Arten des Wissens: das gewöhnliche Wissen (laukika-jñāna) und das transzendentale Wissen (alaukika-jñāna).
Das gewöhnliche Wissen entsteht aus Sinneserfahrung, Erinnerung und Schlussfolgerung. Es ist das Wissen des Alltags – über Dinge, Menschen, Ereignisse.
Das transzendentale Wissen dagegen entspringt einer tieferen Wahrnehmung: der Erkenntnis dessen, was nicht-seiend ist, was jenseits der Sinne liegt.
Kaṇāda beschreibt das Nicht-Seiende nicht als Nichts, sondern als das, was dem Seienden vorausgeht oder folgt – das noch nicht Gewordene oder das Vergehende. Wenn du etwa sagst: „Der Topf ist zerbrochen“, erkennst du sowohl das Dasein als auch das Nicht-Sein. Diese Fähigkeit, das Abwesende zu erkennen, ist transzendentales Wissen.
Er führt auch den Begriff des Nichtwissens (avidyā) ein, das nicht bloße Unwissenheit ist, sondern eine fehlerhafte Erkenntnis – ein Wissen, das sich irrt.
Fehlerhafte Wahrnehmung entsteht durch Störung der Sinne oder Verwirrung des inneren Sinns. Wahrhaftes Wissen dagegen ist klar, kohärent und mit Erfahrung vereinbar.
Kaṇāda sieht Wissen als Werkzeug (karaṇa), Beweis (pramāṇa) und Ursache (hetu) zugleich. Erkenntnis ist also immer Mittel, Ziel und Wirkung – ein ununterbrochener Kreislauf von Wahrnehmung und Einsicht.
Das neunte Buch öffnet damit die Tür zu einer frühen Erkenntnistheorie: Wahrheit entsteht nicht einfach, sie wird geprüft, verglichen, verwoben.
Das ist ein Gedanke, der in moderner Philosophie – von Kant bis Husserl – wiederkehrt.
Für den Alltag: Das „transzendentale Wissen“ ist nichts Mystisches, sondern das intuitive Erkennen des Zusammenhangs hinter den Dingen – wenn du etwa spürst, dass etwas richtig oder falsch ist, bevor du es erklären kannst. Kaṇāda würde sagen: Das ist der Geist, der über die Sinne hinaus sieht.
Ursache, Wirkung und das Gewebe des Seins – Buch 10
Das letzte Buch schließt den Kreis. Hier geht es um die tiefste Struktur des Daseins: die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung (kāraṇa – kārya) und die unsichtbare Kraft der Inhärenz (samavāya), die alles miteinander verbindet.
Kaṇāda beginnt mit den Gegensätzen Wohl und Wehe, Glück und Leid. Beide sind Ergebnisse von Ursachen, aber keine reinen Geisteszustände – sie sind objektive Wirkungen in der Welt. Freude und Schmerz sind real, weil sie aus realen Bedingungen entstehen.
Das zeigt: Bewusstsein ist nicht losgelöst von der Welt, sondern Teil ihrer Kausalität.
Er unterscheidet dann verschiedene Arten von Ursachen: inhärente (die im Ding selbst liegen) und nicht-inhärente (äußere Bedingungen, die das Ding beeinflussen).
Beispiel: Der Ton eines Topfes „inhäriert“ in der Tonmasse – das Material ist die innere Ursache. Der Töpfer und sein Werkzeug sind die äußeren Ursachen.
Das Prinzip der Inhärenz erklärt, warum Dinge miteinander verbunden sind, ohne sich zu vermischen. Es ist das unsichtbare Band zwischen Ursache und Wirkung – die metaphysische Struktur hinter allen Beziehungen.
Kaṇāda sieht in dieser Ordnung eine letzte, stillere Bewegung: Die Dinge wirken aufeinander, und doch bleibt ein Teil von ihnen unverändert.
Das ist der Punkt, an dem seine Philosophie vom Beobachten ins Verstehen übergeht – von der Welt der Erscheinungen zur Welt der Prinzipien.
Mit dieser Erkenntnis endet der Kreis: Von der Substanz zur Seele, von der Bewegung zur Moral, von der Eigenschaft zum Wissen, und schließlich von der Ursache zur Einheit.
Manche meinen, Kaṇāda hat damit eines der ersten umfassenden Systeme der Weltbeschreibung geschaffen – eine Philosophie, die Natur, Ethik, Logik und Bewusstsein als Teile eines Ganzen versteht.
Praktische Anwendung – Ursache und Wirkung im eigenen Leben
Kaṇādas Lehre von Ursache und Wirkung ist weit mehr als Theorie. Sie kann als Selbstanalyse-System dienen:
- Welche Ursachen setze ich in meinem Leben unbewusst?
- Welche Wirkungen wiederholen sich?
- Welche „Inhärenzen“ – also inneren Muster – halten mich fest?
Hast du die Vaisesika Sutra gelesen?
Wenn ja, wie fandest du die Schrift?
Fazit
Das Vaisheshika-Sutra ist ein philosophisches und naturwissenschaftliches Grundlagenwerk des alten Indien.
Es beschreibt ein Universum aus ewigen Atomen, durchdrungen von Bewegung, Beziehung und Ordnung.
Sein Ziel ist es, durch das Erkennen dieser Ordnung den Menschen zur Einsicht, zur Achtsamkeit und schließlich zur Befreiung durch Wissen zu führen.
Ergänzung oder Frage von dir
Gibt es eine Frage zum Beitrag, etwas zu ergänzen oder vielleicht sogar zu korrigieren?
Fehlt etwas im Beitrag? Kannst du etwas beisteuern? Jeder kleine Hinweis/Frage bringt uns weiter und wird in den Text eingearbeitet. Vielen Dank!

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita

Weitere Shiva-Tantra-Schriften auf Yoga-Welten
Bücher zum Tantrismus


