Gibt es einen Zusammenhang zwischen Patañjali und dem Hatha-Yoga?
Ramananda schreibt:
Nein. Patañjali spricht in seinem Werk über den geistigen Yoga. Und dennoch meinen viele, dass im Yoga-Sutra auch von den Asanas des Hatha-Yoga die Rede ist. Dabei handelt es sich um ein Missverständnis, welches eine im Hatha-Yoga wichtige Frage entscheidend beeinflusst hat: Wie lange soll man in den Asanas verweilen? Betrachten wir kurz die zwei Abschnitte des Sutra, bei denen es um den Atem und um den Körper geht:
Von den 195 Sätzen des Sutra handeln zwei vom Pranayama (II, 49–50).
Nun kommen wir zu Pranayama, der vierten Stufe des achtfachen Raja-Yoga-Pfades, wie er im Yogasutra vorgestellt wird. Sutra II-49 wird von Vielen als Schlüsselsutra gesehen. Auch hier findet sich wieder ein relativ breites Spektrum an Übersetzungen sowie Verständnis von dieser Sutra. Pranayama bedeutet für einige mechanische Atemarbeit, andere verstehen darunter subtile Achtsamkeitsarbeit mit den feinstofflichen Energien. In II-49 wird Pranayama eingeführt ► Was ist Prana? ► Was bedeutet Pranayama? ► Gründe für Pranayama ► Gefahren von Pranayama ► Übersetzungsalternativen ► Hintergrund ► Wirkungsabläufe ► ... In dieser Sutra wird Patanjali zum Glück deutlicher in Bezug auf Pranayama. Aber dennoch bleibt viel Interpretationsspielraum zu den einzelnen Gliedern des Pranayama und deren korrekter Regulierung. Manche Kommentatoren lehnen eine Regulierung des Atems sogar komplett ab und wollen Pranayama auf Beobachtung und subtile Steuerung beschränken. In II-50 werden die einzelnen Bestandteile und das Ziel des Pranayama angesprochen ► Was wird unter „Zeit, Ort und Anzahl“ verstanden? ► Wie verlängern und verfeinern? ► Übersetzungsalternativen ► Lohn der Pranayama-PraxisBeitrag: Yoga Sutra II-49: Wenn der Yogi lange Zeit unbewegt bequem sitzen kann, beginnt er mit Pranayama, der Kontrolle über die Bewegung von Ein- und Ausatmung
 Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वास्योर्गतिविच्छेदः प्राणायामःBeitrag: Yoga Sutra II-50: [Beim Pranayama werden] Zeit, Ort und Anzahl der Einatmung, Ausatmung und des Anhaltens reguliert und laufend verlängert und verfeinert.
 Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः
Shri Patañjali beschränkt sich auf seine Erwähnung, setzt ihn als bekannt voraus. Außerdem, und dies ist viel wichtiger, betont er nur die meditative Bedeutung des Atems (I, 34 und II, 51, 52, 53).
Yoga Sutra I-34: [Der Geist wird klar] durch (kontrolliertes) Ausstoßen oder Anhalten des Atems Patanjali kommt zum Pranayama. Der bewussten Beeinflussung des Atems (konkrete Hinweise kommen von den Kommentatoren) ermöglicht tiefgehende Erfahrungen. Oder ist diese Sutra ganz anders gemeint? Schauen wir uns die Übersetzungsvarianten an: Es wird geheimnisvoll: An dieser „kryptischen“ Sutra scheiden sich die Geister bei der Deutung des „vierten Zustandes“. Für manche wird hier schon Samadhi erreicht. In II-51 wird „das Vierte“ Pranayama thematisiert ► Deutungen des vierten Pranayama ► Übersetzungsalternativen ► Wie dieser Zustand zu erreichen ist Yoga Sutra II-52: Wenn dies erreicht ist, löst sich der Schleier um das innere Licht auf Nun kommt Patanjali zu den Vorteilen der Pranayama-Praxis, dem Lohn. Wir zerstören damit den Schleier, der uns die tiefe Erkenntnis verdeckt. Doch was hat es mit diesem Schleier auf sich und was genau verdeckt er? In II-52 thematisiert Patanjali einen Schleier über unserer Wahrnehmung, der von Pranayama aufgelöst werden kann ► Deutungen des Schleiers ► Was ist das innere Licht? ► Wirkungsabläufe von Pranayama ► Übersetzungsalternativen Yoga Sutra II-53: Und der Geist wird fähig zu tiefer Konzentration Dharana, die Konzentration, ist eigentlich erst die übernächste (sechste) Stufe auf dem achtfachen Pfad des Ashtanga Yoga. Patanjali beschreibt aber schon hier die förderliche Wirkung der Atemberuhigung auf die Konzentrationsfähigkeit. In II-53 schreibt Patanjali, dass Pranayama die Konzentration fördert ► Wie Pranayama den Geist zur Konzentration befähigt ► Übersetzungsalternativen ► Zusammenhang Gedanken und Atem ► Mit Pranayama zu den Jhanas (Vertiefungen der Meditation) Hier weiterlesen: Yoga Sutra II-53: Und der Geist wird fähig zu tiefer KonzentrationBeitrag: Yoga Sutra I-34: [Der Geist wird klar] durch (kontrolliertes) Ausstoßen oder Anhalten des Atems
 Pracchardana–vidharanabyam va pranasya
Pracchardana–vidharanabyam va pranasya
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्यBeitrag: Yoga Sutra II-51: Die vierte Art des Pranayama überschreitet die Erfahrung von Einatmung und Ausatmung
 bāhya-ābhyantara viṣaya-akṣepī caturthaḥ
bāhya-ābhyantara viṣaya-akṣepī caturthaḥ
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थःBeitrag: Yoga Sutra II-52: Wenn dies erreicht ist, löst sich der Schleier um das innere Licht auf
 Tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam
Tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्Beitrag: Yoga Sutra II-53: Und der Geist wird fähig zu tiefer Konzentration
 Dharanasu cha yogyata manasah
Dharanasu cha yogyata manasah
धारणासु च योग्यता मनसः
Das leuchtet ein. Der Sinn des Pranayama ist das Erwachen und Aufsteigen der Kundalini. Von Chakras, von einer Urkraft, von ihrer Beeinflussung mittels körperlicher Übungen und Atemtechniken, Begriffe aus der tiefgründigen Welt des Tantra, ist im Sutra nichts zu finden. Shri Patañjalis Schwerpunkt waren nicht die mannigfaltigen, ohne Zweifel wichtigen Übungen des Tantra, vielmehr die Essenz aller Übungen und Wege: Konzentration und Meditation. Bereits bei den Atmungen ist dies zu erkennen; ihre höchste Stufe ist keine Technik, vielmehr der völlig ruhige, fast unmerkliche Meditationsatem, bei welchem von einer Kontrolle des Ein- und Ausatmens nicht mehr gesprochen werden kann. Auch daran sieht man, dass Shri Patañjali durchgehend den geistigen Anteil der Dinge betont.
Von den 195 Sätzen des Sutra handeln vier von EINER Körperstellung, und wie das Atmen ist auch sie nur auf das Meditative bezogen. Welche Stellung? Mit Asana (wörtlich: »das Sitzen«) sind hier weder Dehnungen noch Kraftübungen gemeint, auch nicht der Kopfstand (eine typisch tantrische Technik zur Erweckung der Urkraft) und anderes, sondern eine beliebige, für die Meditation geeignete Sitzhaltung. Man betrachte die zusammengehörenden Sätze II, 46–49.
Diese Sutra wird höchst unterschiedlich übersetzt. Die Befreiung von der Spannung wird größtenteils einvernehmlich ausgelegt, aber die „Versenkung in das Unendliche“ und der Weg dorthin werden kontrovers interpretiert. In II-47 gibt Patanjali grundlegende Empfehlungen zur Meditation ► Wie du dich in der Sitzhaltung von Spannungen befreist ► Wie die Versenkung in das Unendliche erreicht werden kann ► Wie diese Sutra auf körperliche Yogaübungen übertragen werden kann ► Übersetzungsalternativen ► Umfragen Patanjali schreibt, dass der Yogi, so er die Asana gemäß II-46 und II-47 meistert, nicht mehr von den Dualitäten dieser Welt beeinträchtigt wird. Sein Wirken und Handeln wird nicht mehr von den „Gegensatzpaaren“ bestimmt oder eingeschränkt. Was ist darunter konkret zu verstehen? In II-48 schildert Patanajali, was aus der Meisterung der Asana folgt ► Beispiele für Gegensatzpaare ► Was meint „Meisterung der Asana“? ► Übersetzungsalternativen ► Umfrage Nun kommen wir zu Pranayama, der vierten Stufe des achtfachen Raja-Yoga-Pfades, wie er im Yogasutra vorgestellt wird. Sutra II-49 wird von Vielen als Schlüsselsutra gesehen. Auch hier findet sich wieder ein relativ breites Spektrum an Übersetzungen sowie Verständnis von dieser Sutra. Pranayama bedeutet für einige mechanische Atemarbeit, andere verstehen darunter subtile Achtsamkeitsarbeit mit den feinstofflichen Energien. In II-49 wird Pranayama eingeführt ► Was ist Prana? ► Was bedeutet Pranayama? ► Gründe für Pranayama ► Gefahren von Pranayama ► Übersetzungsalternativen ► Hintergrund ► Wirkungsabläufe ► ...Beitrag: Yoga Sutra II-47: Bemühe dich in der Asana [Sitzhaltung in der Meditation] um tiefe Entspannung und versenke deinen Geist in das Unendliche
 prayatna-śaithilya-ananta-samāpatti-bhyām
prayatna-śaithilya-ananta-samāpatti-bhyām
प्रयत्नशैथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्Beitrag: Yoga Sutra II-48: Dadurch [die Meisterung der Asana] können die Gegensatzpaare den Yogi nicht mehr angreifen
 Tato dvandvānabhighātaḥ
Tato dvandvānabhighātaḥ
ततो द्वन्द्वानभिघातःBeitrag: Yoga Sutra II-49: Wenn der Yogi lange Zeit unbewegt bequem sitzen kann, beginnt er mit Pranayama, der Kontrolle über die Bewegung von Ein- und Ausatmung
 Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वास्योर्गतिविच्छेदः प्राणायामः
Obwohl man Patañjalis Worte eigentlich nicht missverstehen kann, sind viele Yogalehrer und Buchautoren der Meinung, mit »Asana« seien hier auch die Stellungen des Hatha-Yoga gemeint. Zu welcher Konsequenz hat dies geführt?
Es gibt den Fachbegriff Asana-siddhi, die Vollkommenheit im Asana. Diese ist erreicht, wenn man mehr als drei Stunden lang ohne Schwierigkeit in einer (Sitz-!)Haltung verweilen kann. Logisch und in der Praxis für jeden nachvollziehbar. Man nehme einen beliebigen Meditationssitz mit gekreuzten Beinen. Schon nach wenigen Minuten schlafen die Füße ein, schmerzen Knie und Rücken, sind Schultern und Nacken verspannt. »Die Versenkung in das Unendliche« (II, 47) klingt wie ein Hohn!
Patanjali schreibt, dass der Yogi, so er die Asana gemäß II-46 und II-47 meistert, nicht mehr von den Dualitäten dieser Welt beeinträchtigt wird. Sein Wirken und Handeln wird nicht mehr von den „Gegensatzpaaren“ bestimmt oder eingeschränkt. Was ist darunter konkret zu verstehen? In II-48 schildert Patanajali, was aus der Meisterung der Asana folgt ► Beispiele für Gegensatzpaare ► Was meint „Meisterung der Asana“? ► Übersetzungsalternativen ► UmfrageBeitrag: Yoga Sutra II-48: Dadurch [die Meisterung der Asana] können die Gegensatzpaare den Yogi nicht mehr angreifen
 Tato dvandvānabhighātaḥ
Tato dvandvānabhighātaḥ
ततो द्वन्द्वानभिघातः
Mit Geduld und Ausdauer aber wird der Sitz besser. Irgendwann spürt man den Körper vielleicht erst nach einer halben Stunde, und man muss die Beine ausstrecken und den Rücken lockern. Mit zunehmender Übung kann man länger und länger verweilen. Der Yoga setzt einen Maßstab:
Wer über drei Stunden ungestört sitzen kann, hat es geschafft (siddhi = das Gelingen): Die Haltung ist so angenehm, dass man den Körper nicht mehr wahrnimmt.
Dann, und nur dann, kann der Geist in die Meditation eintauchen.
Nun verhält es sich so, dass seit langer Zeit mit »Asana« nicht mehr allein »der Sitz«, sondern allgemein »die Körperhaltung« verstanden wird: Bhujangasana, Trikonasana, Chakrasana, Shalabhasana, Shirshasana …
Asana-siddhi auf solche Haltungen anwenden zu wollen – das geht selbstverständlich nicht. Der wie immer pragmatische Mensch sagt in diesem Fall, um nicht von seinem Standpunkt abweichen zu müssen: Man halte alle Stellungen »so lange wie möglich«.
Eine zu glatte Formulierung, die es erlaubt, bequem einen Bogen um den Begriff Verantwortung zu machen, denn damit lässt man den Schüler alleine. Was bedeutet »so lange wie möglich«? Bei Shalabhasana kann es ja nur um Sekunden gehen, in der Kobra vielleicht um eine Minute, im Kopfstand dagegen pflegen »fortgeschrittene« Yogis eine Stunde und länger zu verweilen, ebenso in anderen Stellungen, welche in mehrfacher, vor allem in gesundheitlicher Hinsicht problematisch sind.
Von einem der prominentesten Hathayoga-Meister Indiens hören wir die kuriose und für die Tradition dennoch typische Behauptung: »Bleibt man in der Zange drei Stunden und achtundvierzig Minuten sitzen [= asana-siddhi], dann besteht die Möglichkeit, dass sich spontan ein Samadhi-Zustand einstellt.« Dass es sich hier nicht um einen einmaligen Ausrutscher handelt, beweist die darauffolgende Feststellung: »Der Nutzeffekt der Zange steht in direktem Zusammenhang mit der Zeitdauer. Sie gehört zu den Asanas, die man stundenlang praktizieren muss und kann«.
Vor allem in indischen Yogabüchern findet man viele Sätze wie die gerade erwähnten. Sie sind durchaus logisch, wenn man den Begriff Asana-siddhi von den Sitzhaltungen auf die Körperstellungen überträgt, kennzeichnen aber einen falsch verstandenen Hatha-Yoga. Gerade die Zange (Pascimottanasana) eignet sich hier gut als Negativbeispiel. Selbst bei korrekter, und das muss bedeuten; bei vollkommener Ausführung, nämlich mit geradem Rücken, sollte sie maximal eine Minute gehalten werden: Eine gewisse Streckung der Rückseite, eine Kompression der Bauchseite. Nun wird aber die Zange in der Regel falsch, mit rundem Rücken gemacht, und stellt so bereits bei kürzester Verweildauer eine gefährliche Belastung der Kreuzgegend dar. Ein Samadhi-Zustand stellt sich gewiss nicht ein; man darf sich beim Schicksal bedanken, wenn man nicht mit einem Bandscheibenvorfall in der Notaufnahme einer Klinik landet.
Es sei festgehalten:
- Erstens: Asana-siddhi betrifft ausschließlich Sitzhaltungen zum Zwecke der Konzentration und Meditation.
- Zweitens: Shri Patañjali kann mit Asana im Satz 46 nicht generell die Asanas des Hatha-Yoga gemeint haben, sonst wären seine nachfolgenden Bemerkungen unsinnig.
II, 46: sthira-sukham-asanam = heißt das »der Sitz – oder die Körperstellung – sei fest und angenehm«?
Diese Sutra wird höchst unterschiedlich übersetzt. Die Befreiung von der Spannung wird größtenteils einvernehmlich ausgelegt, aber die „Versenkung in das Unendliche“ und der Weg dorthin werden kontrovers interpretiert. In II-47 gibt Patanjali grundlegende Empfehlungen zur Meditation ► Wie du dich in der Sitzhaltung von Spannungen befreist ► Wie die Versenkung in das Unendliche erreicht werden kann ► Wie diese Sutra auf körperliche Yogaübungen übertragen werden kann ► Übersetzungsalternativen ► UmfragenBeitrag: Yoga Sutra II-47: Bemühe dich in der Asana [Sitzhaltung in der Meditation] um tiefe Entspannung und versenke deinen Geist in das Unendliche
 prayatna-śaithilya-ananta-samāpatti-bhyām
prayatna-śaithilya-ananta-samāpatti-bhyām
प्रयत्नशैथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्
Die Frage erübrigt sich, wenngleich man darüber theoretisieren mag, ob die Heuschrecke, das Rad und ähnlich intensive Stellungen fest und angenehm sind. Für die nächsten Sätze scheidet aber auch diese Interpretation aus. II, 47: »Dies (d. h. der feste und angenehme Sitz) gelingt durch das Schwinden der Anstrengung und durch Versenkung in das Unendliche.« II, 48: »Von da her entsteht das Nichtgestörtwerden durch die Gegensätze.« II, 49: »In diesem (Asana) seiend, übe man den Pranayama.« Dies alles kann sich einzig und allein auf eine Sitzhaltung beziehen.
© Helmuth Maldoner. Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch »Die Heilwirkungen des Yoga«:
-
-Anzeige-
Die Heilwirkungen des Yoga*
chmerzfreier Körper, friedvoller Geist: Band 1: Der therapeutische Hathayoga; von Helmuth Maldoner | Bei Amazon 🔎
Die Antworten lauten wie folgt:
Larrim
Namaste,
In vielen Punkten stimme ich dir vollständig zu, aber Swatmarama schreibt ja sinngemäß am Beginn der Hatha Yoga Pradipika: "Wer Hatha Yoga übt, ohne den Raja Yoga zu kennen, der verschwendet seine Zeit".
Einige Meister, wie beispielsweise Sri S. Rajagoplan, bei dem ich schon sehr lange den Yoga erlerne, haben es hervorragend geschafft, den Transfer des Raja Yogas in die Körperübungen, die ja nun weithin heutzutage Asanas genannt werden, obwohl Patanjali darunter ursprünglich nur die reinen Sitzhaltungen gefasst hat, zu vermitteln.
Yoga ist eine lebendige Wissenschaft. Alle Körperübungen können enorm an Intensität und Tiefe gewinnen, wenn sie im Geiste des Raja Yoga ausgeführt werden. Aufgrund der Tatsache, dass heute vielfach der Yoga zu einer Art "Deluxe-Gymnastik" verkommen ist, halte ich es für hilfreich, die Yoga Sutras auch auf die körperlichen Übungen zu beziehen.
Historisch gesehen hast du also recht, aber in der Praxis ist es dennoch wertvoll und wichtig, den Geist in die Hatha Yogaübungen zu transportieren, um ein mechanisches "Dahin-Geturne" zu vermeiden.
Licht und Liebe
Lars
Norman
Guten Tag & namaste,
die Frage am Anfang des Beitrags war: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hatha-Yoga und dem, was Patanjali zugeschrieben wird? Dieses ausschließende "Nein" ist mit der Auffassung vom Karma schwer in Einklang zu bringen. Die Chaostheorie weiß von dem berühmten Schmetterlingsschlag, der einen Orkan am anderen Ende der Welt hervorbringen kann...
Nach meinem Wissen haben – wenn es den Menschen Patanjali wirklich gegeben hat (es gibt einige Schriften, die durchaus begründete Unklarheiten hinsichtlich der vorliegenden Texte und dem Autor vorbringen) – der Autor/die Autoren bestehendes Wissen in Form der Sutras zusammengeführt: Inhalte aus dem Samkya und dem damaligen Yoga; Mystik, schamanistische Techniken der Arier und Ureinwohner und auch ethische Überlegungen zusammen als einen "methodischen" Weg vereint.
Vielleicht noch mehr.
Die Ethik (Yama) war wohl ein "Zusatzbeitrag". Niyama enthält Tapas (nicht immer angenehm) und die Verbindung zum Göttlichen. Wohl der Tatsache eingedenk, dass eine exakte jahreszeitliche Einordung des Textes (300 v. Chr. bis 300 n.Chr.) bisher nicht erfolgte: Können wir nun wirklich auf oben gestellte Frage ausschließlich mit "Nein" antworten? Wir könnten. Doch das würde bedeuten, dass wir annehmen müssten, dass keinerlei Zusammenhang zwischen den Erscheinungen der Welt besteht.
So sehe ich schon eine Verbindung. Allein die Kernstücke ( Asana - Sitz, Pranayama, Pratyahara, Dahrana) sind in der HP (Hatha Pradipika) enthalten. Nur die Gewichtung ist verschieden.
Ramananda schrieb: "Es sei festgehalten: Erstens: Asana-siddhi betrifft ausschließlich Sitzhaltungen zum Zwecke der Konzentration und Meditation. Zweitens: (...)"
Da der Autor/die Autoren der Sutras wesentlich früher lebten, können sie sehr wahrscheinlich nicht die Haltungsbeschreibungen in der HP gemeint haben. Einen großen Variantenreichtum an Sitzhaltungen gibt es in der HP bzw. im zu jener Zeit (wohl einige Jahrhunderte nach Niederschrift der Sutras) praktizierten Übungsgut. Doch zusätzlich einige Haltungen, die nicht mehr mit "Sitz" identisch sind.
Da Schriftstücke nur einen Ausschnitt des Ganzen darstellen können, besteht nach meinem Verständnis der Dinge schon eine Verbindung zwischen den (Sitz-)HALTUNGEN in der HP und den Sutras. Sie enthalten offensichtlich überlieferte Grundelemente des informellen Yoga(-lehr-)pfads. Wenn auch die unterschiedlichen prozentualen Anteile das nicht offensichtlich erscheinen lassen, sehe ich Zusammenhänge.
D. h. nicht, dass ein direkter Zusammenhang besteht. Aber es könnte auch angenommen werden, dass die Sutras wie die HP genau an dieser (körperlichen/ materiellen) Stelle Gemeinsamkeiten haben, oder? Das Geistig/Göttliche körperlich-materiell wahrnehmen (purusha-prakriti); als Verbindung erleben – Hatha. So sind für mich die Sutras und die HP zwei Perlen an einer nie endenden Kette, die keinen Anfang hat neben den unzähligen, die nicht hervorstechen. Vielleicht sogar nebeneinander ...
Om shanti
Norman
Besma
Nur eine kurze Frage: Ist Hatha Yoga nicht ein Teil von Raja Yoga? Asana ist doch eines der acht Glieder bei Patanjali, auch wenn damit wohl "nur" das Sitzen gemeint ist.
Wintersun
Hi Besma,
Hatha Yoga ist nicht gleich (nur) Asana (Üben). Hatha Yoga ist meiner Meinung nicht ein Teil des Raja Yoga. An einigen Stellen des Forums wurde schon darüber diskutiert. Leider verstehe ich das mit der Suchfunktion nicht so ganz und habe nur einen kleinen Teil wiedergefunden. Für mich ist die Aussage "Hatha Yoga ist nur eine Vorstufe von Raja Yoga" immer noch nicht nachvollziehbar. Gründe hatte ich an anderen Stellen des Forums genannt.
In den Texten "Patanjali Yogaschule Münster – Skripte zum Yoga der achtgliedrige Yoga des Patanjali" ist zu finden:
"Die Trennung zwischen Hatha-Yoga und Raja-Yoga, die häufig gelehrt wird, ist nicht haltbar und entspringt dem westlich wissenschaftlichen Geist, alles in Fragmente zu zerteilen Es gibt nur einen Yoga."
Besma
Ich weiß, dass Hatha Yoga nicht nur Asana bedeutet, sonst hätte ich ja nicht gefragt :). Und ich meinte ja, es ist EINES der acht Glieder, also gibt es ja noch sieben weitere.
Nein. Ich versuche irgendwie einen Zusammenhang für mich herzustellen und die Unterschiede zu verstehen. Wenn es nur Yoga gibt, was ist es dann für ein Yoga? Ist es das Yoga, welches Patanjali beschreibt und das aus den acht Gliedern besteht, also Ashtanga Yoga? Bitte entschuldige mein plumpes Fragen, aber ich versuche einfach zu verstehen.
Wie verhält es sich dann mit Bakthi, Karma, Jnana-Yoga? Mir wurde gelehrt, dass diese zusammen mit Hatha Yoga die Säulen des Yoga bilden und Raja der königliche Yoga ist, der über allem steht.
Besma
Also nachdem ich den Text gelesen habe, ist zumindest der letzte Teil meiner Frage für mich beantwortet.
"Alle Wege führen zur Quelle ..."
Wenn ich die Beschreibung bei Wikipedia lese, dann steht dort, dass es im Grunde nur Raja Yoga gibt und Hatha Yoga erst später dazu kam und erwähnt wurde, um Raja Yoga als geistigen vom Hatha Yoga, dem körperlichen Yoga zu trennen (ich weiß, das stand schon im Beitrag, aber ich fasse für mich zusammen).
Für uns heutige Menschen macht Hatha Yoga ja durchaus Sinn, denn der Köper muss ja von Krankheit und Verspannung befreit werden, damit der Geist überhaupt frei ist, um sich etwas anderem zuzuwenden, als dem Alltag. So gesehen ist also doch Hatha Yoga ein Teil von Raja Yoga, wenn man nicht bei den Asanas aufhört. So habe ich es jetzt verstanden.
Wintersun
"Hatha Yoga war anfänglich zur Unterstützung anderer Yoga-Formen konzipiert, erfreute sich jedoch rasch großer Beliebtheit und wurde schon bald als eigenständige Yoga-Form betrachtet. Dort grenzt er den spirituellen Yoga (wie etwa Raja Yoga) vom körperlichen Yoga (Hatha Yoga) ab. Hatha Yoga bezeichnet hier eine Stufe auf dem Weg zum Raja Yoga." [Quelle: Wiki - https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hatha_Yoga ; Kein Anspruch auf Aktualität]
Hi Besma,
keine Ahnung, wo das aus dem Wiki herkommt, meine Sicht ist eine andere. Auch die Literaturliste dazu im Wiki finde ich nicht überzeugend.
Hier einige Zitate, die mein Verständnis vom Hatha Yoga formen:
Aus dem:
... das mein wichtigstes Nachschlagwerk ist, in dem Kapitel Hatha Yoga - 5.14 Samadhi:
"Samadhi bezeichnet das Ziel des Hatha Yoga wie auch das Ziel anderer Yogawege, etwa des Patanjali Yoga." (Anmerkung von mir: Das bedeutet für mich ganz klar: Hatha Yoga ist nicht Teil des Patanjali Yoga.)"
In der Hathapradipika wird mehrfach als Synonym für Samadhi die Bezeichnung Raja Yoga verwendet.
In dem Kapitel Hatha Yoga - 5.5 Asana:
"Erst aus späteren Kommentaren zu den Yogasutras, z. B. in dem von Vyasa (6 - 8 Jahrhundert nach Chr.), wird deutlich, dass hier padmasana gemeint war, und zwar der gebundene Lotossitz, ... "
In dem Kapitel Hatha Yoga - 5.3 - Geschichte des Hatha Yoga:
"Obwohl der Hatha Yoga zu den bekanntesten und am meisten praktizierten Yoga-Wegen gehört, ist seine Geschichte wenig erforscht. Es gibt wenig gesichertes Quellenmaterial, und vieles verliert sich im Mythos."
Vor kurzem hatte ich noch das hier gelesen:
"... Frau Blavatsky hielt die Zeit für gekommen, die geistigen Techniken des indischen Raja-Yoga für ihre Anhänger zu empfehlen. Wie wir heute wissen, war es vor allem der indische Yogin Svami Vivekananda, der gegen 19. Jahrhunderts den Begriff „Raja-Yoga“ in Indien popularisiert hatte. Mit dem Terminus „Raja-Yoga“ bezeichnete Vivekananda die Traditionen und Techniken auf der Grundlage der Yogasutras des Patañjali.
Mit Svami Vivekananda teilte Frau Blavatsky die Wertschätzung des Raja-Yoga und seiner meditativen Techniken. Und mit Vivekananda teilte sie auch die Ablehnung des sogenannten Hatha-Yoga, jener relativ späten Entwicklung des indischen Yoga, die zunächst vor allem am physischen Geschehen des Übenden ansetzt. Frau Blavatsky ging aber noch weiter. Der Hatha-Yoga, der unter anderem die Vielzahl der uns heute so geläufig erscheinenden Körperübungen (asana) und Atemtechniken (pranayama) hervorgebracht hat, galt ihr als höchst gefährlich und moralisch äußerst verwerflich. Sie ging sogar so weit, dem Hatha-Yoga „dämonische“ Kräfte zu unterstellen und warnte in diesem Sinne ..."
[Quelle: http://www.yoga-akademie.de/YoInDeutsch.htm ; Kein Anspruch auf Aktualität]
Vielleicht kommt hier teilweise das Bild her, dass Raja Yoga ein "höheres" Yoga ist, als das Hatha Yoga.
Liebe Grüße :)
Wintersun
Besma
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Ich hätte mir ja ein paar einfache, klar erklärende Sätze gewünscht, aber ich fürchte, das wird nix.
Wiki war sowieso sehr spärlich mit den Erklärungen.
Ich möchte einfach einem Freund erklären können, was Hatha Yoga ist und woher es kommt, und immer wenn ich es versuche, dann verliere ich mich irgendwo, weil sich für mich kein rundes Bild ergibt. Woher kommt denn nun Hatha Yoga, oder sollte ich dazu vielleicht ein neues Thema aufmachen? Allerdings ist es für mich immer noch unklar, was nun Hatha Yoga von dem Yoga des Patanjali so sehr unterscheidet. Wir Hatha Yogis machen ja auch Pranayama, meditieren, sind achtsam, versuchen unseren Geist durch die Asanas zur Ruhe zu bringen und den Körper gesund zu erhalten. Wir versuchen die Kleshas, ich sag es mal etwas drastisch, aus dem Weg zu räumen und so gut wie möglich uns an die Yamas und Niyamas zu halten ...
Vielleicht versteh ich es auch einfach nicht und stehe auf der Leitung.
Bitte um Geduld ...
Wintersun
Ich habe mir aus dem, was ich gehört und gelesen habe, mein Bild gebastelt, was Hatha Yoga für mich ist. Das kann ich aber leider nicht in einen einfachen Satz zusammenfassen. Mein Bild ist sicher auch unvollständig. Es muss ja auch nicht das gleiche Bild sein, das Du Dir von Hatha Yoga machst. In meinen Notizen habe ich mal dazu aufgeschrieben:
Hatha-Yoga ist ein Yogaweg, der Körperübungen als Werkzeug und Hilfsmittel benutzt, um Körper, Geist und Atem miteinander in Gleichklang zu bringen.
Was bedeutet es, Körper, Geist und Atem miteinander in Gleichklang zu bringen? Iyengar schreibt (in "Der Baum des Yoga"): "Da alle Wege zur Quelle führen, bringt auch Hatha Yoga den Menschen zum Anblick der Seele". Und in "Licht auf Yoga" schreibt er über die letzten drei Stufen - Dharana, Dhyana und Samadhi: "In tiefer Meditation werden Erkennender, Erkenntnis und Erkennen eins".
Hatha-Yoga ist ein Weg, der die Yoga Sutras von Patanjali anerkennt. Hier ist Yoga definiert als "das Aufhören des Kreisens der Gedanken".
Ich denke mal, dass die Yogasutren so eine Art Grundlagenwerk für fast alle Yogatraditionen ist - also allgemeingültig - egal ob ich nun Yoga mit oder ohne Asana praktiziere.
Besma
Vielen Dank nochmal für deine Mühe. Es leuchtet mir so jedenfalls sehr gut ein.
"Licht auf Yoga" habe ich auch, aber es ist schon nicht ganz so einfach zu lesen für einen Anfänger und als solchen bezeichne ich mich.
Danke dir also nochmal ganz herzlich!
Ich werde nochmal in meinen Büchern schmökern und sicher früher oder später mir einen Eindruck verschafft haben. Ich will immer alles zu schnell und darum mache ich Yoga :).
Wintersun
Hi,
mir ist heute Abend noch Richard Rosen eingefallen und habe mal gegoogelt. In den Podcast habe ich die ersten 15 Minuten reingehört und werde ihn mir die nächsten Tage noch zu Ende anhören. Fand ich bisher sehr interessant. Ist allerdings in Englisch.
Link zum Podcast: https://www.ihanuman.com/features/introduction-history-hatha-yoga-richard-rosen
Besma
Danke! Das mit dem Englisch macht nichts. Was ich hier mal off Topic (um beim Englisch zu bleiben) empfehlen kann, sind bei YouTube die Vorträge von Peter Pandoer. Ein klasse Mann wie ich finde.
Ja, dann hör ich da jetzt mal rein! Freu mich, danke!
Tulsi
Diesen kleinen Artikel habe ich kürzlich gefunden.
Man darf bei dieser Diskussion eines nicht vergessen: Zu Patanjalis Zeiten war das Weltbild von der Ansicht geprägt, dass das göttliche Prinzip und die Natur zwei voneinander getrennte Aspekte sind. Und die Natur darf sich auflösen, damit die menschliche Seele (bis dahin von der Natur umhüllt) sich als göttlich erkennt. Erst der Tantrismus sah die Natur auch als göttlich an, und das gab einen grundlegenden Wandel in der Anschauung der Welt, der Natur, des Körpers, der Sinne, der Frauen ... Und daher begann der Yoga, sich auch für die körperliche Gesundheit zu interessieren. Bis dahin war Asana nur eine möglichst praktische Position, in die der Körper "aufgeräumt" wurde, um bei der Meditation nicht zu stören. Mit dem Aufblühen der tantrischen Kultur wurde aus dem Störfaktor ein Gefährt, ohne das kein Ziel zu erreichen ist. Und damit begann der Hatha Yoga, tatsächlich noch gar nicht lange her. Aber welche Durchsetzungskraft!!!
Herzliche Grüße
Tulsi
Wintersun
Ein schöner Artikel, danke für den Hinweis. Mir gefällt diese Stelle sehr gut:
"Yoga in der heutigen Form ist ohnehin weder indisch noch westlich. Es ist durch und durch transnational und interkulturell, ist irgendwo zwischen den Kulturen anzusiedeln. Wer hierbei noch auf den Besitz der eigentlichen Wurzeln und dem «wahren» Yoga beharrt und Mauern zu ziehen versucht, versteht nicht, dass Kulturen grundsätzlich porös sind. «Multikulti» steht am Anfang, nicht am Ende."
Aus einem Artikel der NZZ "Auf der westöstlichen Übungsmatte" von Dr. Axel Michaels:
Zum Thema – Was ist (ursprüngliches) Hatha Yoga, was für einen Yoga übe ich, was unterrichte ich (diese Frage habe ich mir in den letzten Monaten öfters gestellt) – noch ein Zitat aus einem Artikel:
"Heutige Hatha-Yoga-Lehrer sehen sich mit zusätzlichen Fragen konfrontiert, die im Prinzip auf folgendes hinauslaufen: Was lehre ich, und warum lehre ich es? Wenn ich die Tradition des Hatha-Yoga studiert habe, dann ist mir bewusst, dass diese Disziplin ursprünglich viele Stunden täglicher, häufig sehr anstrengender, körperlicher Stärkungs- und Reinigungsübungen bedeutete, begleitet von langen Zeitperioden intensiven Pranayamas und intensiver Meditation. Doch wenn ich in diesem traditionellen Geist weder praktiziere noch unterrichte, dann wäre es ratsam, meinen Platz innerhalb der Hatha-Yoga-Tradition neu zu bestimmen."
Aus der dem Artikel ' Yoga gegen Yoga' von Mikel Burley (gelesen auf yoga-aktuell.de, leider nicht mehr verfügbar)
Liebe Grüße
Wintersun
Larrim
Namaste Tulsi,
Lieben Dank für den interessanten Link zum Artikel. Ganz besonders die Passage zu den angemeldeten Trademarks auf einzelne Übungen bzw. Übungsreihen hat mich sehr angesprochen. Sie brachten vor, dass Yoga-Positionen Allgemeingut seien, die jedem öffentlich zugänglich sein müssten. Ich denke, Yogaübungen zu patentieren, ist ähnlich unseriös wie Patente auf Genmuster anzumelden.
Licht und Liebe
Lars
Besma
Eine immer besser werdende Diskussion. Vielen Dank!
Yeswecan
Hallo Wintersun,
danke für den Link zum Artikel. Ich denke, dieser enthält einiges, was der Überlegung wert ist. Yogalehrerinnen und -lehrer sollten mal reinsehen.
Liebe Grüße
Yeswecan
Woher stammen diese Beiträge?
Früher gab es auf Yoga-Welten.de einen Forumsbereich. Dieser musste aus technischen Gründen abgeschaltet werden, es gab aber auch fast keine neuen Diskussionen mehr.
Um die oftmals sehr wertvollen Beiträge der Forumsteilnehmer zu "retten", habe ich die ursprünglichen Posts als Grundlage für eine Neuformulierung genommen und zu einem eigenständigen Text umgeschrieben.
Dabei wurden auch Dopplungen, Rechtschreibfehler und auch themenfremde Postings korrigiert, gekürzt oder ganz weggelassen. Diese "Straffung" erleichtert den Einstieg ins Thema. Zudem wurden die Texte neu formuliert und um Sachverhalte, Bilder etc. ergänzt. Fehler durch diese Textergänzungen etc. sind natürlich nur mir anzulasten. Ich hoffe aber und habe mich sehr darum bemüht, dass die Aussagen der Forenteilnehmer dabei nicht verfälscht wurden.
Unter jedem Posts gibt es die Möglichkeit, diesen weiterhin zu ergänzen, auf Fehler aufmerksam zu machen usw.
Kannst du etwas ergänzen?
Möchtest du etwas zu dem Gesagten ergänzen?
Bitte antworte mit Namen oder Namenskürzel, dann können die Antworten zugeordnet werden. Aber anonyme Ergänzungen sind ebenfalls wertvoll.
Siehe auch
Raja Yoga nach Patanjali – die acht Stufen erklärt
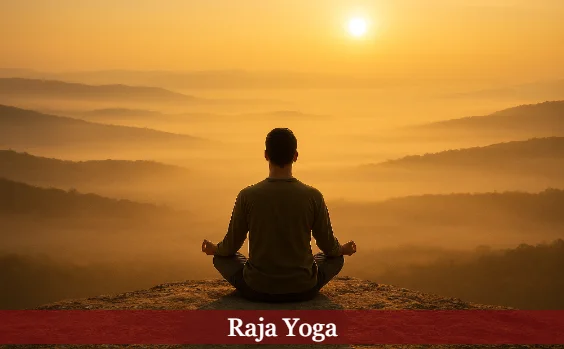
Raja Yoga nach Patanjali – die acht Stufen erklärt
Dieser Artikel bietet dir eine klare und fundierte Orientierung zum Raja Yoga – einem klassischen Pfad zur Selbstbeherrschung und Bewusstseinsbildung. Dabei vermitteln wir nicht nur die zentralen Lehren, sondern zeigen auch, wie sich diese im Alltag praktisch umsetzen lassen – mit dem Ziel, innere Ruhe, Klarheit und echte geistige Freiheit zu erreichen.
Hier findest du auch die Sutras, welche den Raja Yoga im Sinne Patanjalis erläutern. Am Ende finden sich Text- und Videobeiträge, in denen Yogakundige ihre Sicht des Raja-Yogas darlegen.
Hier weiterlesen: Raja Yoga nach Patanjali – die acht Stufen erklärt
I. Kapitel Über Verhaltensregeln und Asanas | Hatha Yoga Pradipika

Themen: Wozu Hatha Yoga üben? Yoga- Voraussetzungen: Yamas und Niyamas, Lebensgestaltung, Ernährung. Wirkungen und Beschreibung der Asanas. Das große Hatha-Yoga - Versprechen.
Die Verse im Einzelnen zusammengefasst:
Hier weiterlesen: I. Kapitel Über Verhaltensregeln und Asanas | Hatha Yoga Pradipika
II. Kapitel: Über Pranayama und Kriya | Hatha Yoga Pradipika

Themen: Wann mit Pranayama beginnen? Reinigungs- und Pranayama-Techniken. Was muss der Yogi dabei unbedingt beachten? Welche segensreichen Wirkungen ergeben sich durch Pranayama?
Die Verse im Einzelnen in einer kommentierten Zusammenfassung:
Hier weiterlesen: II. Kapitel: Über Pranayama und Kriya | Hatha Yoga Pradipika
III. Kapitel: Über Mudras, Bandhas und Kundalini | Hatha Yoga Pradipika

Im dritten Kapitel der Hatha Yoga Pradipika wird vor allem die Kundalini und deren Erweckung besprochen. Hierzu dienen die Bandhas und Mudras, deren Technik geheim gehalten werden soll. An einigen Stellen finden sich sexuelle Praktiken, welche dem spirituellen Fortschritt dienlich sein sollen. Interessant: In einigen Übersetzungen wurden diese einfach weggelassen. Im Kontext wird immer wieder auf Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi und Nada Yoga eingegangen.
Hier weiterlesen: III. Kapitel: Über Mudras, Bandhas und Kundalini | Hatha Yoga Pradipika
IV. Kapitel: Über Samadhi | Hatha Yoga Pradipika

Hier geht es um den Zusammenhang zwischen Geist, Prana und Atemübungen, um Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Wie sich alles zueinander verhält, was auf was folgt. Man könnte es wie Brahmananda auch als Raja-Yoga-Kapitel ansehen.
Der Yogaweg wird auf verschiedene Arten beschrieben und gelobt. Auch die inneren Töne sind großes Thema. Samadhi wird von verschiedenen Seiten beleuchtet, Wege aufgezeigt und Folgen aus dem Erreichen von Samadhi beschrieben.
Hier findest du eine Kurzfassung des Inhaltes.
Hier weiterlesen: IV. Kapitel: Über Samadhi | Hatha Yoga Pradipika

Ashtanga Yoga nach Patanjali: die 8 Glieder des ursprünglichen Yoga
Mit Ashtanga Yoga ist ursprünglich der achtfache Yogapfad gemeint, wie ihn Patanjali im Yogasutra beschreibt. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Power-Yoga-Stil. In diesem Beitrag findest du die zugehörigen Sutras und Erläuterungen zu den einzelnen Stufen des achtfachen Pfades.
Hier weiterlesen: Ashtanga Yoga nach Patanjali
Besonders beliebte Themen
Duschen oder Baden nach Yoga?
Diana fragt:
Hallo Yoga-Freunde,
meine Mutter hat vor kurzem in einem Artikel gelesen, dass man direkt nach dem Yoga nicht duschen oder baden soll. Den Grund dafür weiß sie aber nicht mehr. Kennt Ihr solche yogischen oder ayurvedischen Regeln?
Danke für Eure Antworten!
Diana
Die Antworten lauten wie folgt:
Hier weiterlesen: Duschen oder Baden nach Yoga?
Farben sehen bei Tiefenentspannung
Farben sehen bei Tiefenentspannung
Bianca fragt:
Hallo zusammen,
ist es möglich, während der Tiefenentspannung Farben zu sehen? Bei mir ist es jetzt schon 3-mal vorgekommen, dass ich plötzlich ganz viel grün gesehen habe. Oder bilde ich mir das nur ein? Außerdem überkamen mich gestern so richtig warme Wellen, erst war ich etwas erschrocken, aber es war ein supergutes und schönes Gefühl.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann dies deuten?
Danke im Voraus und sonnige Grüße aus dem Süden Deutschlands.
Bianca
Die Antworten lauten wie folgt:
Hier weiterlesen: Farben sehen bei Tiefenentspannung
Kopfschmerzen / Migräne nach Yoga
Kopfschmerzen / Migräne nach Yoga
Chris fragt:
Hallo Yoga Forum, ich bräuchte Eure Hilfe. Ich bin selbst Yoga Lehrerin und unterrichte zurzeit eine Schülerin, die darüber klagt, dass sie nach der Yogastunde starke Kopfschmerzen bis hin zur Migräne bekommt.
Sie ist von Haus aus schon mit Migräne belastet und bekommt teilweise sogar Fusionen um die Schmerzen einzudämmen.
Zu Yoga kam sie, weil sie dachte, dass ihr das helfen könnte. Nun kommt sie teilweise schmerzfrei und geht nach dem Yoga (trotz Entspannungstechniken vor und nach der Stunde, Atemübungen usw.) mit Kopfschmerzen :-(
Weiß jemand, was das sein kann und was wir dagegen machen könnten? Die Antworten lauteten wie folgt:
Hier weiterlesen: Kopfschmerzen / Migräne nach Yoga

