Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः
In dieser Sutra wird Patanjali zum Glück deutlicher in Bezug auf Pranayama. Aber dennoch bleibt viel Interpretationsspielraum zu den einzelnen Gliedern des Pranayama und deren korrekter Regulierung. Manche Kommentatoren lehnen eine Regulierung des Atems sogar komplett ab und wollen Pranayama auf Beobachtung und subtile Steuerung beschränken.
In II-50 werden die einzelnen Bestandteile und das Ziel des Pranayama angesprochen ► Was wird unter „Zeit, Ort und Anzahl“ verstanden? ► Wie verlängern und verfeinern? ► Übersetzungsalternativen ► Lohn der Pranayama-Praxis

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Bahya, bāhya = Ausatmen; Äußeres; draußen; Außen; extern; nach außen; äußerlich;
- Abhyantara = Einatmen; Inneres; Zwischenraum; Innen; intern; nach innen; innerlich;
- Stambha = Anhalten; Unterdrückung; Festigkeit; Ruhe; Unterstützung; stationär; festgehalten; unterdrückt; angehalten;
- Vritti, vṛtti = (Gedanken-)Welle; Bewegung des Geistes; Gedanke; Bewegungen; Fluktuation;
- Bahyavrtti = äußere Tätigkeit; Ausatmung;
- Abhyantaravrtti = innere Tätigkeit; Einatmung;
- Sthambhavrtti = starre Tätigkeit; das Anhalten;
- Desa, deśa = Technik (des Atems); Ort; Thema (der Konzentration); Raum;
- Kala, kāla = Zeit; Zeitpunkt; Länge; Dauer (von Ausatmung, Einatmung und Anhalten);
- Samkhyabhi, saṁkhyābhi, Samkhya = Anzahl (der Atemzüge); Mathematik; Berechnung; Zahl; Genauigkeit; durch Zählen;
- Paridrsta, paridṛṣṭa = reguliert; (genau) beobachtet; gemessen; (genau) geprüft; gesehen; betrachtet; wahrgenommen;
- Dirgha, dīrgha = verlängert; lange; erhaben; hoch-aufragend;
- Suksma, sūkṣma = verfeinert; fein, subtil; dünn; kurz;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Wo wir stehen
Hier findest du eine kurze Zusammenfassung des 2. Kapitels des Yogasutras bis zu Sutra II-49:
Yoga Sutra - 2. Kapitel - bis hierher
Wir befinden uns im zweiten Kapitel des Yogasutra von Patanjali. Es handelt von der „Praxis“. Patanjali beginnt das Kapitel mit dem Versprechen, dass Yoga die Leiden des Yogis vermindere und (irgendwann) zu Samadhi, zur allumfassenden Freiheit führe.
In Sutra II-3 bis II-11 schildert Patanjali die fünf Haupt-Hindernisse auf dem Yogapfad, die sogenannten Kleshas (Unwissenheit, Anhaftung, Ablehnung, Ego, Lebensdrang). Erste Wege zur Überwindung der Hindernisse werden angerissen (Gegenschöpfung, Meditation).
Sutra II-12 bis II-15 handeln von Karma (Folgen von Handlungen und Gedanken, die aufgrund der Kleshas geschehen) und dem inhärenten Leid von allem und jedem in dieser Welt. Grundübel ist dabei unsere Identifikation mit dem, was wir nicht sind.
Dann geht es bei den Sutras weiter mit den Schritten, das Leiden zu besiegen. Patanjali sieht es als „die“ Aufgabe des Yogis an, den Unterschied zwischen Sehenden und Gesehenem zu erkennen. Nach und nach sollte diese Erfahrung kultiviert und ausgebaut werden. So gelange man zur Freiheit – Kaivalya (auch mit „letzter Freiheit“, Isoliertheit (Alleinheit), höchster Befreiung oder „vollkommener Erlösung“ übersetzt.
Nachdem Patanjali in den Sutras II-18 und II-19 über Prakriti, die Natur/unsere Welt, gesprochen hat, geht er dann auf deren Beobachter, den Seher (Purusha) und dessen Wahrnehmung ein. Von Sutra II-20 bis Sutra II-27 erläutert Patanjali Grund und das Zustandekommen unserer Existenz, wie die Unwissenheit unser Dasein bestimmt und dass Viveka Khyati, die Unterschreidungskraft oder unterscheidende Wahrnehmung, dauerhaft angewendet unsere Unwissenheit beendet. In den Sutras II-28 bis Sutra III-8 gibt Patanjali die konkrete Praxisempfehlung Ashtanga Yoga, um unser falsches Bild von der Welt – das Leid verursacht und unsere Befreiung verhindert – auch ohne großes spirituelles Talent zu überwinden. Den achtfachen Pfad des Raja Yoga, des königlichen Yoga.
In Sutra II-30 zählt Patanjali auf, was zur ersten Stufe des Pfades, den Yamas, gehört, in II-31 betont er deren universelle Gültigkeit. In II-32 listet er die Niyamas auf, die yogischen Empfehlungen für den Umgang mit uns selbst. In II-33 und II-34 benennt er, welche Folgen sich daraus ergeben, wenn unser Geist sich weigert, die Yamas und Niyamas zu befolgen und was wir dagegen tun können: die Kultivierung des gegenteiligen Gedankens/Zweifels (Pratipaksha Bhavana). Die Sutra II-35 (Ahimsa-Nichtverletzen) bis II-39 (Aparigraha-Begierdelosigkeit) schildern die besonderen Kräfte und Fähigkeiten, die ein Mensch erlangt, wenn er die Yamas tief in sich verwurzelt. In den Sutras II-40 bis II-45 schildert Patanjali die segensreichen Folgen Einhaltung der Niyamas.
Sutra II-46 bis II-48 handeln von Asana, der (Sitz-)Haltung. Patanjali fordert hier:
- II-46: unbewegt und bequem
- II-47: entspannen und auf das Unendliche ausrichten
- II-48: wenn gemeistert, frei von Dvandvas (Gegensatzpaaren)
In Sutra II-49 bis II-53 kommen wir zur vierten Stufe des achtfachen Pfades (nach Yama, Niyama und Asana): dem Pranayama. Iyengar: „Pranayama .... ist für den Yoga das, was das Herz für den menschlichen Körper ist“. In Sutra II-50 erläutert Patanjali, was Pranayama beinhaltet und wie es geübt wird.

Die ganze Welt des Pranayama in einer Sutra
Patanjali beschreibt in dieser Sutra sowohl, was Pranayama ausmacht, als auch, wie es geübt wird. Iyengar: „Meisterschaft [im Pranayama] ist erreicht, wenn der Atem ein rhythmisches und harmonisches Maß bekommt“.

Die Bestandteile des Pranayama
Nun kommen wir zu Pranayama, der vierten Stufe des achtfachen Raja-Yoga-Pfades, wie er im Yogasutra vorgestellt wird. Sutra II-49 wird von Vielen als Schlüsselsutra gesehen. Auch hier findet sich wieder ein relativ breites Spektrum an Übersetzungen sowie Verständnis von dieser Sutra. Pranayama bedeutet für einige mechanische Atemarbeit, andere verstehen darunter subtile Achtsamkeitsarbeit mit den feinstofflichen Energien. In II-49 wird Pranayama eingeführt ► Was ist Prana? ► Was bedeutet Pranayama? ► Gründe für Pranayama ► Gefahren von Pranayama ► Übersetzungsalternativen ► Hintergrund ► Wirkungsabläufe ► ...Beitrag: Yoga Sutra II-49: Wenn der Yogi lange Zeit unbewegt bequem sitzen kann, beginnt er mit Pranayama, der Kontrolle über die Bewegung von Ein- und Ausatmung
 Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
Tasmin sati shvâsa-prashvâsayor gati-vicchedah prânâyâmah
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वास्योर्गतिविच्छेदः प्राणायामः
Patanjali definiert: Pranayama ist Einatmung, Ausatmung und Anhalten. Punkt. Drei Vorgänge.
- Einatmen
Iyengar: „Purusha [das wahre Selbst] umarmt Prakrti [manifeste Natur].“ - Ausatmen
Iyengar: „Beim Ausatmen vereinigt Prakrti sich mit Purusha“. - Anhalten
Das Anhalten nach dem Einatmen wird Antara-Kumbhaka genannt, das Anhalten nach dem Ausatmen Bahya-Kumbhaka.
Diese "Vorgänge" können variiert werden:
- Desa: nach Ort
Sukadev sagt, gemeint sei z. B. linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch, Bauchatmung, Brustatmung, durch den Mund, durch die Nase ... Iyengar meint, dass mit dem Ort der Rumpf als Ort der Atmung zu verstehen sei. Swami Satchidananda hingegen: „Ort meint, wo wir die Aufmerksamkeit beim Atmen hinlenken – Nasenspitze, Basis der Wirbelsäule etc.“ - Kala: nach Zeit, Länge, Dauer
Hiermit meint Patanjali vermutlich die zeitliche Länge der einzelnen Atemvorgänge, z. B. vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden anhalten und acht Sekunden ausatmen. Swami Satchidananda hingegen beschränkt: „Zeit meint, wie lang wir den Atem anhalten.“ - Samkhya: Nach Anzahl / Genauigkeit
Iyengar übersetzt Samkhya mit „Zählung“ oder „Genauigkeit“ und sieht dies als „... Grad der vom Sadhaka erreichten Grad der Läuterung und Verfeinerung“ an. Anders Sukadev, der meint, dass hiermit vermutlich die Länge der Pranayama-Sitzung gemeint sei, z. B. zehn Minuten Nadi-Shodana, 15 Minuten Kapalabhati und zehn Minuten Atembeobachtung.
Palm (S. 125): „Mit Gesamtzahl [samkhya] ist das Verhältnis von Einatmen, Atemrückhalt, Ausatmen, Atemrückhalt gemeint.“ Zähleinheit im Hatha-Yoga sei hierbei die Rezitation einer Keimsilbe (bija).

Stamba, nicht Kumbhaka
Rainbowbody verweist, wie schon im Kommentar zu Sutra II-49 zuvor, darauf, dass Prana Energie bedeutet und Ayama ausdehnen; so dass man durch Pranayama die unendliche Energiequelle durch den ganzen Körper ausdehnt, um jede Zelle im Körper mit der kosmischen Quelle zu vereinen und so die Nadis offen, ausgeglichen und ausgerichtet werden.
Rainbowbody weist ebenfalls darauf hin, dass das Anhalten des Atems im Sanskrit kumbhaka und nicht stamba heißt. Darum nehmen die Autoren an, dass Patanjali hier Stille meint, während die Energie zunehmend ausgedehnt, verfeinert, verdünnt, ausgeglichen und subtiler wird.
Anders deutet es R. Palm (S. 126): „Auf die Rhytmus-Unterbrechung (gati-viccheda) folgt die Rückhalte-Bewegung (stambha-vrtti). stabha und kumvhaka haben als gemeinsame Bedeutung »Topf« oder »Krug«, wobei letzteres das »Bilden des Kruges« (kumbha-ka) meint, beide zudem »sakrales Gefäß« oder »Opferkrug« heißen. Der Topf oder Krug ist der Rumpf oder Körper, in den die Luft oder Lebensenergie eingefüllt und wieder herausgeleert wird.“ Khumbhaka sei zum Synonym für Pranayama schlechthin geworden, wobei das Anhalten die Atembewegungen klar dominiere.
„Solange sich der Atem bewegt, so lange ist auch alles Wandelbare im Menschen (Chitta) in Bewegung. Wird der Atem unbeweglich, so wird auch der Geist unbeweglich und der Gest des Yogi findet zur Harmonie. Daher soll man den Atem anhalten.“
Hatha-Yoga-Pradipika, Kapitel 2, Vers 2

Übungsziele beim Pranayama
Hier äußert sich Patanjali nicht ganz so eindeutig: der Atem soll verfeinert und verlängert werden. Was heißt das konkret?
Suksma: Verfeinern
Die gängige Deutung ist: Der Yogi sollte den Atem immer sanfter fließen lassen, bis dieser kaum mehr wahrgenommen (oder mit dem Finger vor der Nase gespürt) werden kann.
Dies Verfeinern kann auch im Sinne von „immer subtiler“ verstanden werden. Dies wird dann so gedeutet, dass der Yogi immer feinfühliger wird und schließlich den subtilen Fluss des Prana im Körper erspüren und irgendwann auch verändern kann.
Andere Kommentatoren übersetzen suksma einfach als „verkürzen“.
Verlängern
Die gängige Deutung ist: Der jeweilige Atemvorgang wird immer weiter ausgedehnt (Einatmung, Atempause und Ausatmung).
Manche beziehen das „Verlängern“ auf die Dauer der Pranayamasitzung.
Prana lenken
Patanjali schreibt es nicht konkret, aber viele Kommentatoren meinen, dass Patanjali (auch) das Lenken des Pranas als Ziel des Pranayamas ansieht. Skuban (S. 154): „Wenn wir Pranayama üben, wird die Atmung zum Fixpunkt unserer Konzentration, wir lenken sie bewusst: Dies betrifft die Geschwindigkeit der Atemzüge (Zeit), den Körperbereich, in dem wir hineinatmen ... (Ort), und die Zahl der so praktizierten Atemzüge.“ Alle drei Atemvorgänge werden „sukzessive verlängert“.

Sichtweise von Sutra II-50 im Pātañjalayogaśāstra (Kommentar Yogabhāṣya)
Vyasa, ältester bekannter Kommentator des Yogasutras (zitiert aus Yoga Roots S. 140ff) schreibt in seinem Kommentar zu dieser Sutra: „[Atemkontrolle], bei der der Abwesenheit des Flusses eine Ausatmung vorausgeht, ist äußerlich. [Die], bei der der Abwesenheit des Flusses die Einatmung vorausgeht, ist innerlich. Bei der dritten [Atemkontrolle], nämlich ›angehalten‹, entsteht die Abwesenheit von beidem [Einatmung und Ausatmung] als Ergebnis einer plötzlichen Anstrengung.
So wie sich Wasser vollständig zusammenzieht, wenn es auf einen erhitzten Stein gelegt wird, so gibt es [bei der ›angehaltenen‹ Atemkontrolle] sofort eine Abwesenheit des Flusses von beidem [Einatmung und Ausatmung].
Diese drei werden nach dem Ort reguliert; der Ort ist der Wirkungsbereich [des Atems]. Dass sie zeitlich reguliert sind, bedeutet, dass sie durch eine Beschränkung der Anzahl der Momente [die sie dauern] begrenzt sind. [Die drei Arten der Atemkontrolle sind auch] nach der Anzahl geregelt: der erste Ausbruch (udghāta) resultiert aus einer bestimmten Anzahl von Ein- und Ausatmungen, der zweite Ausbruch des zurückgehaltenen [Atems] resultiert ebenfalls aus dieser Anzahl, [und] der dritte ist derselbe.
Weil die Atemkontrolle auf diese Weise als mild, mittelmäßig und intensiv bezeichnet wird, ist sie ›durch die Anzahl reguliert‹. Wenn sie so praktiziert wird, ist sie lang und subtil.“

Gegenmeinung: Pranayama nicht aktiv
Kommentatoren wie Rainbowbody lehnen die aktive Atemkontrolle ab und betonen hingegen, dass Prana eine intelligente Lebenskraft sei (deren Manipulation nicht sinnvoll sei). In dem Maße, wie das subtile Gewahrsein beim Pranayama erweitert wird, wird der Atem immer subtiler und „dünner“, bis er so jenseits des Subtilsten wird. Der Yogi soll sich dafür sagen:
„Jetzt werde ich im Pranayama sitzen und mich auf die subtilen Feinheiten der Atemvorgänge konzentrieren, sie aber nicht manipulieren.“
In der sitzenden Meditation des Raj-Yoga, so Rainbowbody, ist die erste und wesentliche Stufe das Gewahrsein oder die Beobachtung (paridrasta), bei der wir nicht versuchen, den Atem zu verändern, sondern einfach wahrnehmen und uns bewusst werden, was mit den Eigenschaften des Atems geschieht, wie er sich mit den Gedanken (vrtti) verändert, und zu einem gleichmäßigen, subtilen und langen Atem zurückkehren. Man beobachte, wo der Atem konzentriert ist, wie der Atem anhält, „zackig“ wird, mal tief, mal lang fließt (vrttir), schwankt, grob oder subtil, schnell oder langsam, unausgewogen oder ausgeglichen wird und so weiter, bezogen auf geistige, emotionale und körperliche Entsprechungen, die wir wahrnehmen und beobachten (paridrsto).
Manchmal wird der Geist in die Stille kommen und da kann man bemerken, dass auch der Atem sehr lang und subtil geworden ist oder sogar still zu sein scheint. Wenn der Geist abschweift, kann man die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem lenken, indem alle Eigenschaften des Atems und ihre Beziehung zum Abschweifen oder zur Stetigkeit der Energie und des Geistes (der cit-prana oder cit-shakti) wahrgenommen werden. Auf diese Weise werden so Rainbowbody, der Atem, das Prana und der Geist (citta) verfeinert und subtiler, bis sie schließlich in einen unerschütterlichen, unaufgeregten Stillstand (stamba) übergehen.

Tantrische, chinesische und buddhistische Aspekte
Wim van den Dungen schreibt:
„Da der Atem (und die Lebensenergie, „prânâ“ oder „ch’i“) der geistigen Absicht folgt, kann er auf einen Ort im Körper gelenkt werden.“
Nach chinesischer Sichtweise sei die Regulierung des Atems die „ultimative Strategie, um die Winde zu lenken“. Prânâyâma“ wird als „königliche Straße, um den Geist zu transformieren“ bezeichnet. Denn nach ostasiatischer Vorstellung fließt „ch’i“ dorthin, wohin der Geist es lenkt. Die Regulierung des Chi´s wird als Voraussetzung für tantrische Transformation gesehen, übrigens auch in Indien. Je besser die innere Struktur und die jeweiligen Funktionen des subtilen Energiefeldes verstanden werden, desto effizienter und gründlicher wird die „Arbeit mit Energie“ („Ch’i Kung“) sein.
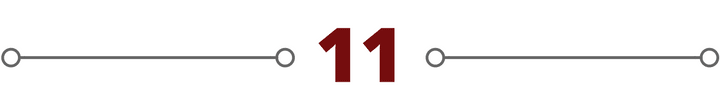
Lohn der Pranayama-Arbeit
Die Belohnungen der Atem- und Energiearbeit sind verlockend. Wim van den Dungen „... indem wir alle energetischen Knoten entfernen, wird die Wurzel unserer Verdunkelungen durchtrennt und das Leiden hört unwiderruflich auf.“ Wenn diese „tantrische Transformation“ erfolgreich ist, dann erscheinen die Siddhis (beträchtliche körperliche & geistige Kräfte) und sogar die Lebensspanne soll verlängerbar sein.
Und es geht noch weiter. Wim van den Dungen: „Schließlich führt diese Veränderung zur Buddhaschaft und damit zum Ende des durch den Tod (und die Wiedergeburt) verursachten Leidens. An diesem Punkt kann anderen am besten geholfen werden, auch ihr Leiden zu beenden. All dies geschieht durch prânâyâma.“
Rainbowbody: „Pranayama ist ein effektives und kraftvolles Werkzeug, um vergangenes Karma, Kleshas, Vasana und Vrtti aufzulösen sowie unser transpersonales, nicht-duales Erbe zu aktivieren. ... Durch subtiles Gewahrsein lernen wir, wie der Atem schließlich das innere Licht entzündet, das den Schleier der Unwissenheit zerstört (siehe Sutra 52).“
Iyengar: „Wer dieses Absorbieren und Reabsorbieren der Energie voll ausschöpft, wird hundert Jahre in vollkommener Gesundheit ... und Ausgewogenheit des Geistes leben können.“
Ralph Skuban (S. 155): „Pranayama ist zweifellos eine der wichtigsten Praktiken auf dem Yoga-Weg.“
Eliade S. 241: „.... dient diese Übung [des Pranayama] vor allem zur Reinigung der nadi.“
Siddhis: „Der Pranayama vernichtet die Sünden und verschafft die 84 siddhi.“ (Shiva-Samhita III, 51f, Gheranda Samhita V, 1f).
Energie, Reinheit und Gedankenruhe durch Pranayama
Rainbowbody, die Pranayama vornehmlich als Beobachtung der Atemvorgänge und der Pranaenergie im Körper ansehen, sagen, dass aus dem so verstandenen Pranayama die Energetisierung und Reinigung von Körper und Geist folge. Und zwar in dem Maße, in dem „der subtile Prozess zwischen Atem und Energie (Prana) enthüllt und verfeinert wird, wird auch das Citta (Gedankengut) verfeinert“. Dadurch würden die Citta-Vrtti abgeschwächt, was ja das Ziel der Yoga-Arbeit ist, siehe Sutra I-2:
Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im Geist Yogash citta–vritti–nirodhah Wenn ich festlegen müsste, welche Sutra die Bedeutsamste ist, dann würde ich diese wählen. Hier wird der Yogaweg in einem Satz zusammengefasst. Alle weiteren Sutras erläutern den Weg. Auslegung und Deutung dieser Sutra erfolgt unterschiedlich. Lies hier, welche Prioritäten du gemäß der Sutras-Deuter bei deiner täglichen Praxis setzen solltest. Hier weiterlesen: Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im GeistBeitrag: Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im Geist

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः

Gefahren durch Pranayama
Aber Vorsicht! Viele Lehrer warnen vor den Gefahren von Pranayama und der Lenkung der subtilen Energien. Swami Satchidananada: „Es [Pranayama] sollte vorsichtig [und nur] unter persönlicher Anleitung praktiziert werden.“ Seine Metapher ist mehr als deutlich: „Wir sollten nicht mit einer Kobra spielen, wenn wir keinen versierten Kobra-Trainer an unserer Seite haben.“
Die Probleme, die mit der direkten Einwirkung auf dieses Lebensfeld einhergehen können, erfordern ein tiefes Verständnis. Wim van den Dungen: „Dies erklärt, warum alle so genannte „Energiearbeit“ oder „Ch’i Kung“ eine langsame und allmähliche Praxis erfordert und gewaltsame Methoden vermeidet.“
Rainbowbody schreibt: „Die Pranayama-Praxis sollte zunächst als eine Bewusstseinsübung erfolgen. Erst wenn dieses Gewahrsein und diese Sensibilität hergestellt sind, können Experimente unternommen und in diesem Licht betrachtet werden. Diese müssen langsam, natürlich und nicht erzwungen sein. Es sollte weder überstürzt noch mechanisch sein, denn es ist sehr kraftvoll, mit den kausalen Energien im Inneren zu arbeiten. Ohne Sensibilität und Bewusstheit wird Leiden die Folge sein. Die Betonung muss auf dem Öffnen der Nadis und dem Ausgleich der Energie liegen. Daher ist es am besten, Pranayama zu vermeiden, es sei denn, man ist bereits sensibel geworden.“ Rainbowbody fasst zusammen: #
„Wenn Pranayama als Bewusstseinsübung ohne Manipulation des Atems praktiziert wird, entsteht kein Schaden.“

Siehe auch folgende Sutra
Purushârtha-shûnyânâm gunânâm pratiprasavah kaivalyam svarûpapratishthâ va chiti–shakter iti
पुरुषार्थशून्यानां गुणानांप्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति
Die letzte Sutra. Das Yogastura beginnt mit ata (jetzt) und endet mit iti (Ende). Patanjali schildert (erneut) Kaivalya, das Ziel des Yogaweges, die Befreiung. Unser Selbst, unsere Seele, findet zu ihrer wahren Natur.
Mit diesem Artikel versuche ich, Yogasutra 4.34 zu erschließen, beginnend bei den Schlüsselbegriffen, über klassische Kommentare bis hin zu modernen Anknüpfungen und Übungsanregungen. Keine ganz einfache Angelegenheit, da dieser Zustand nicht mit unserem normalen Alltagsbewusstsein vergleichbar sein soll.

Übungsvorschläge zu Sutra II-50
Übung 1
- Teil 1: Setze dich zur Meditation hin und halte deine Achtsamkeit für 15 Minuten auf den Atem. Verändere den Atem möglichst nicht bewusst, lass alles geschehen. Wie ist dein Atem nach dieser Viertelstunde? Länger? Feiner?
- Teil 2: Bemühe dich am nächsten Tag zu Beginn deiner Meditation eine Viertelstunde lang in sanfter Form darum, sowohl dein Einatmen als auch dein Ausatmen zu verlängern. Das Ausatmen sollte dabei stets deutlich länger ausfallen als das Einatmen. Wenn es problemlos möglich ist, baue eine Pause nach der Ein- und Ausatmung ein. Verlängere alle Atemphasen und lasse den Atem immer sanfter fließen, bis du ihn kaum mehr spürst, wenn dir das leicht möglich ist.
- Teil 3: Vergleiche nun deinen Atem jeweils am Ende dieser Viertelstunde. Lasse ihn von selbst fließen. Wann ist er "länger" und "feiner"? Nach der reinen Atembeobachtung oder wenn du den Atem bewusst verlängerst und verlangsamst? Was fühlt sich für dich besser an?
Übung 2
2. Übung, wenn du magst: Widme dich in dieser Woche verstärkt deinem Atem während der Asana-Praxis. Beobachte den Atem, während du die Stellung unbeweglich hältst. Wie verändert sich der Atem mit zunehmender Dauer des Haltens? Vermagst du deinen Atem auch in anstrengenden Stellungen zu beruhigen? Was geschieht dann?
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Dein Feedback / deine offene Frage an den Text
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra II-50
Sukadev zur Sutra II-49 bis Sutra II-53
Länge: 21 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Pranayama: Breath, Mind, and Orgasm, Kommentar zu Sutra II-49 bis II-51
Länge: 15 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Desikachar zur Sutra
Desikachar Video zu Sutra II-50
Länge: 50 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Asha Nayaswami zur Sutra
Asha Nayaswami zu Sutra II-46 bis II-55
Länge: 70 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Pranayama auf Yoga-Welten.de
- Warum durch die Nase atmen?
- Yoga - wie atmen? Die Vorgaben der alten Schriften
- Yoga Sutra zum Pranayama (II-49)
- Der Start: Atembeobachtung
- Anleitung Nadi Shodana (für Anfänger geeignet)
- Anleitung Kapalabhati (für Anfänger geeignet)
- Anleitung Ujjayi (für Anfänger geeignet)
- Forenbeiträge zu Pranayama
➔ Mehr in der Kategorie "Pranayama"
Weitere Pranayama-Higlights

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita



