Janmaushadhi-mantra-tapah-samâdhi jâh siddhayah
जन्मओषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः
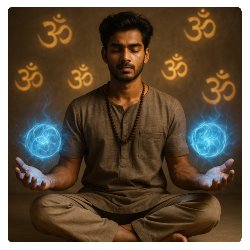 Siddhis sind außergewöhnliche Fähigkeiten, Kräfte oder Wahrnehmungen. Die erste Sutra des vierten Kapitels im Yogasutra (betitelt mit Kaivalya Pada) nennt fünf Möglichkeiten, solche Siddhis zu erlangen.
Siddhis sind außergewöhnliche Fähigkeiten, Kräfte oder Wahrnehmungen. Die erste Sutra des vierten Kapitels im Yogasutra (betitelt mit Kaivalya Pada) nennt fünf Möglichkeiten, solche Siddhis zu erlangen.
Auch in diesem Kapitel des Yogasutra will uns Patanjali zum Yoga-Ziel Kaivalya, der endgültigen inneren Freiheit, führen. In den folgenden Sutras geht Patanjali auf die schier übermächtigen Probleme eines Yogis ein, der Kaivalya (nur) mit eigenem Willen erlangen möchte und gibt viele Tipps und Erläuterungen. Ein wenig wirkt das vierte Kapitel so, als ob Patanjali noch einmal alles ansprechen wollte, was in die Logik der vorigen drei Kapitel nicht hineinpasst hat.
Kurz zusammengefasst
- Siddhis durch Geburt
Siddhis, die außergewöhnlichen Kräfte (beschrieben im dritten Kapitel) können karmisch geprägt sein – manche Menschen kommen mit besonderen Anlagen, aber Reifung durch Praxis entscheidet über Tiefe und Haltung. - Siddhis durch Substanzen & Rituale
Kräuter, Rituale oder Mantren können zu Siddhis führen – sind jedoch äußere Mittel, keine spirituelle Lösung, und potenziell ablenkend. - Siddhis durch Tapas (Selbstdisziplin)
Inneres Brennen, bewusste Praxis und Impulsverzicht schaffen echte innere Kraft – auch wenn das Ergebnis unspektakulär wirkt. - Siddhis durch Samadhi
Nur Samadhi-geborene Siddhis gelten als rein: Sie entstehen, wenn das Ich zur Ruhe kommt und während dessen innerer Raum spürbar wird. - Vyasa vs. Shankara – Ursachenanalyse
Vyasa differenziert fünf Ursprünge der Siddhis. Shankara hebt hervor, dass nicht alle Ursachen gleichwertig sind – Samadhi-Siddhis sind überlegen, weil sie bewusst reifen.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Janma = Geburt; Existenz;
- Aushadhi, oṣudhi, osadhi = Drogen; Kräuter; Heilpflanzen; Heilmittel; Heilkraut;
- Mantra = Sanskritwort oder -wortgruppe mit besonderem Klang und/oder besonderer Wirkung; Klangenergie; heiliger Spruch; Klangschwingung; Gedicht; wörtlich: “Schutz des Geistes” (manas = Geist, tara = Schutz); mystischer Vers;
- Tapah, tapas = Askese; Selbstzucht; Disziplin; intensive Praxis; Glühen; mit Hilfe von Feuer geradebiegen;
- Samadhi, samâdhih, samādhi = überbewusster Zustand; tiefste Meditation; Sammelbegriff für verschiedene Samadhi-Stufen; kognitive Versenkung;
- -jah = entstanden durch; entstehen aus; kommen von;
- Siddhayah, siddhayaḥ = übernatürliche Fähigkeiten; Kräfte; Vollkommenheiten;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Patanjali beginnt das vierte Kapitel mit der Schilderung von Möglichkeiten, wie ein Mensch zu besonderen Fähigkeiten (Siddhis) gelangen kann.
Das vierte Kapitel im Yogasutra hat einige Eigenheiten, die manchen Kommentatoren zu der Meinung veranlassen, dass ein anderer Autor am Werke war. Das kann sein oder nicht. Man sollte sich bewusst sein, dass Zweifel an der Autorenschaft bei vielen frühen indischen Schriften an der Tagesordnung sind. Übrigens auch an altgriechischen Texten oder dem alten und dem neuen Testament in der Bibel. Und vielen weiteren alten Texten.
Feuerstein meint, dass diese Sutra eigentlich zum vorigen Kapitel im Yogasutra gehört. Er vermutet ein “Missverständnis” bei den Kommentatoren des Yogasutra.
Paul Deussen schreibt: "Das vierte Buch der Yoga-Sütra's ist allem Anscheine nach ein späterer Anhang".
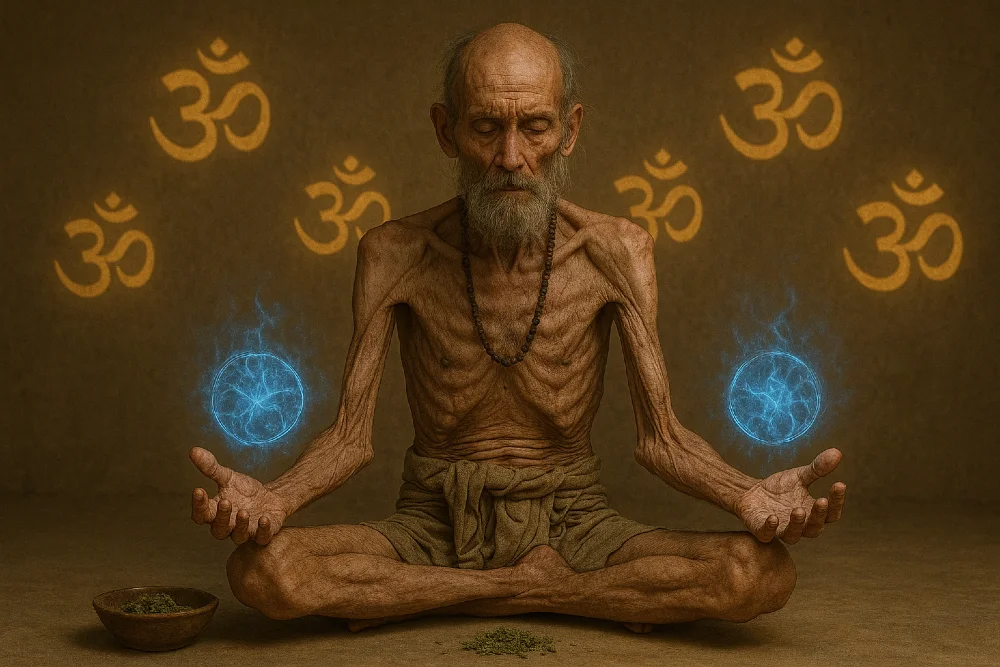
Viele Wege führen zum Siddhi
Patanjali nennt deren fünf:
- Der Pfad des Yoga, wie er im Yogasutra gelehrt wird (Samadhi). Tiefe Meditation führt zur Erleuchtung.
- Ererbt, also von Geburt an, wahrscheinlich durch Karma aus früheren Leben. Durch Veranlagung gepaart mit dem Wunsch nach Vollendung (Iyengar).
- Mantras, Rituale, Zaubersprüche. Anrufungen einer Gottheit.
- Kräuter oder Drogen – z. B. durch bestimmte Pilze, Elixziere oder Kräuter, im Schamanismus oder bei Ureinwohnern Amerikas verbreitet, in Indien ist ein Soma-Trank verbreitet Im Himalaya kennt man die bewusstseinserweiternden Wirkungen von “Anjana” und “Rosayana”. Im Westen wurde diesbezüglich viel mit LSD experimentiert. In Südamerika (und auch in den Niederlanden, Portugal und Spanien) wird Ayahuasca genutzt.
- Tapas – asketische Übungen, fasten, langes Pranayama etc. Hier sei zum Beispiel das holotrope Atmen genannt.
Siddhis – was ist das eigentlich?
In der Sanskrit-Wurzel "Siddhi" steckt das Verb sidh, was so viel bedeutet wie vollenden, erreichen, erfolgreich sein. Schon der Begriff trägt also Ambivalenz: Eine Errungenschaft, ja – aber von welcher Art?
Vyasa, der älteste Kommentator, spricht von acht großen Siddhis, darunter das winzig klein oder riesengroß Werden, das Schweben über Wasser, das unbegrenzt schnelle Reisen. Diese Beschreibungen lesen sich wie alchemistische Poesie – oder wie die Wunschliste eines Comic-Superhelden. Doch Vyasa bleibt kühl: Diese Kräfte sind, sagt er, keine Ziele, sondern Ablenkungen. Nur wer sie durchsichtig wie Glas betrachtet, bleibt auf dem Weg.
Vacaspati Mishra geht weiter: Er ordnet die Siddhis in drei Kategorien – angeboren, durch Substanzen verursacht (z. B. Kräuter oder Drogen) und durch spirituelle Praxis erlangt. Hier zeigt sich ein früh indischer Realismus, der Körper, Geist und Umwelt zusammendenkt. Es sind nicht „nur“ spirituelle Kräfte – Siddhis sind Ausdruck von Konzentration, Prana-Lenkung, mentaler Verfeinerung.
Hast du Erfahrung mit Siddhis?
Bitte schildere uns deine Erlebnisse. Vielen Dank.
Siddhis von Geburt – eine Gnade?
Die erste Kategorie: Siddhis „von Geburt“. Klingt wie das Gegenteil von Yoga, nicht wahr? Wenn alles karmisch festgelegt ist – was soll das dann mit Übung und Disziplin? Doch klassisch gedacht meint dies keine Privilegien im westlichen Sinn, sondern karmische Reifung. B.K.S. Iyengar kommentiert hierzu: Ein Mensch, der mit bestimmten Fähigkeiten geboren wird, hat sie „durch vorherige Praxis“ angesammelt. Geburt ist nicht Anfang, sondern Fortsetzung.
Ein interessanter Brückenschlag ergibt sich zur modernen Neuropsychologie: Hochbegabung, außergewöhnliche Wahrnehmung, synästhetische Erfahrungen – all das kann genetisch bedingt sein. Und doch, sagen Forscher wie Andrew Newberg („Why God Won’t Go Away“, 2001), lässt sich spirituelle Erfahrung systematisch kultivieren – ganz unabhängig von der Ausgangslage.

Kräuter (Aushadhi) – Pflanze als Portal?
Einer der irritierendsten Begriffe in diesem Sutra ist Aushadhi, meist als „Kräuter“ übersetzt. Ist das wirklich ein Verweis auf Pflanzen mit spiritueller Wirkung? Ja, vermutlich. Bhoja – ein Kommentator aus dem 11. Jh. – schreibt explizit über bestimmte Mittel, die Zustände erweiterten Bewusstseins fördern.
Einige moderne Übersetzer, darunter Georg Feuerstein, weisen auf die Nähe zu pflanzlichen Entheogenen hin – also Substanzen, die in schamanischen Traditionen seit Jahrtausenden zur Bewusstseinserweiterung verwendet werden.
Hier schaltet sich die moderne Bewusstseinsforschung ein: Studien mit Psilocybin (z. B. Carhart-Harris et al., 2016) zeigen, dass bestimmte Pflanzenstoffe tatsächlich temporär Netzwerke des Selbstbilds („Default Mode Network“) deaktivieren können – was Praktizierende mit tiefer Meditation vergleichen. Aber der Yoga-Weg, sagt Patanjali, braucht keine Substanz. Die Siddhis über Aushadhi sind Umwege, keine Hauptstraße.
Mantren – Klang als Kraftfeld
Mantren gelten im Yoga nicht als symbolische Formeln, sondern als Vibrationen mit innerer Struktur. Sie sind Werkzeuge zur Lenkung von Aufmerksamkeit – und damit von Energie. Der Kommentator Vyasa beschreibt Mantren als „Bija“ – Samenklänge, deren Wiederholung (Japa) spezifische Bewusstseinszustände hervorruft.
Das deckt sich mit aktuellen Studien aus der Neurowissenschaft: Forscher wie Herbert Benson (Harvard) zeigten, dass regelmäßiges Mantra-Rezitieren parasympathische Reaktionen verstärkt – Puls sinkt, Atmung wird flacher, Gehirnwellen verlangsamen sich. Das Gehirn, so scheint es, liebt rhythmische Reduktion.
Für Yogalehrende heißt das: Mantren sind kein exotischer Zuckerguss auf der Praxis – sie sind Trainingsfelder für Geistesgegenwart.
Selbstzucht (Tapas) – das Feuer der Transformation
Tapas, gern mit Askese übersetzt, steht nicht für gelassenen Verzicht. Es ist inneres Brennen. Die Kraft, sich nicht von jedem Impuls steuern zu lassen. Klassische Kommentatoren beschreiben Tapas als Hitzepraxis: Energie wird verdichtet, um alte Muster zu verbrennen.
Psychologisch betrachtet ist Tapas heute unter einem anderen Namen wieder en vogue: Selbstregulation. Studien zeigen, dass die Fähigkeit zur Impulskontrolle – etwa in der Meditation – neuronale Plastizität erzeugt (Davidson & Lutz, 2008). Disziplin ist also keine moralische Kategorie, sondern neurobiologische Schulung.
Samadhi – die wahre Quelle der Siddhis?
Der letzte und vielleicht bedeutendste Weg zu Siddhis ist Samadhi, der Zustand völliger geistiger Sammlung. Hier überschreitet das Bewusstsein die Grenze zwischen Ich und Objekt.
Moderne fMRI-Studien (z. B. von Judson Brewer, 2011, siehe unten) zeigen: In tiefen meditativen Zuständen verstummen die Netzwerke des „narrativen Selbst“. Das Ich wird durchlässig. Wer das erlebt hat, mag sagen: Die wahre „Kraft“ ist nicht Telekinese – sondern innere Stille und Weite.
Voraussetzungen und Umgang mit den Siddhis
Empfehlungen zu Voraussetzungen und zum Umgang mit den Siddhis
Viele Kommentatoren empfehlen, mit den Siddhis sehr bewusst umzugehen. Folgendes wird oft geraten:
Wer sich den Siddhis zuwendet, sollte die Yamas und Niyamas in seinem Leben verwirklicht haben. Diese sind:
Die Yamas – Selbstkontrolle
- Ahimsa – Gewaltlosigkeit
- Satya – Wahrhaftigkeit
- Asteya – Nicht-Stehlen
- Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit
- Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier
Niyamas – Verhaltensregeln
- Saucha – Reinheit
- Santosha – Zufriedenheit
- Tapas – Selbstzucht
- Svadhyaya – Selbststudium (Studium)
- Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen
Siehe dazu die Erläuterungen in "Yamas und Niyamas im täglichen Leben".
Siddhis sollten nicht zum Vergnügen, zur Selbsterhöhung oder anderen ungünstigen, egoistischen Zielen angewendet werden. Vielmehr zeigen die Siddhis (so Iyengar und andere), dass die Yogapraxis “richtig angelegt” sei.
Selbstverständlich sollte man Siddhis auch nicht dazu nutzen, um jemand anderen damit zu schaden.
Stattdessen wird eher ein “Nicht-Beachten” der Siddhis angeraten, wenn diese sich denn zeigen sollten. Iyengar schreibt, (S. 244), die Übungen bei Auftreten der Siddhis mit Glauben und Begeisterung weiterzuentwickeln, die Siddhis aber mit völligem Gleichmut zu betrachten.
Dem Yogi wird also geraten, sich nicht auf die Siddhis einzulassen, sich nicht von ihnen “mitreissen zu lassen”, um sie nicht für eigene selbstsüchtige Bedürfnisse zu verwenden, woraus späteres Leiden folgen würde. Stattdessen solle er/sie weiter auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln und die Siddhis eher als Prüfung ansehen, ob man nicht doch noch – trotz fortgeschrittener yogischer Entwicklung - den Verlockungen der Dualität und des Ego-Daseins nachgibt.
Swami Sivananda sagt über Siddhis:
„Yoga ist nicht dazu da, Siddhis, Kräfte, zu erlangen. Wenn ein Yogaschüler die Versuchung verspürt, Siddhis zu erlangen, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er hat den Weg verloren. Ein Yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten Samadhi zu erreichen, muss Siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von Devatas. Nur wenn man diese Siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im Yoga erlangen.“
Im tibetischen Buddhismus werden vergleichbare Fähigkeiten „Shes-rab“ genannt. Auch dort: klare Intuition, inneres Sehen, spontane Einsicht – aber nie als Ziel, sondern als Prüfstein für Demut.
Missverständnisse rund um Siddhis
Die Aussicht auf übernatürliche Kräfte fasziniert viele – und genau darin sind einige häufige Missverständnisse begründet. Ein Irrglaube besteht darin, dass Yoga hauptsächlich dazu diene, solche Siddhis zu erlangen. Tatsächlich betont die Tradition jedoch, dass Siddhis eher Nebenprodukte auf dem spirituellen Weg sind, nicht sein Zweck. Patanjali selbst stellt im unmittelbar folgenden Sutra klar, dass diese Fähigkeiten für einen im Samadhi befindlichen Geist Upasarga – also Störungen oder Ablenkungen – darstellen, auch wenn sie in einem nach außen gewandten Bewusstseinszustand als außergewöhnliche Errungenschaften erscheinen mögen. Yogameister wie Vyasa und später Vivekananda haben daher immer wieder gemahnt, die Siddhis nicht zu überschätzen: Sie seien wie Blüten am Wegesrand – schön und bemerkenswert, aber man sollte nicht vom Weg abkommen, um nur noch Blumen zu pflücken.
Ein weiteres Missverständnis liegt darin, jede ungewöhnliche innere Wahrnehmung sofort für eine echte siddhische Fähigkeit zu halten. Insbesondere wenn Übende beginnen, sich intensiv mit Meditation zu beschäftigen, können imaginäre Bilder, Lichterscheinungen oder akustische Phänomene auftauchen. Die Yoga-Tradition fordert hier Viveka, das unterscheidende Erkenntnisvermögen: Handelt es sich wirklich um eine valide intuitive Einsicht (Pratibha) oder nur um eine Wunschprojektion des Geistes? Echte spirituelle Intuition wird traditionell durch bestimmte Qualitäten kenntlich gemacht – sie geht einher mit tiefer innerer Stille, Klarheit und Gewissheit, ohne Aufregung oder Ego-Stolz. Hingegen sind halluzinatorische Erlebnisse oder irrige „Eingebungen“ oft dramatisch, emotional aufgeladen oder selbstbezogen. Es ist ein bekanntes Risiko, dass ein Yogi, der sich zu früh auf Siddhis fokussiert, Opfer von Täuschungen werden kann. Beispielsweise könnte man glauben, die Gedanken anderer lesen zu können, während man in Wirklichkeit eigenen Fantasien nachhängt.
Schließlich gibt es das Missverständnis, Siddhis seien ein Zeichen von Erleuchtung oder spiritueller Vollendung. Historische Berichte zeigen jedoch, dass auch wenig ethische oder unreife Personen zeitweise paranormale Fähigkeiten aufweisen konnten – was nicht mit wahrer Heiligkeit gleichzusetzen ist. Im Yoga wird daher gelehrt, die Siddhis weder zu verteufeln noch zu vergötzen. Sie dürfen auftauchen, doch der richtige Umgang ist entscheidend: Ein reifer Yogi nimmt sie wahr, schenkt ihnen aber wenig Bedeutung und bleibt dem höheren Ziel, Kaivalya (der völligen Befreiung), verpflichtet. Missverständnisse klären sich letztlich durch Erfahrung und Anleitung: In der traditionellen Guru-Schüler-Beziehung wurden auftauchende Siddhi-Erlebnisse vertraulich besprochen, um sicherzustellen, dass der Schüler nicht in Fallen wie Egoismus oder Ablenkung tappt. So soll auch der moderne Übende verstehen, dass Wunder im Yoga-Kontext Prüfsteine der Haltung sind – sie verlangen nach noch mehr Demut, Vairagya und Konzentration auf den eigentlichen Weg.
Zeitleiste: Pfad zu Samyama und den Siddhis
Diese Zeitleiste zeigt dir die Stufen des Yogawegs, die nötig sind, um in den Zustand von Samyama zu kommen – und wie daraus Siddhis (verfeinerte Sinneswahrnehmungen) spontan entstehen können.
🪷 Yama & Niyama
Ethische Grundlagen & Selbstdisziplin: z. B. Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sie bereiten deinen Geist auf Tiefe und Klarheit vor.
🧘 Asana
Stabiler, bequemer Sitz. Der Körper wird still, der Atem ruhig – beides ist nötig für längere innere Versenkung.
🌬️ Pranayama
Atemkontrolle als Brücke zur inneren Wahrnehmung, Pantanjali empfiehlt, Ausatmung und Einatmung und Anhalten zu verlängern und zu verfeinern. Dieses Pranayama beruhigt das Nervensystem und bereitet den Geist auf Fokus vor.
👁️ Pratyahara
Zurückziehen der Sinne. Der Blick geht nach innen. Die Außenwelt verliert an Bedeutung. Jetzt beginnt echte Sammlung.
🎯 Dharana
Konzentration auf ein Objekt (z. B. Licht, Atem, Mantra). Der Geist bleibt bei einem Punkt – erste Form von Meditation.
🧘♀️ Dhyana
Meditation. Der Fokus wird fließend, mühelos. Es gibt keine Unterbrechungen mehr – reines Verweilen im Beobachteten.
🌌 Samadhi
Verschmelzen mit dem Objekt. Kein „Ich meditiere“ mehr – nur noch reines Sein. Dies ist der Eingang in tiefe Einsicht.
✨ Übergang zu Samyama
Wenn Dharana, Dhyana und Samadhi auf dasselbe Objekt gerichtet sind – ohne Unterbrechung –, kann daraus Samyama entstehen. Dann ist der Geist hochfokussiert, durchlässig und empfänglich für tiefe, intuitive Erkenntnis.
🌟 Was entsteht daraus?
Spontan kann es geschehen, dass sich ein Siddhi zeigt, du z. B. feiner hörst, spürst, siehst – nicht mit den Sinnen, sondern von innen heraus. Denke immer daran: Siddhis sind kein Ziel, aber ein möglicher Meilenstein auf deinem Weg.

Sind alle Wege zu den Siddhis gleich gut?
Gleich gut um Siddhis zu erlangen – vielleicht oder in gewissem Sinne ja. Aber Siddhis sind im Yoga kein Selbstzweck, sie sind vielmehr ein Zeichen der Vertiefung der Meditation. Darum sind aus yogischer Sicht mitnichten alle Wege gleich gut. Nur der geistige Weg des Yoga ist nachhaltig und dauerhaft und führt zu ersehnter Freiheit.
Patanjali selbst bleibt in seiner Bewertung klar (siehe z. B. die folgenden Sutras): Nur die Siddhis, die aus Samadhi erwachsen, sind rein. Sie sind nicht das Ziel – sie sind Nebenerscheinungen eines Geistes, der vollständig in sich ruht.
Steiner schreibt bei der Übersetzung Sutra IV-6, dass bei den verschiedenen Möglichkeiten, Siddhis zu erlangen, nur die Versenkung [in Samadhi] der Weg ohne Nebenwirkungen bzw. Karma sei.
Iyengar sieht ererbte, durch Drogen gewonnene oder mittels Mantrarezitation erworbene spirituelle Fähigkeiten als durch “Stolz und Nachlässigkeit” gefährdet an. Fähigkeiten aus Tapas und Samadhi seien robuster gegen die Verlockungen gewappnet.
Rainbowbody: „Durch den Segen von Samadhi werden das dritte Auge, transzendentales Wissen und übersinnliche Wahrnehmung zugänglich, als ob der Körper/Geist an einen riesigen Hauptrechner angeschlossen wäre, der alle Daten seit anfangsloser Zeit umfasst.”
Patanajali, so Skuban und andere, bevorzuge offenkundig den Weg des Raja Yoga wie der im Yogasutra geschildert wird. Dieser besteht in der kontinuierlichen Schulung des Geistes mit Konzentration zu Meditation und schließlich zu Samadhi. Ein WEg des Wandels, wie er auch in den folgenden Sutras weiter besprochen wird.
Die “alternativen” Methoden zum Erlangen von Siddhis bringen teilweise weitere Probleme mit sich. Kräuter und Pilze beispielsweise sind gesundheitlich alles andere als unbedenklich. Vielleicht weniger, wenn man diese mit viel Spezialwissen (z. B. zur Dosierung oder für Schutzmechanismen) einnimmt, aber gefährlich bleiben sie. In den yogischen Lehren findet sich die Ansicht, dass Drogen den Astralkörper schädigen.
Bestimmte Mantras und Tapas (in gewissen Grenzen) hingegen fördern den yogischen Weg, so schreiben viele Kommentatoren.

Schlussfolgerungen
Eine grundlegende Erkenntnis aus dieser Sutra: Siddhis allein sind noch kein Zeichen spirituellen Fortschrittes. Sie können auf vielerlei Wegen erlangt werden. Sukadev: „Ethisches Verhalten ist ein viel wichtigeres Zeichen.”
Alles in uns verborgen
Desikachar schreibt, dass im Yogasutra nie die Rede davon sei, “dass irgend etwas Neues erworben werden müsste”. Vielmehr seien alle Fähigkeiten und Qualitäten schon in uns vorhanden, müssten nur zum Vorschein gebracht werden.
Siddhis – nutzen oder lassen?
Yogasutra 4.1 konfrontiert uns mit der vielleicht ältesten Versuchung aller spirituellen Pfade: Der Wunsch nach Kraft, bevor Reife eintritt. Siddhis sind wie Lichtreflexe auf einem See – schön, verlockend, aber leicht zu verwechseln mit der Tiefe des Wassers.
Der Text lädt dich nicht ein, Siddhis zu suchen. Er beschreibt sie – vielleicht nur, damit du nicht in ihnen stecken bleibst.
Vielleicht ist das größte Siddhi nicht das Schweben über dem Boden – sondern das Wurzeln in der eigenen Mitte, trotz aller Stürme.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.1: über die Ursprünge der Siddhis
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyasa, der bedeutendste Kommentator zu Patanjalis Yoga Sutra, geht in seinem Kommentar zu 4.1 ebenfalls der Frage nach, woher außergewöhnliche Kräfte – die sogenannten Siddhis – stammen können.
Hier folgt eine sinngemäße, erläuterte Fassung:
🧬 Siddhis durch Geburt
Vyasa schreibt:
„Errungenschaften durch Geburt existieren im Körper.“
Manche Menschen kommen mit besonderen Fähigkeiten auf die Welt – hellsichtig, überdurchschnittlich konzentriert, mit erstaunlicher Körperkontrolle oder instinktiver geistiger Klarheit. Für Vyasa ist das kein Wunder, sondern das Ergebnis früherer Handlungen (Karma). Was im Westen als „Begabung“ bezeichnet wird, erscheint hier als Reifung über viele Leben hinweg.
🌿 Siddhis durch Substanzen und fremde Einflüsse
Vyasa schreibt:
„Durch Drogen, in den Häusern der Asuras, durch Elixier und dergleichen.“
Hier wird es schillernd: Vyasa nennt Rauschmittel, möglicherweise auch psychoaktive Kräuter (Aushadhi), sowie „die Häuser der Asuras“ – das Reich nichtgöttlicher, machtvoller Wesen. Ein Bild für okkulte Praktiken, vielleicht für mentale Manipulationen oder Rituale, die jenseits des Ethos des Yoga liegen.
Das „Elixier“ könnte auf mythologische Substanzen wie Amrita (Unsterblichkeitstrank) anspielen – oder ganz irdisch auf alchemistische Mischungen.
Was deutlich wird: Es gibt Wege zu Kräften, die nicht durch spirituelle Schulung entstehen. Doch ob diese Kräfte zur Befreiung führen – bleibt offen, um nicht zu sagen: fraglich.
✨ Siddhis durch magisch-rituelle Praxis
„Durch Beschwörungen, Bewegung im Raum und die Kräfte der Abschwächung (aṇimā).“
Beschwörungen (Mantren), die Fähigkeit, sich scheinbar schwerelos zu bewegen, oder der Klassiker der aṇimā-siddhi – sich so sehr zu verdichten, dass man mikroskopisch klein wird – all das zählt Vyasa auf. Klingt fantastisch? Vielleicht. Aber wer es symbolisch liest, erkennt in diesen Siddhis Stufen innerer Wandlung:
-
Anima kann auch heißen: sich im Ego verkleinern, um die Welt wahrhaft zu betreten.
-
Bewegung im Raum? Vielleicht die Fähigkeit, sich von mentalen Orten blitzschnell zu lösen.
-
Und Mantren? Werkzeuge zur Fokussierung und Energiesteuerung.
Wörtlich genommen sind das übernatürliche Kräfte. Psychologisch gelesen: Zustände erhöhter geistiger Feinheit.
🔥 Siddhis durch Läuterung – Tapas
„Durch läuternde Handlungen (tapas) die Erfüllung von Wünschen.“
Hier wird’s wieder bodennah: Durch Tapas – also durch bewusstes Üben, durch Disziplin, durch das Aushalten von Unbequemem – wächst innere Kraft. Tapas ist das Feuer, in dem alte Muster verbrennen. Wer sich dieser Praxis aussetzt, kann tatsächlich Veränderungen erleben, die wie Wunder wirken:
Mehr Klarheit. Weniger Reaktivität. Mehr Mitgefühl. Oder auch schlicht: der lang ersehnte innere Frieden.
Dass Vyasa dies mit „Erfüllung von Wünschen“ verbindet, ist doppeldeutig: Meint er Wünsche im spirituellen Sinn? Oder spielt er ironisch darauf an, dass viele erst wegen ihrer Wünsche zu praktizieren beginnen?
🧘 Siddhis durch Samadhi – das große Ziel
„Die aus der Trance geborenen Errungenschaften sind beschrieben worden.“
Zum Schluss ordnet Vyasa (für viele die höchste Form der Siddhis) ein: jene, die aus Samadhi entstehen. Und das ist keine Trance im Sinne von Benommenheit – sondern geistige Durchlässigkeit.

Shankara über die Ursachen der Siddhis – eine philosophische Feinabstimmung
Über das Leben von Shankara
Śaṅkara – Leben, Werk und Bedeutung für die Yogaphilosophie
Śaṅkara (auch bekannt als Śaṅkarācārya oder Shankara), geboren im 8. Jahrhundert in Südindien (788–820), ist einer der bekanntesten Philosophen und spirituellen Lehrer des Advaita Vedānta. Sein Leben gleicht einem Wanderweg zwischen Legende und Geschichte – mit spirituellem Tiefgang, intellektuellem Feuer und einer Prise mystischer Überhöhung. Doch unabhängig von den genauen Daten und Wundergeschichten bleibt: Seine Ideen wirken bis heute. Auch im Yoga.
🧘♂️ Wer war Śaṅkara?
Śaṅkara wurde vermutlich in Kaladi, im heutigen Kerala, geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich – hochintelligent, fragend, neugierig auf das Wesentliche. Früh verließ er seine Familie, um Sannyāsin zu werden – also Wandermönch, asketisch, radikal dem Geistigen zugewandt. Ein radikaler Schritt, selbst nach damaligen Maßstäben.
Er reiste quer durch Indien, diskutierte mit Vertretern anderer Schulen (oft wortgewaltig und nicht selten siegreich), gründete Klöster und prägte eine ganze philosophische Bewegung. Sein Ziel: Das Wissen um die Einheit allen Seins wieder in den Mittelpunkt zu rücken – jenseits von Ritualismus, Jenseitsversprechen und dogmatischer Spaltung.
📚 Was hat er geschrieben? Und warum ist das wichtig?
Śaṅkara war kein Vielschreiber im modernen Sinn, aber seine Werke haben Wucht. Besonders wichtig:
- 🔹 Brahmasūtra-Bhāṣya
Sein wohl berühmtestes Werk: ein Kommentar zu den Brahmasūtras, dem philosophischen Herzstück des Vedānta. Hier entfaltet er die Kernaussage des Advaita Vedānta: Alles ist eins. Brahman ist das einzig Wirkliche. Die Welt der Formen ist letztlich Illusion (Māyā). - 🔹 Upaniṣad-Kommentare
Śaṅkara kommentierte auch zentrale Upaniṣaden – jene Texte, die die tiefsten Fragen des Selbst, der Wirklichkeit und der Befreiung behandeln. Seine Lesart macht klar: Yoga ist nicht nur Praxis, sondern Erkenntnisweg. Nicht das Tun allein befreit, sondern das Verstehen. - 🔹 Bhagavadgītā-Bhāṣya
Auch hier interpretiert Śaṅkara das Geschehen nicht als moralisches Lehrstück, sondern als spirituellen Weckruf: Handle, aber erkenne, dass du nicht der Handelnde bist. Karma-Yoga, Jñāna-Yoga, Bhakti – für ihn keine Gegensätze, sondern Stufen der Reife.
Shankaras Doppelrolle – Berühmt als Advaita-Vedanta-Philosoph, kommentierte er hier einen Yoga-Text – und brachte so zwei Philosophieströmungen miteinander ins Gespräch.
🧠 Was sagt Śaṅkara, das heute noch trägt?
Für Menschen, die sich mit Yogaphilosophie beschäftigen – und nicht nur schwitzen, sondern auch verstehen wollen – ist Śaṅkara Gold wert. Seine Lehren laden ein, hinter die Oberfläche zu schauen. Meditation? Ja, aber nicht als Methode zur Beruhigung, sondern zur Erkenntnis der wahren Natur.
Er sagt: Du bist nicht dein Körper, deine Gedanken oder dein Yoga-Fortschritt. Du bist Brahman. Schon immer. Nur vergessen.
🔍 Was bedeutet das für dich?
- Wenn du meditierst, denk daran: Du musst nicht irgendwohin kommen. Du bist schon da.
- Wenn du philosophierst, lass dich nicht verwirren von intellektueller Gymnastik. Suche das Einfache im Komplexen.
- Wenn du zweifelst, erinnere dich: Erkenntnis ist kein fernes Ziel, sondern etwas, das du jederzeit berühren kannst – still, wach, jenseits der Worte.
Der große Philosoph Śaṅkara (788–820) – Ikone des Advaita Vedanta und geistiger Titan der indischen Geistesgeschichte – kommentiert Vyasas Worte zu Yogasutra 4.1. Sein Fokus: die Ursachen hinter den Siddhis, vor allem jenen, die „durch Geburt“ entstehen. Doch was auf den ersten Blick wie eine rein metaphysische Spitzfindigkeit wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als entscheidende Differenzierung im Verständnis von Karma, Wiedergeburt und innerer Reifung.
🧩 Siddhis beruhen auf Ursachen – aber nicht alle Ursachen sind gleich
Shankara beginnt mit einer klaren Feststellung:
„Die Vollkommenheit (das Siddhi), die auf einer bestimmten Ursache beruht, ist den anderen überlegen.“
Was bedeutet das? Nicht jede Siddhi hat denselben Ursprung – und nicht jeder Ursprung ist gleich wertvoll. Ein Siddhi, das durch bewusste Praxis (etwa Tapas oder Samadhi) entsteht, ist in Shankaras Augen tiefer verankert, authentischer – weil es Ausdruck innerer Transformation ist, nicht bloß karmischer Rückwirkung.
🌀 Wiedergeburt – nicht nur Schicksal, sondern Struktur
Dann nimmt Shankara die Siddhis „durch Geburt“ unter die Lupe. Er akzeptiert: Ja, es gibt Menschen, die mit bestimmten Fähigkeiten zur Welt kommen. Aber:
„… diese Siddhis speisen sich aus Ursachen, die in einem früheren Leben gelegt wurden.“
Geburt ist also nicht Magie – sondern die Auswirkung einer bereits existierenden Ursache. Der neue Körper, die neue Persönlichkeit, ist der äußere Ausdruck eines inneren Potenzials, das bereits zuvor aktiviert wurde. Soweit, so vertraut für Kenner*innen indischer Reinkarnationslehren.
Aber Shankara bleibt hier nicht stehen.
❓ Und was ist mit Siddhis ohne Körper?
Seine Frage führt mitten hinein in eine metaphysische Tiefenbohrung:
„Wenn es um den Übergang in eine andere Geburt geht, in der der neue Körper noch nicht entstanden ist – ist dann diese karmische Ursache allein ausreichend? Oder braucht es noch etwas anderes?“
Diese scheinbar abstrakte Frage hat es in sich. Shankara stellt infrage, ob Karma allein den gesamten Prozess der Siddhi-Entfaltung erklären kann – besonders, wenn der Körper noch gar nicht manifest ist. Mit anderen Worten:
🧠 Reicht eine frühere Ursache aus, um Fähigkeiten im neuen Leben zu formen – oder gibt es eine zusätzliche Kraft, einen weiteren Faktor, eine unsichtbare Hand?
Man könnte das philosophisch lesen als Hinweis auf Brahman, das Absolute, das als „nicht-kausale“ Wirklichkeit hinter allen Dingen steht. Oder psychologisch: Selbst wenn die Bedingungen da sind – muss das Bewusstsein auch bereit sein, sie anzunehmen.
🧘 Was bedeutet das für Yogapraktizierende heute?
Shankaras Gedanken sind alles andere als metaphysische Spielerei. Sie fordern dazu auf, nicht alles dem Karma zuzuschreiben. Fähigkeiten, Gaben, Bewusstseinszustände – sie erscheinen vielleicht durch Geburt, aber sie reifen durch Praxis.
Und noch subtiler: Selbst wenn du eine Anlage in dir trägst, bleibt die Frage offen, was du damit machst. Denn eine Ursache allein ist noch kein Siddhi – es braucht Empfänglichkeit, Absicht, manchmal auch Gnade.

Ergänzung: Was Judson Brewer (2011) über das „Ich“ im Gehirn herausfand
In der Studie “Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity” (Brewer et al., 2011, Proceedings of the National Academy of Sciences), untersuchte Judson Brewer gemeinsam mit einem Team von Neurowissenschaftlern, was im Gehirn von erfahrenen Meditierenden geschieht – und zwar speziell im sogenannten Default Mode Network (DMN).
Das DMN ist ein Netzwerk aus Hirnarealen, das besonders aktiv ist, wenn unser Geist wandert, sich selbst reflektiert, in Vergangenheit oder Zukunft schweift – kurz gesagt: wenn das narrative Selbst aktiv ist. Es ist die Bühne für „Ich-Geschichten“ wie „Was wird aus mir?“, „Was denken die anderen?“, „Warum hat sie mich nicht zurückgerufen?“
Die Forscher ließen erfahrene Achtsamkeitsmeditierende sowie eine Kontrollgruppe einfache Meditationsübungen im fMRI-Scanner durchführen. Dabei zeigte sich: Während der Meditation war bei erfahrenen Praktizierenden das DMN signifikant weniger aktiv, insbesondere in den Regionen medialer präfrontaler Kortex und posteriore cinguläre Kortex – beide gelten als zentrale Knotenpunkte des Ich-Bewusstseins.
Noch spannender: Selbst außerhalb der Meditation – also in der Ruhephase – zeigten die erfahrenen Meditierenden eine geringere DMN-Aktivität als die Kontrollpersonen. Das legt nahe, dass regelmäßige Praxis das Grundrauschen des Ego-Denkens dauerhaft verändert.
Und was heißt das nun für Yogasutra 4.1?
Patanjali nennt Samadhi als eine Quelle für Siddhis. Die moderne Neurowissenschaft sagt: In solchen Zuständen verstummt das Ich-Netzwerk im Gehirn. Was bleibt, ist – je nach Interpretation – reine Präsenz, Weite, Leere. Oder, wie Brewer es in einem späteren Interview formulierte: “The self is a story, and meditation shows us how to stop telling it so loudly.”
Im Kontext kann das vielleicht so gelesen werden: Die wahren Siddhis entstehen dort, wo das Ich zur Seite tritt.
Übungsvorschlag zu Sutra IV-1
Du hast hier von verschiedenen Möglichkeiten, Siddhis zu erlangen, gelesen. Denke vor diesem Hintergrund darüber nach, wie ein Siddhi auftreten könnte. Welchen Geisteszustand wird man wohl haben? Wie ist der Körper? Welche Umstände sollten herrschen? Wie wird es sich anfühlen, ein Siddhi zu erfahren?
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-19: Dieses [Virama Pratyaya oder Asamprajnata Samadhi] kann [auch] von Geburt aus, durch frühere Körperlosigkeit oder durch Verschmelzung mit der Natur (Prakriti) erlangt werden
Yoga Sutra I-20: Andere gelangen dorthin [zu Asamprajnata Samadhi] durch Glauben, Wille/Energie, Erinnerungsvermögen/Gedächtnis, Samadhi/Sammlung und Weisheit
Yoga Sutra III-3: Wenn das Bewusstsein von Subjekt (Meditierender) und (Meditations-)Objekt verschwindet und nur die Bedeutung des wahrgenommenen Objektes verbleibt, wird dies Samadhi genannt
Yoga Sutra III-15: Veränderungen in der Abfolge sind die Ursache für die Verschiedenheit der Verwandlung der Dinge
Yoga Sutra III-38: Diese sind im normalen Leben (wenn der Geist in Bewegung ist) außergewöhnliche Kräfte, aber Hindernisse für das Erreichen von Samadhi

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-1
Wie erlangt man Siddhis, übernatürliche Kräfte – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 1 und 2
Länge: 22 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Wie entstehen Siddhis? – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.1
Länge: 13 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Kräfte von Samyama, Class 62: Asha Nayaswami zu Sutra 3:53-4.1
Länge: 74 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


