Te samâdhâv upasargâ vyutthâne siddhayah
ते समाधवुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः
Wer den Yogaweg schon eine Weile gegangen ist, merkt schnell: Nicht alles, was glänzt, führt auch ins Licht. Gerade wenn scheinbar übernatürliche Erfahrungen auftreten – sei es eine plötzliche Eingebung, hellsichtiges Spüren oder intuitive „Wunder“ –, wird der innere Kompass auf die Probe gestellt. In diesem Artikel geht es um genau diese Versuchungen, die Patanjali in Sutra III.38 beschreibt: sogenannte Siddhis, geistige Kräfte, die sich oft als Fortschritt verkleiden, in Wahrheit aber zum Stolperstein auf dem Weg zu Samadhi werden können. Wer hier genau hinsieht, versteht tiefer, worum es im Yoga wirklich geht – und worum gerade nicht.
Kurz zusammengefasst
- Siddhis (besondere geistige Kräfte)
Sie entstehen durch intensive Praxis, z. B. durch Samyama. Beispiele sind Hellsehen, Hellhören oder intuitives Wissen. - Hindernis in Samadhi
Im Zustand tiefer Versenkung lenken Siddhis vom Ziel der Selbsterkenntnis ab und stören den inneren Fokus. - Wert im Alltagsbewusstsein
Im „nach außen gerichteten Geist“ (Vyutthāna) gelten Siddhis als besondere Fähigkeiten und werden als Erfolge wahrgenommen. - Vyāsas Kommentar
Siddhis widersprechen dem Erkenntnislicht des Samadhi. Sie gelten dort als upasargaḥ, also Störungen. - Psychologische Bedeutung
Siddhis können das Ego stärken, spirituellen Stolz erzeugen oder zu Anhaftung führen – alles Hindernisse auf dem Weg zur Befreiung. - Empfohlene Haltung
Gleichmut, Nicht-Anhaftung und Demut sind entscheidend, um Siddhis nicht zu Selbstzwecken zu nutzen.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Te = sie; diese; jene;
- Samadhav, samâdhav = im Samadhi;
- Samadaui, samādaui = für die in Samadhi; für die, welche schon die Erkenntnis haben; für Erleuchtete;
- Upasargah, upasargâh, upasargā = Hindernisse; Nebenwirkung; nebensächlich; Unfall; Hemmnis; Brüche; Unterbrechungen; Behinderung; Schwierigkeiten;
- Vyutthane, vyutthâne, vvyutthāna = Auswärtsgerichtetsein; auftauchend; für die nach Äußerem strebenden; materiell Orientierte; für diejenigen in Aufregung; im Wachzustand; Eliade übersetzt auf S. 99 vyutthana mit „wacher Zustand“;
- Siddhayah = Kräfte; Zauberkraft; Fähigkeiten; Fertigkeiten; Vollkommenheiten; Errungenschaften;
- Samyama, samyamah, saṁyamā = Ausdruck für die Triade Dharana, Dhyana und Samadhi; Selbstbeherrschung; Abfolge von Dharana, Dhyana und Samadi;
- Samyamat, samyamât = durch Ausführung von Samyama über;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Samyama ist die Schlüsselübung im dritten Kapitel des Yogasutra zum Erreichen der geistigen Kräfte. In den Sutras III-1 bis III-7 erläutert Patanjali zunächst, was Samyama ist: die Kombination aus
- Dharana (Konzentration),
- Dhyana (Meditation) und
- Samadhi (Überbewusstsein).
In Sutra III-8 ergänzt er dann, dass der Yogi zur Erlangung der Erleuchtung über Samyama hinausgehen muss.
In den Sutras III-9 bis III-15 geht es weiter mit Erläuterungen, welche Wandlung der Geist (Chitta) vollziehen muss, um Samyama bis zur Perfektion ausüben zu können. Aufeinander aufbauend sind das die Stadien
- Nirodha-Parinama (Wandel durch Sammlung, einfache Konzentration),
- Samadhi-Parinama (Wandlung durch länger andauernde Konzentration) und
- Ekagrata-Parinama (Wandel/Transformation durch vollkommene Versenkung auf einen Punkt/ein Thema).
Der notwendige Wandel des Geistes erfolgt nach und nach, ist keine sprunghafte Entwicklung.
In den Sutras III-16 bis III-49 macht Patanjali eine ganze Reihe von Vorschlägen, worauf man Samyama lenken könnte und welche Folgen (Siddhis = Kräfte, besondere Erkenntnisse) sich jeweils daraus ergeben.
Mit dieser Sutra schiebt Patanjali eine kleine Mahnung oder Warnung ein. Intuitive Sinneswahrnehmung (und eventuell bezieht er sich auch noch auf die davor beschriebenen Siddhis) könnten den geistigen Aufstieg zu Samadhi behindern. Gleichwohl macht er schon in der nächsten Sutra weiter mit der Schilderung weiterer Siddhis.
Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen
Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen
Patanjalis Anleitungen zur Erlangung der Siddhis lauten generell, dass der Praktizierende Samyama gezielt auf ein Meditationsobjekt anwendet. Samyama ist die Verbindung aus anhaltender Konzentration, Meditation und schlussendlich Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Objekt der Meditation. Skuban sieht den Vorgang von Samyama als “mentales Eindringen in ein Objekt, das den Übenden schließlich zu den feinstofflichsten Bereichen des Seins führt.” Dadurch werden die drei Eigenschaften (siehe Sutra III-13) eines Objektes voll erkannt. So wird das Objekt voll verstanden und über die Gunas auch beherrschbar. Alle Objekte sind nämlich laut Yogalehre Erscheinungsformen der drei Gunas, auch das Bewusstsein des Menschen. Der Yogi diszipliniert sein Bewusstsein und kann über bzw. in Samyama die Gunas auch außerhalb seines Bewusstseins beeinflussen oder verändern. So erklären sich gemäß Yogalehre die Siddhis.
Vibhutis, der andere Name für die Siddhis, bedeutet wörtlich weg (vi) von den Elementen (bhutas) und steht damit laut einiger Kommentatoren auch für die Abwendung von der Identifikation mit den materiellen Grundlagen unseres Lebens, yogisch: Prakriti. Hin zur Erkenntnis unserer wahren Natur: Purusha.
Die Sutras III-16 bis III-49 nennen die Objekte, auf die ein Yogi seine Samyama-Konzentration legen sollte, um besondere Kräfte zu entfalten. Iyengar betont jedoch, dass diese Siddhis sich erst bei weit fortgeschrittenen Yoga-SchülerInnen zeigen.
Ergänzend: Lange Pranayama-Praxis soll spontane Siddhis triggern können. Gerade Wechselatmung über Monate hinweg wird in manchen Berichten als „geistöffnend“ beschrieben – mit plötzlichen Hörerlebnissen oder Visionen.
Was ist Samyama?
Was ist Samyama?
Samyama besteht aus drei Stufen: Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein). Nur die erste Stufe von Samyama, die Konzentration auf ein Objekt, lässt sich willentlich steuern. Die darauf aufbauenden Geisteszustände Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) müssen sich laut der meisten Kommentatoren des Yogasutras von alleine einstellen und werden durch lang anhaltende Konzentration und Beseitigung der Geisteshindernisse erlangt. Feuerstein bezeichnet Samyama als 'Bündelung' von Konzentration, Meditation und Samadhi. Du findest Samyama ausführlicher in den ersten Sutras des dritten Kapitels des Yogasutra hier auf yoga-welten.de besprochen. Siehe vor allem:
Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt
Yoga Sutra III-5: Aus der Meisterung von Samyama entsteht vollkommenes Wissen über das Wahrgenommene
Yoga Sutra III-6: Der Fortschritt im Samyama erfolgt in Stufen
Voraussetzungen und Umgang mit den Siddhis
Empfehlungen zu Voraussetzungen und zum Umgang mit den Siddhis
Viele Kommentatoren empfehlen, mit den Siddhis sehr bewusst umzugehen. Folgendes wird oft geraten:
Wer sich den Siddhis zuwendet, sollte die Yamas und Niyamas in seinem Leben verwirklicht haben. Diese sind:
Die Yamas – Selbstkontrolle
- Ahimsa – Gewaltlosigkeit
- Satya – Wahrhaftigkeit
- Asteya – Nicht-Stehlen
- Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit
- Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier
Niyamas – Verhaltensregeln
- Saucha – Reinheit
- Santosha – Zufriedenheit
- Tapas – Selbstzucht
- Svadhyaya – Selbststudium (Studium)
- Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen
Siehe dazu die Erläuterungen in "Yamas und Niyamas im täglichen Leben".
Siddhis sollten nicht zum Vergnügen, zur Selbsterhöhung oder anderen ungünstigen, egoistischen Zielen angewendet werden. Vielmehr zeigen die Siddhis (so Iyengar und andere), dass die Yogapraxis “richtig angelegt” sei.
Selbstverständlich sollte man Siddhis auch nicht dazu nutzen, um jemand anderen damit zu schaden.
Stattdessen wird eher ein “Nicht-Beachten” der Siddhis angeraten, wenn diese sich denn zeigen sollten. Iyengar schreibt, (S. 244), die Übungen bei Auftreten der Siddhis mit Glauben und Begeisterung weiterzuentwickeln, die Siddhis aber mit völligem Gleichmut zu betrachten.
Dem Yogi wird also geraten, sich nicht auf die Siddhis einzulassen, sich nicht von ihnen “mitreissen zu lassen”, um sie nicht für eigene selbstsüchtige Bedürfnisse zu verwenden, woraus späteres Leiden folgen würde. Stattdessen solle er/sie weiter auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln und die Siddhis eher als Prüfung ansehen, ob man nicht doch noch – trotz fortgeschrittener yogischer Entwicklung - den Verlockungen der Dualität und des Ego-Daseins nachgibt.
Swami Sivananda sagt über Siddhis:
„Yoga ist nicht dazu da, Siddhis, Kräfte, zu erlangen. Wenn ein Yogaschüler die Versuchung verspürt, Siddhis zu erlangen, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er hat den Weg verloren. Ein Yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten Samadhi zu erreichen, muss Siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von Devatas. Nur wenn man diese Siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im Yoga erlangen.“
Im tibetischen Buddhismus werden vergleichbare Fähigkeiten „Shes-rab“ genannt. Auch dort: klare Intuition, inneres Sehen, spontane Einsicht – aber nie als Ziel, sondern als Prüfstein für Demut.
Missverständnisse rund um Siddhis
Die Aussicht auf übernatürliche Kräfte fasziniert viele – und genau darin sind einige häufige Missverständnisse begründet. Ein Irrglaube besteht darin, dass Yoga hauptsächlich dazu diene, solche Siddhis zu erlangen. Tatsächlich betont die Tradition jedoch, dass Siddhis eher Nebenprodukte auf dem spirituellen Weg sind, nicht sein Zweck. Patanjali selbst stellt im unmittelbar folgenden Sutra klar, dass diese Fähigkeiten für einen im Samadhi befindlichen Geist Upasarga – also Störungen oder Ablenkungen – darstellen, auch wenn sie in einem nach außen gewandten Bewusstseinszustand als außergewöhnliche Errungenschaften erscheinen mögen. Yogameister wie Vyasa und später Vivekananda haben daher immer wieder gemahnt, die Siddhis nicht zu überschätzen: Sie seien wie Blüten am Wegesrand – schön und bemerkenswert, aber man sollte nicht vom Weg abkommen, um nur noch Blumen zu pflücken.
Ein weiteres Missverständnis liegt darin, jede ungewöhnliche innere Wahrnehmung sofort für eine echte siddhische Fähigkeit zu halten. Insbesondere wenn Übende beginnen, sich intensiv mit Meditation zu beschäftigen, können imaginäre Bilder, Lichterscheinungen oder akustische Phänomene auftauchen. Die Yoga-Tradition fordert hier Viveka, das unterscheidende Erkenntnisvermögen: Handelt es sich wirklich um eine valide intuitive Einsicht (Pratibha) oder nur um eine Wunschprojektion des Geistes? Echte spirituelle Intuition wird traditionell durch bestimmte Qualitäten kenntlich gemacht – sie geht einher mit tiefer innerer Stille, Klarheit und Gewissheit, ohne Aufregung oder Ego-Stolz. Hingegen sind halluzinatorische Erlebnisse oder irrige „Eingebungen“ oft dramatisch, emotional aufgeladen oder selbstbezogen. Es ist ein bekanntes Risiko, dass ein Yogi, der sich zu früh auf Siddhis fokussiert, Opfer von Täuschungen werden kann. Beispielsweise könnte man glauben, die Gedanken anderer lesen zu können, während man in Wirklichkeit eigenen Fantasien nachhängt.
Schließlich gibt es das Missverständnis, Siddhis seien ein Zeichen von Erleuchtung oder spiritueller Vollendung. Historische Berichte zeigen jedoch, dass auch wenig ethische oder unreife Personen zeitweise paranormale Fähigkeiten aufweisen konnten – was nicht mit wahrer Heiligkeit gleichzusetzen ist. Im Yoga wird daher gelehrt, die Siddhis weder zu verteufeln noch zu vergötzen. Sie dürfen auftauchen, doch der richtige Umgang ist entscheidend: Ein reifer Yogi nimmt sie wahr, schenkt ihnen aber wenig Bedeutung und bleibt dem höheren Ziel, Kaivalya (der völligen Befreiung), verpflichtet. Missverständnisse klären sich letztlich durch Erfahrung und Anleitung: In der traditionellen Guru-Schüler-Beziehung wurden auftauchende Siddhi-Erlebnisse vertraulich besprochen, um sicherzustellen, dass der Schüler nicht in Fallen wie Egoismus oder Ablenkung tappt. So soll auch der moderne Übende verstehen, dass Wunder im Yoga-Kontext Prüfsteine der Haltung sind – sie verlangen nach noch mehr Demut, Vairagya und Konzentration auf den eigentlichen Weg.
Möchtest du bis hierhin etwas ergänzen oder korrigieren?
Möchtest du bis hierhin etwas zum Gesagten ergänzen oder etwas korrigieren?
Vielen Dank für jeden Hinweis!

Welche Siddhis können zum Hindernis werden?
Yoga-Sutra III.38 beschreibt ein Paradox: Die durch Yoga entstehenden außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Siddhis, gelten dem gewöhnlichen Bewusstsein als beeindruckende Kräfte, wirken jedoch im Zustand tiefster Versenkung (Samadhi) als Hindernisse. Im Sanskrit heißt es: “te samādhau upasargāḥ vyutthāne siddhayāḥ” – „Diese (Erscheinungen) sind im Samadhi Hindernisse (upasarga), im weltlich-aufschwankenden Zustand jedoch Errungenschaften (siddhi)“. Patanjali betont damit, dass übersinnliche Erfahrungen zwar auf dem Yogaweg auftreten können, ein Yogi sie aber nicht mit der ultimativen Befreiung verwechseln darf. Im Folgenden werden Kommentare, Deutungen und Empfehlungen aus klassischer und moderner Sicht beleuchtet, warum und wie solche Siddhis zu Stolpersteinen auf dem Weg zur höchsten Erkenntnis werden – und wie man angemessen damit umgeht.
Auf was bezieht sich Patanjali in dieser Sutra, was wird zum Hindernis für/im Samadhi? Er beginnt die Sutra mit “Te”, übersetzt “diese”. Für mich ist unklar, ob er sich nur auf die Siddhis in der Sutra zuvor bezieht (intuitives hören, sehen, schmecken und riechen), oder ob er mit “Te” alle Siddhis meint.
Laut R. Palmer seien beide Auslegungen möglich. Zudem sieht er in dieser Sutra den Grund dafür, dass das dritte Kapitel des Yogasutras von einigen Kommentatoren eher knapp bearbeitet wurde: Wenn die Siddhis ohnehin ein Hindernis für Samadhi seien, braucht man ihnen auch nicht allzuviel Aufmerksamkeit schenken.
Hast du schon einmal während der Meditation etwas erlebt, das du als ‚nicht erklärbar‘ oder übersinnlich empfunden hast?

Ein Wort der Mahnung?
Einige (die meisten?) Kommentatoren sehen hier eine klare Warnung. Rainbowbody: „Dies ist eine Warnung, die Siddhis nicht als Selbstzweck zu verfolgen.” Das Erlangen von Siddhis kann deinen spirituellen Fortschritt behindern. Samadhi - die höchste Stufe der Meditation, Überbewußtsein - wird nicht erreicht.
Skuban (S. 215): „… der Yogi … weit … gekommen, muss vorsichtig sein. Noch ist er nicht befreit.”
Die Siddhis, so Iyengar, stellen große Errungenschaften dar. Sie bauen aber auf den Gunas auf, sind Teil der Natur und unterstehen dadurch ihren Gesetzen: sie verführen den Yogi latent, die Kräfte für eigensinnige Zwecke zu nutzen. Dadurch komme der Yogi vom eigentlichen Ziel ab.
Denn das Yoga-Ziel, so auch Iyengar, ist auch mit den unglaublichsten Siddhis nicht erreicht. Nur wer diesen Kräften mit Gleichmut begegne, könne diese für den eigenen Fortschritt nutzen. Darum sei es besser, Siddhis als Hindernisse auf dem Weg zu Befreiung zu begreifen.
So auch G. Coster, die im Yogasutra mehrere Hinweise darauf sieht, dass Siddhis bzw. okkulte Fähigkeiten “zweifellos ein Hindernis auf dem Weg” zum höchsten Samadhi seien. Patanjali zeige, wie wichtig es sei, “auf jedes Interesse an diesen Kräften zu verzichten”.
Rainbowbody: „Kurz gesagt, Samyama kann uns helfen, eine Stabilisierung in Samadhi zu erreichen, solange es nicht egoistischen Stolz oder Besitz (asmita), persönlichen egoistischen Gewinn, gierigen Besitz, Eifersucht, Ablenkungen (raga) oder irgendeine der grundlegenden Hindernisse nährt.”
Siddhis können auf unterschiedliche Weise zum Samadhi-Hinderniss werden. Zum einen, indem diese Kräfte eigennützig gebraucht werden. Das daraus entstehende Karma kann den Yogi behindern. Oder der dadurch geschürte Aufbau seines Egos, das Anhaften an weltlichen Angelegenheiten. Rainbowbody betont: „…wenn es einen [Siddhi] „erlangt“, kann das Ego denken, dass sie (das Ego) es getan haben, daher wird der Ego-Stolz und das Gefühl des Getrenntseins verstärkt … solches Denken blockiert den transpersonalen, nicht-dualen, miteinander verbundenen universellen Fluss ... Das ist nicht nur philosophische Spekulation, sondern eine sehr reale Möglichkeit, vor der wir uns hüten müssen.” Und weiter geht die dringliche Mahnung mit: „Sei dir sicher, dass Siddhis niemals lange von einem selbstdefinierten individuellen Ego besessen werden können, ohne noch größeres Leiden zu erzeugen.”
Viele klassische Kommentatoren folgen dieser Interpretation. So warnt z.B. Vachaspati Mishra in seiner Erläuterung, dass jede dieser Fähigkeiten neue Wünsche oder Ängste wecken kann, welche den Geist binden. Kein Kommentator der alten Schulen stellt (meines Wissens nach) Patanjalis Warnung grundsätzlich in Frage – die Übereinstimmung ist, dass Siddhis letztlich zum Bereich der vergänglichen Prakriti (Materie, Phänomene) gehören und den Yogi von Kaivalya (der absoluten Freiheit des Geistes) ablenken, wenn er ihnen Beachtung schenkt.
Zur Erinnerung: Ein Yogi sollte Abneigung und Anhaftung an alle Dinge und Erlebnisse ablegen (auf Sanskrit: Vairagya), so er die tiefsten Ebenen der Meditation erreichen möchte. Zwar ist es nicht unmöglich, Samadhi auch ohne diese Geisteshaltungen zu erlangen (Patanjali nennt in Sutra IV-1 verschiedene Möglichkeiten wie Kräuter etc.), doch der yogische Übungsweg baut auf diesen auf.
Moderne Interpretationen und spirituell-psychologische Aspekte
Auch moderne Yogameister und Autoren betonen die Gefahr des Ego im Zusammenhang mit Siddhis. Sie sehen in den außergewöhnlichen Erfahrungen eine Art „geistige Verführung“: Der Yogi könnte glauben, bereits erleuchtet oder etwas „Besonderes“ zu sein, weil ihm Visionen oder Kräfte zuteilwerden. Spiritueller Stolz – oft subtiler und verhängnisvoller als weltlicher Stolz – kann entstehen. Swami Sivananda etwa schrieb eindringlich, Siddhis seien „Stolpersteine“, die es rücksichtslos als seien es wertlose Kieselsteine vom Weg zu entfernen gilt. Selbst ein kleines Verlangen nach solchen Kräften könne „das kleine spirituelle Licht, das der Yogi nach vielem Ringen entzündet hat, ausblasen“. Sobald ein Aspirant ungewöhnliche Erlebnisse hat oder Kräfte entwickelt, besteht die Neigung, sich über andere erhoben zu fühlen. Der Geist denkt:
„Schaut her, was ich kann!“
– und genau dieses Ego-Denken hält den Yogi gefangen.
Psychologisch gesprochen aktiviert die Siddhi-Erfahrung tiefe Wünsche nach Anerkennung und Macht, die im Unterbewusstsein schlummern. Anhaftung entsteht, weil der Geist geneigt ist, lustvolle oder machtvolle Zustände festzuhalten. Doch damit verliert er die Offenheit und Demut, die für den nächsten Schritt zur Selbstverwirklichung nötig wären.
Ein bekannter moderner Kommentar empfiehlt daher eine Haltung der inneren Distanz: Weder nach den Siddhis haschen, noch aus Angst vor ihnen zurückschrecken. Das heißt, wenn solche Phänomene auftreten, sollte der Yogi sie weder überbewerten noch verdrängen, sondern mit Gleichmut registrieren und ziehen lassen – so, wie man in der Meditation auch vorbeiziehende Gedanken beobachtet, ohne ihnen zu folgen. Patanjali selbst lehrt die Haltung der Vairagya (Nicht-Verhaftung) auf immer subtileren Ebenen. Dies schließt die Nicht-Verhaftung an innere Erfahrungen mit ein. Jede auftauchende Fähigkeit kann als Prüfung verstanden werden, ob der Übende wirklich schon frei von Ego-Begierden ist. Besteht er diese Prüfung durch Gleichmut, vertieft sich sein Samadhi weiter. Misslingt es ihm jedoch, und er identifiziert sich stolz mit der neuen Kraft, so „fällt“ er symbolisch aus dem Himmel der Meditation zurück auf den Boden der weltlichen Geisteshaltung.
Eine poetische Lösung bietet der Mystiker Osho an: „Wenn Siddhis kommen, schenke sie dem Göttlichen.“ Damit meint er, der Yogi sollte alle außergewöhnlichen Errungenschaften sofort dem höchsten Selbst oder Gott darbringen – in dem Verständnis, dass sie nicht sein persönliches Eigentum sind. Durch dieses Loslassen bewahrt man Demut. Anstatt die Kräfte zu besitzen, übergibt man sie vertrauensvoll an das Göttliche – und öffnet sich so für das letztendliche Geschenk, die Vereinigung mit dem Göttlichen (Samadhi) selbst.
Auch andere moderne Lehrer stimmen überein, dass Hingabe und Demut die Heilmittel gegen spirituelles Ego sind. So raten etwa Gurus im Kriya-Yoga nach Paramahansa Yogananda, man solle Siddhis, so sie auftreten, lediglich zum Wohle anderer uneigennützig einsetzen oder ignorieren, aber niemals zum eigenen Ruhm. Denn jedes Zur-Schau-Stellen oder Auskosten der Macht nährt Illusion (maya) und führt letztlich zum Verlust des inneren Fortschritts.
Abenteuer Astralwelt
Sukadev schreibt ergänzend, dass man sich bei Anwendung hellsichtiger Fähigkeiten in der Astralwelt verlieren könne. Astalwesen können einem Energie entziehen oder sogar ihren Willen aufzwingen. Er verweist auf den Spruch: “Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut.” Durch fortgeschrittenes Samadhi erlange man in gewissem Sinne absolute Macht und könnte diese auch (eine zeitlang, bis man dadurch wieder “abfällt”) missbrauchen.
Der Weg ist nicht das Ziel
Eine weitere schöne Analogie gibt uns Desikachar: Er vergleicht einen Yogi, der sich den Siddhis allzusehr hingibt und diese zum Genuss verwendet mit einem Wanderer, der eigentlich auf einen Berggifel möchte, unterwegs aber an einem See in den bezaubernden Anblick von Schwänen versinkt und deswegen nicht mehr weitergeht.
Ähnlich schreibt Govindan (S. 133), der Siddhis als Wegweiser entlang des Weges betrachtet, diese aber “auf keinen Fall” als notwendig ansieht.
Weitere Deutungen dieser Sutra
Wim van den Dungen übersetzt, dass die Siddhis nur im Wachzustand vorhanden seien, nicht aber während der Meditationspraxis. Doch auch er verweist auf Sutra III-51, wo Patanjali klar sagt, dass zur Erlangung des höchsten Samadhis die Anhaftung an diese Kräfte aufgegeben werden muss.
Auch Eliade übersetzt auf S. 99 vyutthana mit „wacher Zustand“.
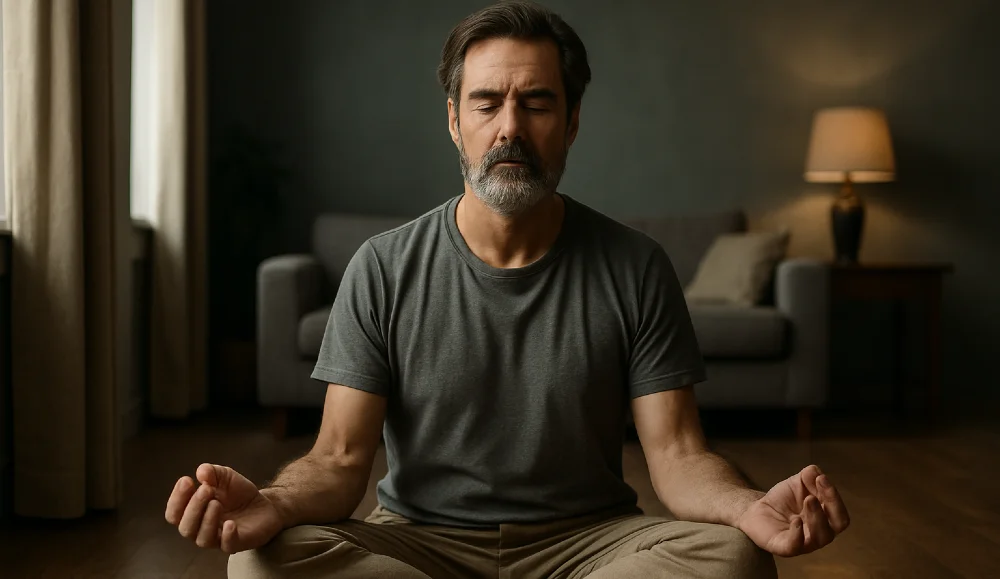
Was schützt den Yogi vor den Siddhis?
Die Rolle von Absicht, Ethik und Demut
Ein klarer Schutz vor der Verführung durch Siddhis liegt in der Rückbesinnung auf Absichtslosigkeit im Üben sowie die Verankerung in Yama und Niyama – also in Ethik, Selbstdisziplin und Hingabe. Der Yogi wird eingeladen, nicht die Früchte seiner Praxis zu suchen, sondern sich mit einer Haltung der Nicht-Anhaftung (Vairagya) auf das eigentliche Ziel – Samadhi – auszurichten.
„Samadhi ist immer noch der Name des Spiels, also werden wir daran erinnert, fokussiert zu bleiben und uns nicht abbringen zu lassen.”
Rainbowbody
An vielen Stellen wird betont, dass der Yogi fest in den Yamas und Niyamas begründet bleiben solle, um den Versuchungen der Siddhis zu widerstehen.
Der feine Unterschied zwischen Siddhi-Erleben und Samadhi-Zustand
Ein wichtiger Aspekt dieser Sutra ist die Unterscheidung zwischen dem Zustand von Samadhi – der vollständigen geistigen Sammlung – und dem Zustand von Vyutthāna, dem nach außen gewandten Geist. Siddhis treten typischerweise in Phasen geistiger Aktivität auf, nicht in tiefer Versenkung. Sie gehören damit zum Bereich der Erscheinungen, nicht der transzendentalen Realität. In Samadhi wird selbst das Erleben einer Siddhi als weiteres Objekt erkannt – und losgelassen. Siddhis sind nicht Samadhi – sie sind Erscheinungen auf dem Weg dorthin.
Siddhis als Prüfsteine innerer Unterscheidungskraft (Viveka)
Ein subtiler, aber zentraler Gedanke: Siddhis prüfen die Unterscheidungskraft (Viveka) des Yogi. Kann er erkennen, was vergänglich ist – und was nicht? Die Erfahrung übernatürlicher Fähigkeiten kann ebenso gut zur Verhaftung führen wie jede weltliche Errungenschaft. Gerade weil Siddhis so „außergewöhnlich“ erscheinen, steigt die Gefahr, sie für das Ziel zu halten. Die Fähigkeit, sie klar zu durchschauen und sich nicht mit ihnen zu identifizieren, gilt als Zeichen echter Reife.
Siddhis im Kontext des karmischen Zyklus
Ein weiterer Blickwinkel: Siddhis können – wenn sie genossen, festgehalten oder eigennützig genutzt werden – neues Karma erzeugen. Dies wirkt der Befreiung entgegen. Selbst wenn sie „gut“ verwendet werden, binden sie an die Ebene des Wirkens (Kriya) und damit an die zyklische Existenz (Samsara). Aus Sicht des klassischen Yoga ist jedoch das Ziel, aus Samsara auszusteigen, nicht sich innerhalb dessen zu optimieren.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 3.38
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
In seinem klassischen Kommentar weist Vyāsa ebenfalls darauf hin, dass die sogenannten übernatürlichen Fähigkeiten – also etwa intuitive Voraussicht, Hellsichtigkeit oder andere besondere Wahrnehmungen – unter bestimmten Bedingungen nicht als Fortschritt, sondern sogar als Hindernisse betrachtet werden müssen.
Konkret bezieht sich Vyāsa auf Situationen, in denen solche Erfahrungen oder Kräfte im Zustand tiefster Meditation auftreten – also in einem Geist, der sich in Samādhi befindet. Dieser Zustand ist geprägt von völliger Sammlung, Stille und der Ausrichtung auf das höchste Ziel des Yoga: die Erkenntnis des wahren Selbst (Purusha), frei von allen Ablenkungen.
Wenn nun gerade in dieser Phase übernatürliche Eindrücke oder Erlebnisse auftauchen, dann wirken sie wie Störungen oder Ablenkungen, weil sie den Fokus von der reinen Erkenntnis ablenken. Sie können den Geist zurückziehen in die Welt der Phänomene – also dorthin, wo Begrenzung, Wunschdenken oder Ego wieder wirksam werden. Deshalb nennt Vyāsa sie in diesem Zusammenhang „Hindernisse“ (upasargaḥ).
Anders ist es, wenn solche Fähigkeiten in einem nach außen gerichteten Geist erscheinen – also in einem Zustand, in dem der Yogi nicht in tiefer Versenkung verweilt, sondern in der aktiven Auseinandersetzung mit der Welt. In solchen Momenten können diese Kräfte als Erfolge oder Fähigkeiten gelten – also als Ergebnis intensiver Praxis oder innerer Klarheit, die dann im Alltag oder für andere hilfreich sein können.
🔍 Was heißt das konkret?
Vyāsas Aussage lässt sich wie folgt zusammenfassen:
- Wenn Siddhis im Zustand der Versenkung (Samādhi) auftauchen, wirken sie wie innere Stolpersteine. Sie können den klaren Geist verwirren und ihn in Richtung Ego oder Wunschdenken ziehen.
- Wenn Siddhis dagegen im Zustand äußerer Aktivität auftauchen – also in einem wachen, handelnden Geist –, dann werden sie als Erfolge der Praxis gesehen. Sie haben dort ihren Platz, dürfen aber nicht überbewertet werden.

Hariharanandas Auslegung von Sutra III.38
Siddhis – nur im „fließenden“ Geist von Nutzen
Swami Hariharananda stellt klar, dass Siddhis (übernatürliche Kräfte) nur dann als „Erfolge“ oder „Errungenschaften“ gelten können, wenn der Geist sich im Zustand von Vyutthāna befindet – also im nach außen gerichteten, aktiven Modus. In einem solchen Zustand, den er als „fließend, weltlich, beweglich“ beschreibt, mögen diese Kräfte nützlich erscheinen oder bewundert werden. Sie sind dann Werkzeuge im äußeren Leben, etwa zur Heilung, Wahrnehmung oder Erkenntnisgewinn. Doch das ist lediglich eine „Wirkungsebene“, nicht das Ziel des Yoga.
Siddhis als Upasarga – Störung und Gefahr im Samadhi
Im Zustand von Samadhi, insbesondere im nirbīja-Samadhi (der samenlosen, reinen Bewusstseinsversenkung), werden die gleichen Siddhis laut Hariharananda zu „upasargaḥ“ – Hindernissen, Störungen, Unterbrechungen. Warum?
Weil sie:
- das Bewusstsein wieder nach außen ziehen, das gerade dabei war, sich vollständig nach innen zu wenden;
- eine Identifikation mit dem Ich fördern können, z. B. durch Stolz („Ich habe diese Fähigkeit“);
- eine Wiederbelebung des mentalen Prozesses bedeuten (was im Zustand völliger Sammlung ein Rückschritt ist);
- und so den Übergang zur finalen Erkenntnis blockieren, in der sich Geist und Purusha (reines Bewusstsein) vollständig trennen.
Für Hariharananda ist Samadhi der Zustand, in dem alle Bewegungen des Geistes zum Stillstand kommen – auch subtilste wie die Freude an spirituellen Kräften. Wenn Siddhis auftauchen, ist das für ihn ein Zeichen, dass noch Reste von Ego oder Wunschstruktur vorhanden sind. Das Ziel des Yoga – Kaivalya, die vollständige Befreiung – kann jedoch nur erreicht werden, wenn selbst diese subtilen Bewegungen transzendiert werden.
Anders ausgedrückt: Siddhis sind im weltlichen Geist vielleicht hilfreich oder bewundernswert, doch im überbewussten Zustand des Samadhi sind sie nichts weiter als Ablenkungen – sie brechen die innere Sammlung, lassen subtilen Stolz wachsen und binden den Yogi erneut an das Spiel von Prakriti (Natur). Wer die endgültige Freiheit sucht, muss auch diese Kräfte durchschauen und loslassen.

Übungsvorschlag zu Sutra III-38
Übe Yoga diese Woche mit einem Fokus auf Absichtslosigkeit des Übens.
🧘♂️ Wie kannst du Samyama auf Sutra III.38 konkret üben?
Kurz zur Erinnerung: Was ist Samyama?
Samyama ist die Kombination aus drei Stufen der inneren Ausrichtung:
- Dharana – Konzentration auf ein Objekt
- Dhyana – Meditative Vertiefung in dieses Objekt
- Samadhi – Verschmelzung mit dem Objekt, der Geist löst sich darin auf
Zeitleiste: Pfad zu Samyama und den Siddhis
Diese Zeitleiste zeigt dir die Stufen des Yogawegs, die nötig sind, um in den Zustand von Samyama zu kommen – und wie daraus Siddhis (verfeinerte Sinneswahrnehmungen) spontan entstehen können.
🪷 Yama & Niyama
Ethische Grundlagen & Selbstdisziplin: z. B. Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sie bereiten deinen Geist auf Tiefe und Klarheit vor.
🧘 Asana
Stabiler, bequemer Sitz. Der Körper wird still, der Atem ruhig – beides ist nötig für längere innere Versenkung.
🌬️ Pranayama
Atemkontrolle als Brücke zur inneren Wahrnehmung, Pantanjali empfiehlt, Ausatmung und Einatmung und Anhalten zu verlängern und zu verfeinern. Dieses Pranayama beruhigt das Nervensystem und bereitet den Geist auf Fokus vor.
👁️ Pratyahara
Zurückziehen der Sinne. Der Blick geht nach innen. Die Außenwelt verliert an Bedeutung. Jetzt beginnt echte Sammlung.
🎯 Dharana
Konzentration auf ein Objekt (z. B. Licht, Atem, Mantra). Der Geist bleibt bei einem Punkt – erste Form von Meditation.
🧘♀️ Dhyana
Meditation. Der Fokus wird fließend, mühelos. Es gibt keine Unterbrechungen mehr – reines Verweilen im Beobachteten.
🌌 Samadhi
Verschmelzen mit dem Objekt. Kein „Ich meditiere“ mehr – nur noch reines Sein. Dies ist der Eingang in tiefe Einsicht.
✨ Übergang zu Samyama
Wenn Dharana, Dhyana und Samadhi auf dasselbe Objekt gerichtet sind – ohne Unterbrechung –, kann daraus Samyama entstehen. Dann ist der Geist hochfokussiert, durchlässig und empfänglich für tiefe, intuitive Erkenntnis.
🌟 Was entsteht daraus?
Spontan kann es geschehen, dass sich ein Siddhi zeigt, du z. B. feiner hörst, spürst, siehst – nicht mit den Sinnen, sondern von innen heraus. Denke immer daran: Siddhis sind kein Ziel, aber ein möglicher Meilenstein auf deinem Weg.
Wenn du Samyama auf diese Sutra anwendest, dann nimmst du dir die Bedeutung der Sutra selbst als Objekt deiner Meditation. Du richtest dich gezielt auf den Gedanken aus: „Siddhis können Hindernisse auf dem Weg zur Befreiung sein.“
Aber du kannst auch andere Meditationsobjekte wählen:
Samyama-Übungsgenerator: Übungsvorschläge zu Siddhis und Purusha
Was ist das?
Der Samyama-Übungsgenerator hilft dir, deine tägliche Praxis auf ein konkretes Thema auszurichten – z. B. Intuition, inneres Hören oder das wahre Selbst (Purusha). Du erhältst konkrete Vorschläge, wie du mit Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Loslassen) üben kannst – jeweils mit vorbereitenden Übungen wie Pranayama, Mantra oder Tratak.
So nutzt du das Tool: Beantworte ein paar Fragen, um eine individuelle Praxisempfehlung für Samyama zu erhalten – inklusive Vorbereitung, Meditationstext und Fokus.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Wie du diese Sutra im Alltag üben kannst
Der Alltag ist eventuell das beste Testfeld für diese Sutra – denn du bekommst dort oft kleine „Siddhi-Momente“, ohne dass du es so nennst. Und genau da kannst du bewusst üben:
Wenn du eine intuitive Eingebung hast
Vielleicht spürst du: „Der Anruf kommt gleich…“ oder „Ich weiß, was sie gleich sagen wird.“ – und du hast recht.
🧠 Was tun?
Sag dir innerlich:
„Schön, aber das macht mich nicht wichtiger. Das war keine Einladung zur Überheblichkeit.“
Übe, dich nicht innerlich aufzublasen. Das ist Praxis auf höchstem Level – mitten im Alltag.
Wenn du für etwas bewundert wirst (z. B. für deine Ruhe oder Einsicht)
Jemand sagt: „Wow, wie du das gespürt hast – das war irgendwie… krass.“
💬 Dein inneres Training:
Nimm es freundlich an, aber erinnere dich:
„Diese Dinge tauchen auf, aber sie gehören nicht mir. Ich lasse sie durch.“
Du bleibst ein Kanal, kein Besitzer. Siddhis, wenn sie auftauchen, sollen durch dich fließen, nicht an dir haften bleiben.
Wenn du dich besonders spirituell oder „weiter“ fühlst
Manchmal kommt so ein stilles Ego-Gefühl: „Ich meditiere schon so lange, ich spüre mehr als andere.“
💥 Genau hier greift die Sutra. Sag dir:
„Auch das ist nur eine Erscheinung. Ich übe weiter – ohne Anspruch, ohne Titel.“
Mach weiter wie ein Anfänger. Das schützt dich vor dem Sturz, den Stolz bringt.
Kleines Alltagsritual: „Erkenne und lass los“
Immer wenn du merkst: „Da war was Besonderes“ – sei es ein Gedanke, eine Erfahrung, ein Traum – halte einen Moment inne, atme bewusst und sag dir:
„Ich erkenne es – und ich lasse es los.“
Das kannst du überall üben: im Supermarkt, im Bus, im Gespräch. So wird die Sutra zu einer Haltung.
Sutra III.38 ist keine theoretische Warnung – sie ist eine Einladung zur Demut inmitten von Wachstum. Ob in tiefer Meditation oder in alltäglichen Momenten, in denen dein Geist ungewöhnlich klar ist – du kannst immer wieder üben:
„Ich bin auf dem Weg, aber ich verweile nicht bei den Leuchtreklamen am Straßenrand.“
Wenn du das verinnerlichst, werden auch die Siddhis, die vielleicht irgendwann auftauchen, nicht zur Falle, sondern zur Durchgangsstation.
Du übst nicht, um Macht zu erlangen – du übst, um frei zu sein.

Perspektiven aus Buddhismus und Tantra
Nicht nur im Yoga, auch in anderen spirituellen Traditionen gibt es ähnliche Erkenntnisse zum Thema übersinnlicher Fähigkeiten. Im Buddhismus werden die vergleichbaren Fähigkeiten Iddhi genannt. Es ist überliefert, dass der Buddha selbst solche Wunderkräfte entwickeln konnte (traditionelle Beispiele sind das Gehen über Wasser, Fliegen oder Gedankenlesen). Dennoch betonte Buddha stets, dass diese Fähigkeiten nur Nebenprodukte auf dem Weg zur Erleuchtung sind. Sie sind nicht das Ziel der buddhistischen Praxis. In den Lehrreden wird berichtet, dass Buddha seine Mönche sogar ermahnte, siddhi-artige Kräfte weder zur Schau zu stellen noch aktiv anzustreben. Sie könnten den Praktizierenden vom eigentlichen Pfad ablenken und Ego-Anhaftung fördern. Die buddhistische Priorität liegt auf Reinheit des Geistes und Einsicht in die Wahrheit – im Vergleich dazu sind wundersame Fähigkeiten wie Glanzlichter, die auftauchen und vergehen. Der Ratspruch lautet:
Bleibe achtsam und unbeeindruckt, selbst wenn meditative Vertiefung zu ungewöhnlichen Erlebnissen führt.
Das höchste „Wunder“ im Buddhismus sei nicht, übernatürliche Taten zu vollbringen, sondern Gier, Hass und Unwissenheit auszumerzen. Entsprechend ist die Empfehlung, die Konzentration (Samadhi) zu nutzen, um Weisheit (Prajna) zu erlangen, statt sich mit magischen Fertigkeiten zu beschäftigen.
Im Tantra – insbesondere im spätere hinduistischen und buddhistischen Tantra – wird der Begriff Siddhi in zweifacher Weise verstanden. Zum einen kennt man auch hier die klassischen acht großen Siddhis (Aṇimā, Mahimā, Laghimā, Prāpti, Prākāmya, Iśitva, Vaśitva und Garimā), also die Fähigkeit, sich zu verkleinern, vergrößern, schweben etc., die durch fortgeschrittene Praktiken erlangt werden können. Zum anderen bezeichnet Siddhi im tantrischen Kontext oft die vollkommene Verwirklichung an sich – nämlich das Einswerden mit dem Absoluten.
So wird etwa im Kularnava Tantra die höchste Śakti (Kraft) als jene gepriesen, die den Aspiranten in den Zustand der Einheit mit Śiva führt – das wäre dann die Mahāsiddhi, die große Vollendung. Tantriker unterscheiden also zwischen „kleinen“ siddhis und der einen großen Siddhi der Erleuchtung.
Viele tantrische Meister warnen daher ebenfalls: Wer sich unterwegs in den kleinen Kräften verliert, verfehlt die höchste Errungenschaft. Allerdings gibt es innerhalb der tantrischen Tradition auch die Ansicht, dass bestimmte siddhis dem Yogi auf seinem Weg nützlich sein können – etwa um anderen zu heilen, Schutz zu geben oder die eigene Praxis zu unterstützen. In tibetisch-buddhistischen Yogas zum Beispiel gelten Fähigkeiten wie tummo (innere Hitze) oder chöd (Austritt aus dem Körper) als Ergebnis intensiver Übungen, werden aber eingebettet in einen ethischen Kontext von Mitgefühl und Leerheitsweisheit.

Praktische Empfehlungen für den Umgang mit Siddhis
Was soll nun ein Yoga-Übender tun, wenn ihm tatsächlich ungewöhnliche Siddhis begegnen? Aus den oben dargestellten Lehren und Kommentaren lassen sich einige praktische Ratschläge ableiten:
- Innere Distanz bewahren: Begegne jeder auftauchenden Erfahrung mit ruhiger Beobachtung. Weder euphorisch hochspringen noch in Angst verfallen. Erkenne die Erscheinung an, aber bleibe innerlich unbeteiligt – so, als ob sie einem anderen widerfährt. Diese Haltung der Zeugenbewusstheit verhindert, dass sich sofort Ego-Identifikation bildet.
- Nicht-Anhaftung üben: Anhaftung ist der Kern des Problems. Deshalb sollte man bewusst loslassen, sobald man eine besondere Fähigkeit spürt. Zum Beispiel kann man sich sagen: „Interessant, aber vergänglich. Ich lasse es ziehen.“ Meditativ bedeutet das, die Aufmerksamkeit sanft zurück auf den eigentlichen Fokus zu lenken (etwa den Atem oder das Mantra), anstatt das Phänomen weiter zu verfolgen.
- Demut kultivieren: Erinnere dich, dass jede Kraft letztlich ein Geschenk der Yoga-Shakti (der transformierenden Kraft der Praxis) ist – nicht das Verdienst des kleinen Ich. Eine mentale Affirmation kann helfen, etwa: „Möge dieses Phänomen dem höchsten Wohl dienen, nicht meinem persönlichen Ruhm.“ Diese demütige Gesinnung schützt vor spirituellem Stolz. Traditionell raten Gurus, solche Erlebnisse nur mit dem eigenen Lehrer zu besprechen, nicht vor Laienschülern zu prahlen.
- Ausrichtung auf das Ziel beibehalten: Der Yogi sollte sich immer wieder vergegenwärtigen, dass Samadhi bzw. die Selbsterkenntnis das eigentliche Ziel ist. Siddhis sind Zwischenstationen. Indem man den Geist auf das höhere Ziel richtet – beispielsweise durch Gebet oder die Fokussierung auf das innere Selbst (Atman) –, relativiert man automatisch die Bedeutung der Nebeneffekte. Das hilft, Versuchungen zu widerstehen.
- Ethische Verwendung (wenn überhaupt): In manchen Fällen mögen Siddhis spontan eingesetzt werden – etwa ein Heiler, der intuitiv die Krankheit eines Patienten „sieht“. Hier gilt die Regel der Selbstlosigkeit: Verwende eine Gabe nur zum Wohle anderer und ohne Gegenleistung zu erwarten. Und auch dann: Lass keine Routine daraus werden. Jeder Gebrauch birgt die Gefahr von subtilem Stolz. Viele Meister betonen, dass es oft besser ist, die Fähigkeit ruhen zu lassen, als sie demonstrativ zu nutzen.
Zusammengefasst lautet der Rat der Weisen: Sei nicht beeindruckt von deinen eigenen Kräften. Betrachte sie wie schöne Wolken am Himmel – sie ziehen vorbei. Der wahre Himmel deiner Bewusstheit aber ist unendlich weit und klar, jenseits dieser Wolken. Yoga-Sutra 3.38 erinnert den Übenden daran, dass der letzte Durchbruch zu dieser Klarheit nur gelingt, wenn er bereit ist, alles Loszulassen – selbst die verlockenden Funken mystischer Macht. Indem der Yogi diese Lektion verinnerlicht, verwandeln sich die potenziellen Hindernisse letztlich in Wegweiser: Jede Siddhi, die er entschlossen loslässt, bringt ihn einen Schritt näher zur endgültigen Freiheit in Samadhi.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga-Sutra III.51 (III.52 in manchen Zählungen): Hier geht Patanjali noch einen Schritt weiter: Selbst wenn ein Yogi aufgrund seiner Fortschritte von himmlischen Wesen gelobt oder in höhere Sphären „eingeladen“ wird, soll er weder anhänglich werden noch stolz lächeln. Andernfalls – so die Mahnung – drohen „unerwünschte Konsequenzen“, was bedeutet, dass der subtile Keim von Ego und Anhaftung wieder auflebt und die Befreiung verzögert. Dieser Vers personifiziert gewissermaßen die Versuchung: Nicht nur die Kräfte selbst, sondern auch Ruhm und Anerkennung dafür sind Fallen auf dem Weg. Ein Yogi, der Stimmen innerer oder äußerer Bewunderer hört, soll unbeirrt und demütig bleiben.
Yoga Sutra III-51: Wenn ein Yogi auch an diese (Allmacht, Allwissenheit …) nicht anhaftet wird der letzte Samen des Bösen zerstört und vollständige Befreiung (Kaivalya) erlangt
Yoga-Sutra IV.1: Zu Beginn des vierten Kapitels wird erläutert, wie Siddhis entstehen können – nämlich auf verschiedenen Wegen: „Geburt, Kräuter, Mantra, Askese oder Samadhi”. Diese Aufzählung macht deutlich, dass übersinnliche Fähigkeiten keineswegs exklusiv ein Produkt wahrer Erleuchtung sind. Sie können auch rein zufällig (durch Geburt oder Substanzen) oder durch intensive Praxis ohne innere Reinheit entstehen. Damit relativiert Patanjali den Wert der Siddhis: Ihre Präsenz ist kein zuverlässiger Maßstab für spirituellen Fortschritt. Ein Yogi könnte z.B. durch strenge Askese oder mantra-Induktion Kräfte erlangen, ohne jedoch die endgültige Loslösung erreicht zu haben. Sutra IV.1 unterstreicht also nochmals, dass das Ziel nicht Siddhi, sondern Kaivalya (Befreiung) ist.
Yoga Sutra IV-1: Die außergewöhnlichen Kräfte (Siddhis) können von Geburt an bestehen oder durch Kräuter, Mantren, Selbstzucht/Askese oder Samadhi (tiefe Meditation) erlangt werden

🤓 Im Zusammenhang interessant
- Die alten Yogis kannten mehr als 25 Siddhis, darunter auch skurrile wie „das Schweben auf einem Lotusblatt“ – das war wohl eher metaphorisch gemeint.
- Siddhis sind im Buddhismus ebenfalls bekannt, dort aber noch klarer als Ablenkung vom Erwachen benannt. Buddha soll seine Kräfte bewusst nicht zur Schau gestellt haben.
- In tantrischen Texten werden Siddhis teils als weibliche Energiewesen beschrieben, die den Yogi „testen“, ob er noch verhaftet ist – fast wie spirituelle Verführungsgestalten.
- In tibetischen Klöstern wurden Mönche mit siddhi-artigen Erfahrungen oft besonders genau beobachtet, ob sie demütig blieben – oder sich „heilig“ fühlten.
- **Der Spruch „Der Weg ist das Ziel“ passt hier nicht ganz – im Yoga heißt es eher: „Der Weg ist voller Umwege, die nicht das Ziel sind.“ Siddhis sind so ein Umweg.
- Im modernen Neurospiritismus werden Siddhi-Erfahrungen manchmal mit außergewöhnlichen Gehirnzuständen erklärt, etwa Mikro-Sleep, Synästhesie oder temporäre Dissoziation. Ob’s das wirklich trifft, bleibt offen.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra III-38
Siddhis als Hindernisse für Samadhi – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra - Kap. 3, Vers 38
Länge: 7 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Was sind Siddhis? – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 3.38 (bei ihr Sutra 3.37)
Länge: 8 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Kräfte von Samyama, Class 59: Asha Nayaswami zu Sutra 3:37-39
Länge: 75 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


