Karmâshuklâkrishnam yoginas tri-vidham itareshâm
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम्
Yogasūtra 4.7 klingt unscheinbar – „Handlungen des Yogī sind weder schwarz noch weiß“ –, doch in dieser Kürze steckt ein ganzer Kosmos. Wer genauer hinschaut, stößt auf die Frage, wie wir handeln, warum wir handeln und welche Spuren wir damit in uns selbst hinterlassen. Karma.
Der Artikel beleuchtet klassische Kommentare von Vyāsa und Śaṅkara, würzt sie mit neueren psychologischen und neurowissenschaftlichen Einsichten und stellt sie neben alltagspraktische Beispiele. So handelst du wie ein Yogi.
Kurz zusammengefasst
- Karma-Arten
Vyāsa unterscheidet vier Formen von Karma: schwarz (schädlich), weiß-schwarz (gemischt), weiß (heilsam) und weder weiß noch schwarz (transzendent). - Handlungen des Yogī
Ein Yogī handelt ohne Ego-Anhaftung und ohne Erwartung einer Frucht. Daher erzeugt er kein neues Karma – seine Handlungen sind farblos, frei von moralischer Färbung. - Rolle des Geistes
Weißes Karma entsteht aus Studium und Meditation, während schwarzes und gemischtes Karma vor allem durch äußere Interaktionen entstehen. Der Geist entscheidet über die Qualität der Handlung. - Śaṅkaras Ergänzung
Für gewöhnliche Menschen ist Karma wie ein Fahrzeug, das sie ständig antreiben. Für den Yogi kommt dieses Fahrzeug zum Stillstand – er fährt nicht mehr weiter. - Moderne Psychologie
Forschung zeigt, dass selbstloses Handeln nicht nur den anderen, sondern auch einem selbst guttut. Wer ohne Erwartung hilft, ist langfristig glücklicher. - Neurowissenschaft
Studien zu Meditation zeigen eine deutliche Verringerung der Aktivität im Default Mode Network, das für Ego-Denken zuständig ist. Weniger Ego bedeutet weniger „Färbung“ von Handlungen. - Praxisnähe
Alltagsszenen wie Stau, Lob, Konflikte oder Selbstkritik werden zum Übungsfeld: Statt sofort „schwarz“ oder „weiß“ zu urteilen, lässt sich eine weder-noch-Haltung kultivieren.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Karma, karmā = Handlung; Auswirkung von Taten; Gesetz von Ursache und Wirkung; Handeln mit Motivation;
Hinweis: Das Wort Karma bedeutet nicht „Schicksal“, sondern schlicht „Handlung“. Alles andere – Belohnung, Strafe, Wiedergeburt – ist Kommentar und Auslegung. - Sukla = weiß; makellos; unbefleckt;
- Ashukla, aśuklā = nicht weiß; nicht hell; unrein; befleckt;
- Akrishnam, a-kṛṣṇa = nicht schwarz; nicht dunkel;
- Yoginah, yoginaḥ = von einem Yogi; für einen Yogi; zu den Yogis gehörend; der Yogin; jemand, der den Yoga erreicht hat;
- Tri = drei;
- Tri-vidham, tri-vidhā = dreifach; von dreierlei Art; dreierlei;
- Itaresham, itareshâm, itareṣām = von anderen; für andere; der anderen;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Im Kern spricht Patanjali in dieser Sutra über die Qualität von Karma, also über die ethische „Färbung“ unserer Taten und deren Auswirkungen. Die Wörter weiß und schwarz stehen sinnbildlich für gute bzw. schlechte Taten (verdienstvoll oder schädlich), und „dreierlei Art“ impliziert noch eine dritte Kategorie: eine Mischung aus beiden. Ein normaler Mensch tut mal Gutes, mal Böses, mal etwas Dazwischen – und all diese Taten hinterlassen Spuren. Für den Yogi aber gelten diese Kategorien nicht mehr. Seine Handlungen erzeugen kein Karma mehr in den üblichen Farben. Er hat gewissermaßen das Spiel von moralisch gut vs. schlecht transzendiert, ohne dabei beliebig oder gewissenlos zu handeln.

Schlüsselbegriffe und ihre Bedeutung
- Karma: Wörtlich „Handlung“ – gemeint ist das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung. Jede bewusst ausgeführte Tat (körperlich, verbal oder sogar gedanklich) hinterlässt gemäß der Yoga-Lehre einen Eindruck und führt irgendwann zu entsprechenden Konsequenzen. Gutes Handeln bringt positive Früchte, schlechtes Handeln negative. Diese „Karmaspuren“ prägen unser Unterbewusstsein (Saṃskāras) und beeinflussen zukünftiges Verhalten.
- „Weiß“ (śukla) und „Schwarz“ (kṛṣṇa): Diese Farben stehen symbolisch für ethisch positive bzw. negative Handlungen. Weißes Karma entspricht guten Taten, die nützen und glücksverheißende Ergebnisse nach sich ziehen. Schwarzes Karma entspricht bösen oder egoistischen Taten, die schaden und Leid nach sich ziehen. Die klassischen Kommentatoren erklären, dass es daneben gemischtes Karma gibt – eine Mischung aus Gut und Schlecht. Ein Beispiel: Eine Handlung mag edle Motive haben, aber unbeabsichtigt Schaden anrichten (oder umgekehrt); solche Taten gelten als „weiß-schwarz gemischt“. Für gewöhnliche Menschen sind alle Handlungen in diese drei Kategorien einzuteilen – Patanjali sagt: trividham itareṣām, „dreifach [ist das Karma] der anderen“.
Dreierlei Art könnte auch bedeuten: lasterhaft, tugendhaft oder gemischt. - Yogi (yogin): Hier bezeichnet der Begriff einen Menschen, der den Yogaweg gemeistert hat – im Grunde einen Erleuchteten oder Heiligen, der völlige innere Klarheit erlangt hat. Ein solcher Yogi hat das citta-vṛtti-nirodhaḥ, das zur-Ruhe-Bringen der Gedankenfluktuationen (Sūtra 1.2), verwirklicht und ruht im Zustand reinen Gewahrseins. Er handelt ohne Ego-Anhaftung und ohne Unwissen (avidyā). In Patanjalis Philosophie bedeutet dies, dass der Yogi zwar noch handeln mag, diese Handlungen aber keine neuen karmischen Spuren mehr hinterlassen. Sein Karma ist „aśukla akṛṣṇa“ – weder weiß noch schwarz –, also unbefleckt, farblos, jenseits von Gut und Böse im moralischen Sinne.

Karma: weiß, schwarz und ...
Die Lehre vom Karma findet sich in fast allen östlichen Philosophien und Weisheitslehren. Karma meint ein Prinzip von Ursache und Wirkung, das auf die menschlichen Handlungen und ihre Auswirkungen angewendet wird. Wichtig: Es soll sich auch über den Tod und damit auf die kommenden Wiedergeburten ausdehnen können.
Das Karma einer Handlung oder eines Gedankens wird dabei quasi auf einem Karma-Konto verbucht und wird unweigerlich irgendwann zur Auszahlung kommen:
- Gutes Karma zum Beispiel in Form einer guten Wiedergeburt.
- Schlechtes Karma zum Beispiel in Form eines Missgeschickes oder einer niederen Wiedergeburt.
Man kann sich das so vorstellen, dass das Karma einer Handlung (und auch schon von einer gedachten Handlung) in einem Karma-Speicher eingebracht wird. Dieser Speicher hat den Drang, das Karma wieder an den Einlagerer zurückzugeben. Dies geschieht in Form von “Schicksal”.
In den Worten auf Rainbowbody: „Der wichtigste Punkt in Bezug auf Karma wäre, sich vor Augen zu halten, dass vergangene karmische Samen Schalen/Boxen erschaffen, die den gegenwärtigen Wahrnehmungsbereich des Handelns verdecken und dazu neigen, eine Zukunft zu diktieren und aufzuzwingen, die sich dem gewöhnlichen Menschen unbewusst, aus Unwissenheit, anschleicht.”

Tri-vidham: Die drei Arten des Karma
Menschliche Handlungen und Gedanken werden von Menschen normalerweise in dreierlei Art unterschieden:
- Gute Folgen (weisses/helles Karma)
- Neutrale Folgen (neutrales Karma)
- Schlechte Folgen (dunkles/schwarzes Karma)
Iyengar definiert wie folgt:
- Schwarzes Handeln -> tamasische Wirkung, Laster
- Graues Handeln -> rajasische Wirkung, gemischte Früchte und Gefühle
- Weißes Handeln -> sattvische Wirkung, Tugend
- Ungemischtes Handeln eines Yogi -> Frei von Karma, von Reaktionen im Bewusstsein, frei von Dualität
Manche Kommentatoren interpretieren Tri-vidham folgendermaßen: Für andere (itaresam oder Nicht-Yogis), die Ursache und Wirkung unterworfen sind, und die das nicht wissen, können ihre Handlungen in den dreifachen Begriffen der Gunas (Rajas, Tamas oder Sattva) unterschieden werden.
Für den Yogi gilt dies nicht …
So schreibt Patanjali in dieser Sutra. Dies kann auf verschiedene Weise interpretiert werden.
Zum einen wird der Yogi angehalten, all seine Taten ohne Suche nach persönlichem Vorteil zu begehen. Der Yogi handelt, identifiziert sich aber nicht mit diesen Handlungen und auch nicht mit deren Ergebnis. Die Gita spricht in diesem Zusammenhang vom “geschickten Handeln” eines Yogi. So schützt sich der Yogi vor künftigen “dreierlei” Karma.
Wim van den Dungen listet das für den Yogi “vierfältige” Karma auf:
- (1) schwarz : die Folgen negativer Handlungen, wie sie von bösen Wesen ausgeführt werden ;
- (2) weiß/schwarz : die Folgen, wie man sie bei normalen Menschen findet ;
- (3) weiß : wie man es bei tugendhaften Menschen findet ;
- (4) weder schwarz noch weiß: wie man sie bei einem Adepten (Meister) Yogi findet. Da letzterer die Moral transzendiert hat, ist er oder sie nicht moralisch oder unmoralisch, sondern a-moralisch.
Siehe auch den ganz ähnlich klingenden Vers im Tao Te King, zweites Kapitel:
Also auch der Berufene:
Er verweilt im Wirken ohne Handeln.
Er übt Belehrung ohne Reden.
Alle Wesen treten hervor,
und er verweigert sich ihnen nicht.
Er erzeugt und besitzt nicht.
Er wirkt und behält nicht.
Ist das Werk vollbracht, so verharrt er nicht dabei,
Und eben weil er nicht verharrt,
bleibt er nicht verlassen.
Diese Verse sind recht unterschiedlich übersetzt worden. So zum Beispiel die Zeilen mit dem Wirken und Erzeugen:
er erzeugt, ohne etwas zu besitzen
er handelt, ohne etwas zu erwarten
er vollendet, ohne dabei zu verweilen
etc. Man erkennt, dass es Lao-Tse hier auch um absichtsloses Handeln ging.
Man diese Sutra auch dahingehend deuten, dass ein Yogi alle Ereignisse des Lebens gleichmütig annimmt. Ohne die Erfahrungen in gut, schlecht oder gemischt/neutral zu interpretieren. Die Welt, Menschen, Naturereignisse: der Yogi bewertet diese nicht und kommentiert nicht mit “will ich” oder mit “will ich nicht” und urteilt auch nicht.
Entscheidend soll auch sein, dass er “in Freiheit und außerhalb der Kausalität handelt” (Iyengar S. 294), ein Yogi also derjenige sei, der ohne Motiv, Absicht oder Wunsch eine Handlung durchführt. Iyengar vergleicht das mit dem Steigenlassen eines Drachens, ohne diesen an eine Schnur zu binden.
Der Yogi strebt also eine innere Ruhe gegenüber den eigenen Erfahrungen an und kultiviert die Perspektive des inneren Beobachters. Die Gefühle und Gedanken eines Yogis seien “frei von äußerer Färbung”, so R. Sriram (Seite 230).
Wim van den Dungen: „Der Yogi transzendiert Moral und Unmoral. Er oder sie ist vollkommen a-moralisch.”
Ist das Leben dann nicht furchtbar eintönig?
Mitnichten, sagen große Yogis. Sadguru beispielsweise betont immer wieder, dass er keinem äußeren Einfluss erlaube, etwas an seiner inneren Haltung und Emotionalität zu ändern. Fühlt er sich dann immer langweilig neutral? Irgendwie ruhiggestellt? Im Gegenteil, wenn man seinen Worten glauben kann. Einmal sagte er, dass er, obwohl er nie entsprechende Substanzen genommen habe, fühle er sich immer “high”. Das hört sich alles andere als langweilig an …
Kennst du das "Handeln ohne Erwartungen"?
Wann hast du das letzte Mal gespürt, dass du etwas ohne Erwartung getan hast?
Beschreibe die Situation in wenigen Worten.

Klassische Kommentare: Vier Arten von Karma und die besondere Rolle des Yogi
Schon die alten Lehrer der Yogaphilosophie haben Sūtra 4.7 ausführlich kommentiert. Vyāsa, der perhaps einflussreichste klassische Kommentator des Yoga-Sutra, erklärt, dass es insgesamt vier Arten von Karma gibt:
- Schwarzes Karma – sündhaftes, negatives Handeln.
- Weiß-schwarzes Karma – gemischte Handlungen mit teils guten, teils schlechten Wirkungen.
- Weißes Karma – tugendhaftes, positives Handeln.
- Weder weiß noch schwarz – ein Karma, das weder gut noch schlecht ist.
Die ersten drei Arten gelten für die „anderen“, also für gewöhnliche Menschen. Die vierte Art aber ist laut Vyāsa einzig dem Yogi vorbehalten. Damit ist nicht gemeint, dass der Yogi eine mysteriöse vierte Sorte von Taten vollbringt – sondern dass seine Taten keinerlei egoistische Motivation und keine Anhaftung an Ergebnisse mehr enthalten. Solche Handlungen sind in gewisser Weise farblos, „transzendent“ – sie begründen kein neues Karma, sie binden nicht. Wie Vyāsa erläutert, führt der Yogi keine bösen Taten mehr aus, und die guten Taten, die er tut, vollbringt er ohne Erwartung einer Belohnung. Dieses Handeln ohne persönlichen Gewinnzweck entspricht dem Prinzip des niṣkāma-karma, das auch in der Bhagavad Gītā als Ideal des Karma-Yoga beschrieben wird: also Handeln, ohne Früchte zu begehren.
Ein weiterer klassischer Kommentar, die Bhāsvatī, betont, dass bereits ein spiritueller Übender (sādhaka), der konsequent die ethischen Regeln (yama und niyama) einhält, sich dem Karma eines Yogis annähern kann. Solch ein Übender handelt tugendhaft und selbstlos, sodass seine Taten „weder schwarz noch weiß“ im karmischen Sinne werden – sprich: er sammelt deutlich weniger neue Verstrickungen an. Swami Hariharānanda Āraṇya interpretiert den Vers ähnlich: Die asketischen Übungen und das selbstlose Studium des Yogis dienen der Abmilderung der Kleshas (Leidenschaften und Ursachen des Leidens), und seine Verhaftungslosigkeit sorgt dafür, dass seine Handlungen nicht mehr an Haftung und Wiedergeburt binden. Sobald kein persönliches Verlangen und kein Hass mehr im Spiel sind, erlischt die karmische „Klebrigkeit“ der Taten.
Der Yogi lebt in der Welt wie das Blatt eines Lotus, das im Wasser wächst, aber von den Wassertropfen abperlt.
Eine klassische Allegorie vergleicht den erleuchteten Menschen mit einem Lotus, der im schlammigen Teich wurzelt und dennoch makellos über der Oberfläche erblüht. So bleibt der Yogi unberührt vom Schmutz der Welt, unbefleckt von Karma und Leidenschaften. Für einen außenstehenden Betrachter mag es kaum möglich sein zu beurteilen, ob eine Tat absolut gut oder schlecht ist – oft liegen diese Wertungen im Auge des Betrachters. Schon die Weisen warnten davor: „Es ist selbst für einen intelligenten Menschen sehr schwierig zu entscheiden, welche Tat gut oder böse ist“. Genau deshalb operiert der Yogi auf einer anderen Ebene: Er handelt allein aus der Klarheit des Geistes, frei von Unwissenheit (avidyā) und Ego (asmitā), und daher entzieht sich sein Handeln der üblichen moralischen Einfärbung. Seine Taten geschehen im Einklang mit dem Dharma, ohne dass er darüber nachgrübelt.
Die meisten klassischen Lehrer stimmen in dieser Deutung überein, doch sie betonen auch implizit: „Weder schwarz noch weiß“ bedeutet nicht, dass der Yogi Beliebiges oder Gar-Nichts tut. Es bedeutet, dass er nicht mehr aus persönlichen Vorlieben oder Abneigungen heraus handelt. Ein wahrer Yogi wird – gerade weil er keinen egoistischen Antrieb mehr hat – nicht willentlich etwas Unheilsames tun. Im Gegenteil, sein Handeln ist oft spontan zum Guten gerichtet, jedoch ohne dass er innerlich zwischen „ich tue Gutes“ oder „ich vermeide Böses“ unterscheidet. Er plant nicht nach kalkulierten Vorteil und wertet nicht im Nachhinein seine Tat als Erfolg oder Misserfolg.
In den Worten des modernen Mystikers Osho:
„Der erleuchtete Mensch lebt nicht durch den Verstand; Gott (das Höhere) denkt und handelt durch ihn. Er bewertet nicht mehr, ob etwas gut oder schlecht war – er lässt den Moment entscheiden.“
So radikal diese Aussage klingt, sie unterstreicht die Essenz: Für den Selbstverwirklichten gibt es kein Ich mehr, das Karma anhäufen könnte.
 Der Yogi handelt wie der Lotus im Teich: die Pflanze wächst im Schlamm, bleibt aber selbst unbefleckt
Der Yogi handelt wie der Lotus im Teich: die Pflanze wächst im Schlamm, bleibt aber selbst unbefleckt
Moderne Auslegungen: Erwartungslosigkeit, Psychologie und Neurowissenschaft
Auch zeitgenössische Yogalehrer und spirituelle Autoren haben Yoga-Sutra 4.7 interpretiert – oft mit einer Betonung, wie man diese Weisheit in der Praxis umsetzen kann. So erklärt ein Kommentar (Sukadev auf Yoga-Vidya) aus der Sivananda-Tradition: „Für einen Yogi ist Karma weder weiß noch schwarz, weder erwünscht noch unerwünscht – es ist einfach. Der Yogi hat nicht das Bedürfnis, dass etwas Bestimmtes eintritt, sondern nimmt erwartungslos das an, was kommt, und lernt daraus. Für ihn gibt es letztlich Erfahrungen, Lektionen und Aufgaben – für andere gibt es Erwünschtes und Unerwünschtes.“. Das heißt, der fortgeschrittene Yogi lebt in einer Haltung von Annahme und Gleichmut. Was immer das Leben ihm präsentiert, wird als Gelegenheit gesehen, zu wachsen oder zu lernen, nicht als Grund zu jubeln oder zu verzweifeln.
Man könnte sagen, Patanjalis Yogi bewegt sich mental „jenseits von Gut und Böse“ – allerdings nicht im Sinne eines zynischen Moralrelativismus, sondern im Sinne einer tiefen Vertrauens und Gelassenheit. Er akzeptiert freudig das Gute, erträgt gelassen das Schwere, ohne daran anzuhaften. Es wird schon alles irgendwie Sinn machen ...
Wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle den Unterschied: Solange wir uns ständig denken hören „Oh nein, hoffentlich passiert X nicht“ oder „Das muss jetzt aber Y werden!“, handeln wir eben nicht wie ein Yogi, sondern wie jemand, der vom eigenen Wunschdenken getrieben wird. Erwischen wir uns bei solchen Gedanken, dürfen wir laut Patanjali feststellen: Wir sind „noch nicht im Zustand des Yogis“ angekommen. Ein Yogi würde in derselben Situation weder innerlich jammern noch wünschen, dass alles anders wäre – er würde die Situation einfach so sehen, wie sie ist, und angemessen darauf reagieren.
Diese Erwartungslosigkeit hat paradoxerweise eine enorme Kraft: Sie bedeutet nicht Passivität, sondern Handeln aus der Fülle des Augenblicks, ohne inneren Widerstand.
Spannend ist, dass moderne Wissenschaft viele dieser uralten Einsichten bestätigt – wenn auch mit anderer Sprache. In der Psychologie wird etwa viel über intrinsische Motivation und Altruismus geforscht. Als altruistisch definiert man Handlungen, die aus echtem Mitgefühl und ohne Erwartung einer Gegenleistung erfolgen. Die Ergebnisse zeigen, dass solche selbstlosen Taten sowohl den Empfängern als auch den Handelnden selbst guttun: Wer ohne Hintergedanken hilft, erntet beim Gegenüber eher Dankbarkeit statt Schuldgefühle – und fühlt sich interessanterweise auch selber glücklicher und erfüllter.
Psychologen sprechen vom „Warm Glow“-Effekt: einem inneren Wärmegefühl, das entsteht, wenn wir Gutes tun, nur um des Guten willen.
Ein bekanntes Experiment fand heraus, dass Menschen, die etwas Geld für andere verwendeten, am Ende des Tages glücklicher waren als diejenigen, die das gleiche Geld nur für sich selbst ausgegeben hatten. Anders formuliert: Handeln ohne Ich-Bezug reduziert inneren Stress und fördert das Wohlbefinden. Das deckt sich verblüffend mit Patanjalis Behauptung, dass niṣkāma-karma – wunschloses Handeln – letztlich aus dem Leiden befreit.
Auch die Neurowissenschaften erlauben heute einen Blick auf den Geisteszustand eines Yogi. Wenn Patanjali sagt, der Yogi habe kein individuelles Ego mehr in seinen Handlungen, lässt sich das neurobiologisch so umschreiben: In einem vollkommen präsenten, meditativen Zustand fährt die Hirnaktivität, die mit dem Ich-Denken verbunden ist, stark herunter. Neurowissenschaftler nennen das ruhende Selbstbezugssystem des Gehirns das Default Mode Network (Standardnetzwerk, das aktiv ist, wenn wir gedankenwandern oder an uns selbst denken). Genau dieses Netzwerk wird bei geübten Meditierenden deutlich weniger aktiv, wenn sie sich im Zustand achtsamer Gegenwärtigkeit befinden.
Die alten Yogis (auch Patanjali) sprachen von citta-vṛtti-nirodhaḥ, dem „Zur Ruhe Bringen der Gedankenwellen“ – modern könnte man sagen, es entspricht dem Herunterregulieren des DMN und dem Aufleuchten anderer Hirnareale für Konzentration im Jetzt. In der Tiefe der Meditation verschwindet das zwanghafte Kreisen um „mich und meine Geschichten“.
Was bleibt, ist ein Zustand von Klarheit und Verbundenheit. Daraus kann dann Handlung entstehen, die nicht vom kleinen Ego gesteuert ist, sondern eher einem größeren Ganzen entspringt. Man könnte fast sagen: Das Gehirn eines Yogi ist anders verkabelt, sodass er spontan, intuitiv und ohne innere Selbstsabotage handeln kann. Zwar stehen wir wissenschaftlich erst am Anfang, solche Zustände wirklich zu verstehen, doch erste Studien zeigen ein höheres Maß an Gelassenheit, Empathie und Objektivität bei erfahrenen Meditierenden – genau jene Eigenschaften, die man einem erleuchteten Yogi zuschreibt.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-7
In der Meditation üben
Stell dir vor, du setzt dich wie gewohnt hin. Atem fließt, Körper wird still. Und dann ruf dir diesen Vers ins Gedächtnis: „Handlungen des Yogi sind weder schwarz noch weiß.“
Was heißt das für dich im Sitzen?
- Die Beobachter-Übung:
Lass Gedanken auftauchen, so wie sie wollen: „Das war gestern aber blöd, was ich gesagt habe.“ Oder: „Gut, dass ich endlich Yoga unterrichte, wie wertvoll!“
Normalerweise würdest du diese Gedanken sofort als „falsch“ oder „richtig“, „peinlich“ oder „erfolgreich“ einordnen.
Stattdessen machst du genau das Gegenteil: Du schaust zu, ohne Farbe zu vergeben. Ein Gedanke ist einfach da. Punkt. Kein Etikett.
Nach einer Weile merkst du: Diese neutrale Haltung fühlt sich wie eine Entlastung an. Kein Gericht, kein Urteil – nur Wellen, die kommen und gehen. - Die „Farben-waschen“-Technik:
Stell dir jede Handlung, die dir einfällt, wie ein Kleidungsstück vor: Manche sind „weiß“ (gute Taten), andere „schwarz“ (Fehltritte). Im Geist legst du sie in einen Fluss. Beobachte, wie das Wasser sie auswäscht, bis sie farblos werden. Das Bild kann absurd wirken – eine schwarze Socke, die blasser wird – aber es macht dir sinnlich erfahrbar: Der Yogi sieht Taten nicht als Etikettenstapel, sondern als Bewegungen des Lebens. - Gefühl von Weite kultivieren:
Geh tiefer und spüre: Wer urteilt da überhaupt? Wenn du in der Stille sitzt, erkennst du, dass „Gut“ und „Schlecht“ aus deinem Denken stammen. Dein inneres Gewahrsein selbst ist farblos. Genau da berührt dich die Sutra – als Erfahrung von Unbeflecktheit, nicht als Theorie.
Im Alltag üben
Meditation ist die Probe. Der Alltag ist die Aufführung. Hier ein paar Bühnenbilder:
- Stau auf der Autobahn:
Normalerweise: „Mist, jetzt komme ich zu spät, der Tag ist gelaufen!“
Übung: Erkenne den Impuls, schwarz einzufärben. Atme. Sag dir: „Weder schwarz noch weiß – einfach ein Auto, das steht.“ Vielleicht nutzt du die Zeit für Atembeobachtung oder ein inneres Mantra. Plötzlich ist der Stau nicht mehr Fluch, sondern neutrales Feld. - Lob im Job:
Jemand sagt: „Tolle Arbeit!“ – und dein Ego möchte sofort einen Purzelbaum schlagen.
Übung: Nimm das Lob an, aber lass es innerlich nicht festkleben. Stell dir vor, es zieht durch dich hindurch wie Wind durch offene Fenster. Du freust dich, klar. Aber du bleibst nicht süchtig nach der Farbe „weiß“. - Konflikt mit Partner oder Freundin:
Sie wirft dir etwas vor. Dein Reflex: „Ungerecht!“, und zack – die Tat ist schwarz markiert.
Übung: Stopp. Atme. Erinnere dich: „Für den Yogi ist die Handlung farblos.“ Schau also die Situation nüchterner an: Da ist ein Mensch, der gerade leidet, und Worte, die aus diesem Leiden kommen. Nicht mehr, nicht weniger. Aus dieser Haltung reagierst du klarer – nicht weichgespült, aber freier von Drama. - Selbstlob und Selbstkritik:
Vielleicht bist du nach einer Yogastunde stolz: „Das habe ich gut gemacht.“ Oder du beißt dir innerlich auf die Zunge: „Das war heute schwach.“
Übung: Nimm beides wie Wolken am Himmel. Weiß, schwarz – es spielt keine Rolle. Frag dich: Was ist jetzt wirklich zu tun? Vielleicht Tee trinken, vielleicht nachbereiten, vielleicht einfach ruhen. Diese Frage bringt dich ins Hier, jenseits der Farbpalette.
Generelle Übung: Nimm diese Woche alles um dich herum wahr, ohne zu urteilen. Bleibe innerlich gleichgültig gegenüber Dingen, die gut laufen, und jenen, die nicht gut laufen. Versuche auch zu handeln, ohne auf ein Ergebnis aus zu sein.
Wie sich das anfühlt
Es ist nicht, dass du plötzlich farblos wie ein Roboter durch die Welt stolperst. Im Gegenteil: Du bleibst Mensch, du freust dich, du ärgerst dich – aber du übst, nicht alles auf dein Konto „Gut“ oder „Schlecht“ zu buchen. Das gibt innerlich mehr Spielraum.
Und manchmal kommt sogar Humor dazu: Du erwischst dich, wie du eine Kleinigkeit sofort schwarz anmalst – und dann lachst du darüber. Genau dieses Lachen ist schon eine Spur Yogini- oder Yogi-Weisheit.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

„Wie färbst du deine Handlung?“ – Mini-Selbsttest
Den Test hier öffnen
Wähle bei jeder Alltagsszene deine spontane Einordnung: schwarz (negativ), weiß (positiv) oder gemischt. Danach siehst du deine Tendenz – plus kurze Hinweise, wie eine weder schwarz noch weiß-Haltung aussehen kann.
Dein Ergebnis
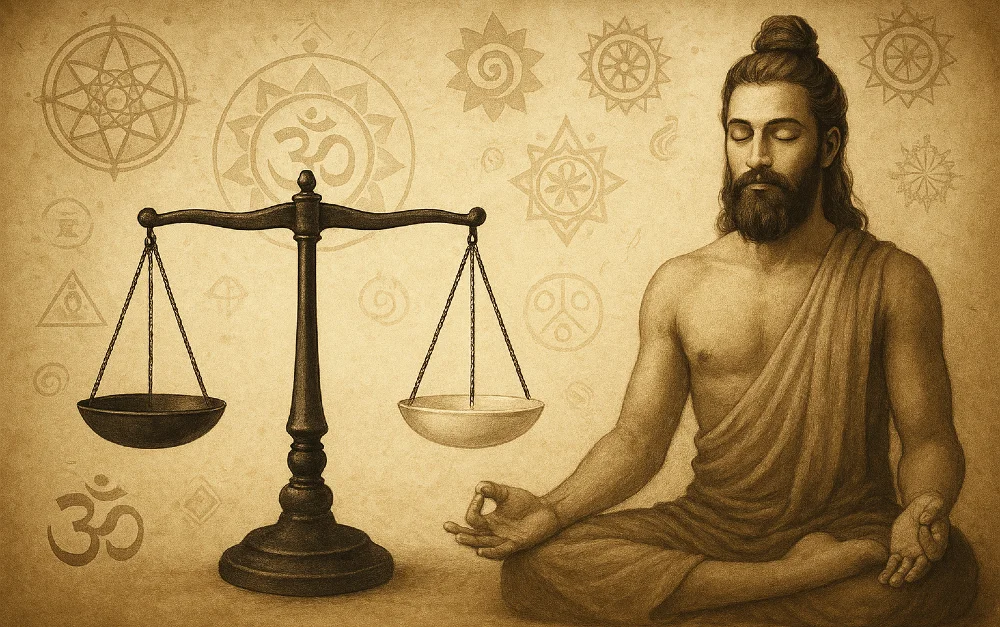
Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.7 – und Shankaras Erläuterung
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Schauen wir uns nun den Kommentar von Vyāsa näher an. Er kommentiert das Yogasūtra 4.7 mit einer klaren Unterscheidung der Arten von Handlungen (karma) und ihrer „Färbungen“. Shankara, der große Advaita-Philosoph, fügt in seinem Subkommentar weitere Präzisierungen hinzu. Die folgenden Gedanken stammen ursprünglich aus einer englischen Übersetzung und sind hier freier, erläuternder formuliert – damit sie verständlicher werden und im Alltag gefühlt werden können.
Vier Kategorien von Handlungen
Vyāsa spricht von vier „Orten“ oder Klassen von Handlungen:
- Das Schwarze
→ die Handlungen der „Bösen“. Gemeint sind Taten, die aus Unwissenheit oder bewusstem Schädigen heraus entstehen. Sie hinterlassen schweres, dunkles Karma. - Das Schwarz-Weiße (gemischt)
→ entsteht, wenn jemand anderen sowohl Schmerzen zufügt als auch Freundlichkeit zeigt. Es ist die typische Mischform des Alltags: Wir spenden vielleicht Geld, erwarten aber gleichzeitig Dank. Wir helfen jemandem, ärgern uns aber innerlich über die Mühe. Dieses Karma wächst durch äußere Mittel – es hängt also stark davon ab, wie wir mit anderen umgehen. - Das Weiße
→ gehört zu Menschen, die sich dem Studium, der Meditation, der inneren Läuterung widmen. Dieses Karma entsteht allein durch den Geist – es braucht keine äußere Bestätigung, keinen Applaus, keine Opfer anderer. Weißes Karma baut sich auf durch Klarheit, Sammlung und bewusste Schulung. - Das weder Weiße noch Schwarze
→ dies existiert nur bei denen, die völlig entsagt haben (sannyāsīs). Gemeint sind Menschen, deren Leiden (kleśas) zerstört sind und deren aktueller Körper der letzte sein wird, bevor sie endgültig frei werden. Hier erlischt die karmische Färbung vollständig.
Das Karma des Yogī
Vyāsa erklärt:
- Beim Yogī ist das Karma nicht weiß, weil er auf die Frucht seiner Handlungen verzichtet. Er handelt also nicht mit dem Ziel, etwas Bestimmtes zu erreichen oder Belohnungen zu ernten.
- Es ist auch nicht schwarz, weil er keine destruktiven Handlungen ausführt.
- Sein Karma bleibt somit „weder weiß noch schwarz“ – es entzieht sich der üblichen moralischen Farbpalette.
Die übrigen Menschen jedoch – wir alle, die noch nicht völlig frei sind – bewegen uns in den drei erstgenannten Klassen: schwarz, weiß-schwarz, weiß.
Shankaras Ergänzung
Über das Leben von Shankara
Śaṅkara – Leben, Werk und Bedeutung für die Yogaphilosophie
Śaṅkara (auch bekannt als Śaṅkarācārya oder Shankara), geboren im 8. Jahrhundert in Südindien (788–820), ist einer der bekanntesten Philosophen und spirituellen Lehrer des Advaita Vedānta. Sein Leben gleicht einem Wanderweg zwischen Legende und Geschichte – mit spirituellem Tiefgang, intellektuellem Feuer und einer Prise mystischer Überhöhung. Doch unabhängig von den genauen Daten und Wundergeschichten bleibt: Seine Ideen wirken bis heute. Auch im Yoga.
🧘♂️ Wer war Śaṅkara?
Śaṅkara wurde vermutlich in Kaladi, im heutigen Kerala, geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich – hochintelligent, fragend, neugierig auf das Wesentliche. Früh verließ er seine Familie, um Sannyāsin zu werden – also Wandermönch, asketisch, radikal dem Geistigen zugewandt. Ein radikaler Schritt, selbst nach damaligen Maßstäben.
Er reiste quer durch Indien, diskutierte mit Vertretern anderer Schulen (oft wortgewaltig und nicht selten siegreich), gründete Klöster und prägte eine ganze philosophische Bewegung. Sein Ziel: Das Wissen um die Einheit allen Seins wieder in den Mittelpunkt zu rücken – jenseits von Ritualismus, Jenseitsversprechen und dogmatischer Spaltung.
📚 Was hat er geschrieben? Und warum ist das wichtig?
Śaṅkara war kein Vielschreiber im modernen Sinn, aber seine Werke haben Wucht. Besonders wichtig:
- 🔹 Brahmasūtra-Bhāṣya
Sein wohl berühmtestes Werk: ein Kommentar zu den Brahmasūtras, dem philosophischen Herzstück des Vedānta. Hier entfaltet er die Kernaussage des Advaita Vedānta: Alles ist eins. Brahman ist das einzig Wirkliche. Die Welt der Formen ist letztlich Illusion (Māyā). - 🔹 Upaniṣad-Kommentare
Śaṅkara kommentierte auch zentrale Upaniṣaden – jene Texte, die die tiefsten Fragen des Selbst, der Wirklichkeit und der Befreiung behandeln. Seine Lesart macht klar: Yoga ist nicht nur Praxis, sondern Erkenntnisweg. Nicht das Tun allein befreit, sondern das Verstehen. - 🔹 Bhagavadgītā-Bhāṣya
Auch hier interpretiert Śaṅkara das Geschehen nicht als moralisches Lehrstück, sondern als spirituellen Weckruf: Handle, aber erkenne, dass du nicht der Handelnde bist. Karma-Yoga, Jñāna-Yoga, Bhakti – für ihn keine Gegensätze, sondern Stufen der Reife.
Shankaras Doppelrolle – Berühmt als Advaita-Vedanta-Philosoph, kommentierte er hier einen Yoga-Text – und brachte so zwei Philosophieströmungen miteinander ins Gespräch.
🧠 Was sagt Śaṅkara, das heute noch trägt?
Für Menschen, die sich mit Yogaphilosophie beschäftigen – und nicht nur schwitzen, sondern auch verstehen wollen – ist Śaṅkara Gold wert. Seine Lehren laden ein, hinter die Oberfläche zu schauen. Meditation? Ja, aber nicht als Methode zur Beruhigung, sondern zur Erkenntnis der wahren Natur.
Er sagt: Du bist nicht dein Körper, deine Gedanken oder dein Yoga-Fortschritt. Du bist Brahman. Schon immer. Nur vergessen.
🔍 Was bedeutet das für dich?
- Wenn du meditierst, denk daran: Du musst nicht irgendwohin kommen. Du bist schon da.
- Wenn du philosophierst, lass dich nicht verwirren von intellektueller Gymnastik. Suche das Einfache im Komplexen.
- Wenn du zweifelst, erinnere dich: Erkenntnis ist kein fernes Ziel, sondern etwas, das du jederzeit berühren kannst – still, wach, jenseits der Worte.
Shankara betont in seinem Subkommentar, dass das Vehikel der Handlung (karmāśraya) bei „den anderen“ existiert – nicht beim vollkommenen Yogi.
- Das ist schwer zu fassen. Vielleicht hilft ein weiteres Bild: Für die meisten von uns ist Karma wie ein Fahrzeug, das wir ständig antreiben. Jede Tat ist ein Tropfen Benzin, der das Gefährt weiter rollen lässt.
- Beim Yogi dagegen kommt das Gefährt zum Stillstand. Es fährt nicht mehr. Er „tut“ zwar noch, aber ohne jene unterschwellige Antriebskraft, die neues Karma erschafft.
Ja – Vyāsa und Shankara beschreiben hier das Ideal, nicht den Alltag eines gestressten Yogalehrers oder einer Kursteilnehmerin. Doch es lohnt, die Perspektive herunterzubrechen:
- Schwarz: Du wirst wütend, schreist jemanden an. Spürbar, nicht theoretisch: dein Brustkorb zieht sich zusammen, dein Atem stockt.
- Weiß-schwarz: Du hilfst einer Kollegin, denkst aber gleichzeitig „Hoffentlich erinnert sie sich daran, wenn ich mal was brauche.“
- Weiß: Du setzt dich still zur Meditation. Außen niemand, der applaudiert, innen kein Kalkül. Nur üben.
- Weder-noch: Ein seltener Moment: Du tust etwas ganz spontan, ohne Berechnung, ohne Stolz. Vielleicht lächelst du einfach jemanden an – und vergisst es sofort wieder. Keine Spur bleibt.
Diese vier Ebenen kannst du beobachten. Nicht, um dich kleinzumachen, sondern um zu verstehen, wo du gerade stehst. Genau darin liegt der praktische Wert von Vyāsas Worten: Nicht als abstrakte Metaphysik, sondern als Spiegel im Alltag. Verbunden mit den Fragen: Woraus handeln wir? Mit welcher Erwartung?
Vielleicht entdeckst du, dass selbst in deinem Alltag kleine „weder schwarz noch weiß“-Momente auftauchen. Sie fühlen sich leicht an, frei, unverkrampft. Und genau da kannst du die Wahrheit von Yogasūtra 4.7 am eigenen Leben erfahren.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra II-12: Die Kleshas sind [somit] die Wurzel für das gespeicherte Karma. Es wird im sichtbaren [gegenwärtigen] oder in nicht sichtbaren [zukünftigen Leben] erfahren werden.
Yoga Sutra II-13: Solange die Wurzeln [der Kleshas, der leidbringenden Hindernisse] verbleiben, muss es [das Karma] erfüllt werden, und erschafft die allgemeine Lebenssituation, die Lebensspanne und das Maß an freudvollen Erfahrungen in unserem Leben
Yoga Sutra II-14: Die Ernte aus dem Karma ist entweder freudvoll oder schmerzhaft, je nachdem, ob die zugrunde liegende Tat heilsam oder leidbringend war.
Yoga Sutra II-15: Für jemanden mit Unterscheidungsfähigkeit ist alles in dieser Welt leidvoll; das liegt an der Vergänglichkeit, unserem Verlangen, den unbewussten Prägungen (Samskaras) und an der Wechselhaftigkeit der Grundeigenschaften der Natur (Gunas)
Yoga Sutra IV-4: Die Bewegungen des Geistes entstehen aufgrund des Ichgefühls

Fazit: Inspiration für die eigene Praxis
Yoga-Sutra 4.7 mag alt und knapp formuliert sein, doch seine Botschaft ist zeitlos: Befreie dein Handeln von Egoismus und Anhaftung. So lautet jedenfalls die häufigste Interpretation dieser Sutra.
Für uns Yoga-Praktizierende kann das eine tägliche Übung sein. Im Alltag bedeutet es, bewusst Gutes zu tun, ohne direkt Lob oder Vorteile zu erwarten, und Schwieriges anzunehmen, ohne ins Selbstmitleid zu fallen. Wenn wir üben, unsere Taten nicht ständig als Gewinn oder Verlust zu verbuchen, entsteht ein neues Gefühl von Freiheit. Man spürt eine gewisse Leichtigkeit: Dinge dürfen geschehen, und man selbst tut das Richtige – einfach weil es richtig ist, nicht weil man etwas dafür zurückhaben muss. Diese Haltung lässt sich kultivieren, etwa durch Karma-Yoga (selbstloses Dienen) oder achtsames Reflektieren der eigenen Motive.
Am Ende zeichnet Patanjali ein Ideal, das durchaus radikal ist: Ein Mensch, der in völliger Gleichmut lebt, unberührt von den Verlockungen und Schrecken der Welt, so wie der Lotus unberührt vom Schmutz des Teiches bleibt. Dieser Zustand ist nicht naiv oder gefühlskalt – im Gegenteil, er geht einher mit tiefer Weisheit und Mitgefühl. „Was ist Handlung, was ist Nichthandlung? Selbst Weise sind da verwirrt,“ sagt Krishna in der Bhagavad Gītā, nur um dann zu lehren, dass wirkliches Verständnis dieser Frage einen Menschen vom Übel des Lebensrades befreit.
Yoga-Sutra 4.7 gibt uns genau diesen Denkanstoß: Handle voll und ganz, aber haftet nicht daran. So gesehen, ist es eine Einladung, im eigenen Leben Schritt für Schritt mehr Praxisnähe zu wagen: etwa im nächsten Konflikt innezuhalten und nicht impulsiv „schwarz-weiß“ zu reagieren, sondern neutral und aufmerksam das Richtige zu tun – auch wenn das Ego knurrt. Je mehr es gelingt, umso mehr nähern wir uns dem idealen Yogi-Zustand an, in dem Handeln und Nicht-Handeln auf wunderbare Weise zusammenfallen.
Es ist ein Weg der Erfahrung:
Jeder kleine Moment, in dem wir erwartungslos das annehmen, was ist, bringt uns der inneren Freiheit näher, die Patanjali uns in Aussicht stellt.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-7
Wünsche und Karma – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 7-11
Länge: 16 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Was ist Nishkama Karma? – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.7
Länge: 10 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Freiheit von allem vergangenem Karma: Asha Nayaswami (Class 64) zu Sutra 4.7 bis 4.11
Länge: 76 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


