Nirmâna-chittâny asmitâ-mâtrât
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्
Wieder eine Sutra über die Auswirkungen der Ego-Verhaftung. Indirekt auch eine Sutra über die Verkennung von Purusha, unserem Wahren Selbst. Wer glaubt, das eigene Ich sei ein fester Kern, der unverrückbar durch alle Lebenslagen trägt, bekommt von Yogasutra 4.4 einen leisen, aber spürbaren Klaps auf die Schulter – und den Hinweis: „Schau genauer hin.“
Kurz zusammengefasst
- Yogasutra 4.4 – Der Satz „Die Bewegungen des Geistes entstehen aufgrund des Ichgefühls“ beschreibt, dass alle geistigen Aktivitäten aus dem Ichgefühl (Asmita) entspringen.
- Klassische Kommentare – Vyasa und Shankara deuten die Sutra als Erklärung, wie aus einem zentralen Ich-Gefühl viele „Geistfelder“ oder Rollen entstehen – bis hin zu den legendären Fähigkeiten, mehrere Körper mit eigenen Geistern zu erschaffen.
- Philosophische Tiefe – In der Samkhya-Philosophie ist Ahamkāra das Prinzip, das das individuelle Selbst konstruiert; alle Gedanken, Erinnerungen und Wahrnehmungen kreisen um dieses Zentrum.
- Moderne Wissenschaft – Neurowissenschaftliche Forschung (u. a. zum Default Mode Network) zeigt Parallelen: Selbstbezogenes Denken hat messbare neuronale Grundlagen, die sich durch Meditation verändern lassen.
- Psychologie – Modelle wie das „Selbstmodell“ von Thomas Metzinger oder Kahnemans System-1/-2-Denken beschreiben, wie das Ich Geschichten über sich selbst konstruiert.
- Praxis – Meditation und Alltag bieten konkrete Möglichkeiten, das Ichgefühl zu beobachten, zu hinterfragen und phasenweise loszulassen, um mehr innere Ruhe und Freiheit zu erfahren.
- Alltagsübertragung – Jede Rolle im Leben – ob beruflich, privat oder spirituell – ist wie ein „projizierter Geist“ aus demselben Ichkern, mit eigenen Werkzeugen und Verhaltensweisen.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Nirmana, nirmâna = geschaffen; künstlich; erschaffen; erzeugen; entstehen; Bildung; Schöpfung; eine Manifestation oder Emanation; Transformation; Kreierung; Erneuerung; schaffen; machen; formen; bereitstellen;
- Chittani, chittâni, chitta, cittani = Mentalkörper; das Wandelbare des Menschen; Geist; Verstand; Bewusstsein(e); Wahrnehmungsraum; Geistesfelder; aus dem Einfluss des Geistes; hier im Plural;
- Asmita, asmitâ, asmitāḥ = Ego-Sinn; Ichsein; Egoismus; Individualität; Identifikation mit dem Wandelbaren; Ich-Bewusstsein; Einheitszustand; Ich-Gefühl;
- Matrat, mâtrât = allein; allein daraus; das Ganze oder die Gesamtheit einer bestimmten Entität; die eine Sache und nicht mehr; nichts als, nur so; Begrenzung;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Patanjali behauptet in dieser Sutra, dass alle geistigen Aktivitäten – ob Gedanken, Vorstellungen oder sogar ganze „Teil-Persönlichkeiten“ – ihren Ursprung im Ich-Gefühl haben. Dieses Ich-Gefühl, im Yoga auch Asmita genannt, ist das Erleben eines eigenen Ich, das hinter unseren Wahrnehmungen und Handlungen steht.

Schlüsselbegriffe von Yogasutra 4.4
Yogasutra 4.4 lautet sinngemäß: „Die Bewegungen des Geistes entstehen aufgrund des Ichgefühls.“ In Sanskrit steht hier: nirmāṇacittāni asmitāmātrāt, was wörtlich bedeutet: „Geschaffene Denkmäler (Geiste) [entstehen] allein aus Egoismus (Ich-Bewusstsein)“.
In dieser Sutra geht es also um Chitta, unseren Verstand, unser Denken und die damit einhergehenden Probleme bzw. Fehlhandlungen und -gedanken.
Chitta
Chitta bzw. citta steht für das Denken, die Gedanken, den Geist, den Intellekt und die Vernunft. In der yogischen Philosophie wird der Begriff nicht ganz einheitlich verstanden. In vedantischen Schriften meint es eher einen Bestandteil des Geistes (z. B. den für Erinnerung oder die unterbewussten Geistestätigkeiten). Im Yogasutra und in der Sankhya-Philosophie meint Chitta jedoch den gesamten Geist (Verstand, Gemüt, Denken, Unterbewusstsein). Alle mentalen Zustände.
Unter „Bewegungen des Geistes“ versteht man die Aktivitäten und Zustände des Geistes, also das gesamte „Geistfeld“ oder Bewusstseinsfeld. Dazu gehören Gedanken, Wahrnehmungen, Erinnerungen und mentale Bilder. Patanjali spricht an anderer Stelle von Chitta-Vritti, den Fluktuationen oder Wellen im Geist. In Yogasutra 1.2 definiert er Yoga bekanntlich als das Zur-Ruhe-Bringen ebendieser mentalen Bewegungen (Yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ):
Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im Geist
Hier in Sutra 4.4 taucht nun der Begriff nirmāṇa-chitta auf – erschaffene Geister oder konstruierte Geistesinhalte. Das legt nahe, dass hier künstlich erschaffene mentale Identitäten oder separate „Geistfelder“ gemeint sind, die vom Ich erzeugt werden. Anders ausgedrückt: alle möglichen geistigen Gebilde und Aktivitäten – seien es persönliche Identitäten, Gedankenströme oder innere Dialoge – sind Konstruktionen, die vom Ichgefühl ausgehen.
Für Patanjali und die Yogaphilosophie ist es selbstverständlich, dass wir nicht unser Verstand oder dessen Gedanken sind, sondern dass dieser nur ein Objekt der Natur ist. Dahinter steht unser unveränderlicher Wesenskern, unser unwandelbares Selbst - Purusha. Unbewegter Beobachter unseres Handelns. Ziel des Yogapfades ist es, diesen Purusha immer mehr wahrzunehmen, zum Vorschein zu bringen, ihn dauerhaft in unserem Leben zu manifestieren. Und damit "Freiheit" zu erreichen.
Worin liegt nun das Problem? In Sutra II-3:
Yoga Sutra II-3: Unwissenheit, Identifikation mit dem Ego, Begierde, Abneigung und (Todes-)Furcht sind die fünf leidbringenden Zustände (Kleshas)
hat Patanjali asmita - das Ich-Gefühl, das Ego - als eine der fünf Hindernisse des Samadhi gebrandmarkt.
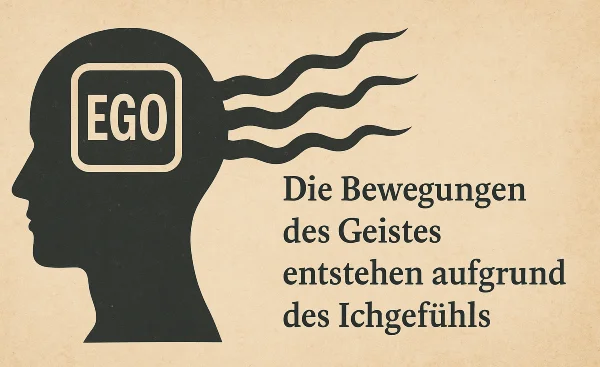
Asmita - das Ego-Gefühl
Asmita bedeutet wörtlich “'Ich-bin-heit” ( asmi auf Sanskrit: 'ich bin'). Gemeint ist das Ego-Gefühl eines Menschen. Der Sinn für ein eigenes Ich.
Was verstehen wir im Yoga unter “Ego”? Gemeint ist die Vorstellung, die ein Mensch von sich selbst hat. Seine (unterbewusste!) Antwort auf die Frage: “Wer bin ich?”.
Asmita ist dann seine innere Identifikation mit seinen Eigenschaften, Gedanken, Gefühlen und seinem Körper. Patanjali zählt Asmita zu den fünf Kleshas (leidbringenden Ursachen): Nach Unwissenheit (Avidya) entsteht das Gefühl des Getrenntseins, des Ich-bin.
Dieses Ego-Gefühl wiederum ist die Grundlage für weitere Verstrickungen: Aus dem Ichbewusstsein entwickeln sich Zuneigungen (Raga), Abneigungen (Dvesha) und schließlich die Angst vor Vergänglichkeit (Abhinivesha).

Kommentare und Deutungen
Wie ist das zu verstehen, dass Chitta von Asmita geschaffen werden?
Einerseits kann man es so verstehen, dass wir durch die Ego-Identifikation (Asmita) auch gleich die Illusion eines individuellen Geistes erzeugen. Weg vom reinen “Ich bin” hin zu “Ich bin dies und das und jenes”.
Warum ist Asmita problematisch?
Asmita ist ein Teil der Unwissenheit, der Menschen gemäß der Yogaphilosophie auf den Leim gehen und was zu mehreren Problemen führt.
Zum einen Leid: Durch das Empfinden, ein Ego, eine individuelle, einzeln darstehende Persönlichkeit zu sein geht eine (laut Yogaphilosophie nicht-realen) Getrenntheit von anderen Wesen und dem Universum einher. Darunter leiden wir und fühlen uns genötigt, dieses Ego zu schützen, zu trainieren und zu verteidigen.
Zum anderen hält uns Asmita im Gefängnis der beschränkten dualen Weltsicht fest und verhindert spirituellen Fortschritt in Richtung Kaivalya – der großen Freiheit, dem Ziel des Yoga. Rainbowbody: „Der Geist wird durch die Begrenzung, die durch asmita-klesha (den egoischen Geist) auferlegt wird, an materielle Formen als seine eigenen Fabrikationen und Projektionen (nirmana-cittani) gebunden.” Daraus resultiere „… die falsche Annahme, dass nur grobe Formationen (nirmana) existieren [die das Subtile und Kausale verdecken (avarana)].“
Und noch ein Problem: „Aus dem begrenzten Ich-Sinn wird ein begrenzter Zustand des Geistes (citta-vrtti) fabriziert.” Dieser führe dann zu all den Problemen, Unwissenheiten und Leiden des Menschen/der Wesen.
Asmita bedeutet also das Identifizieren des Selbst mit etwas, das man nicht ist. In Patanjalis Definition:
Yoga Sutra II-6: ›Identifikation mit dem Ego‹ [= Asmita] basiert auf Identifikation des Sehenden mit dem Instrument des Sehens
... liegt der Fehler von Asmita darin, dass man das Sehende (das reine Bewusstsein, Purusha) mit dem Instrument des Sehens (dem Geist bzw. Intellekt, Buddhi) gleichsetzt. Diese Grundeinstellung „Ich bin dies und das“ färbt jede Erfahrung ein – oft unbewusst. Jede geistige Regung wird vom Ego eingefärbt und angetrieben, so die Aussage der Sutra. Man kann es auch moderner ausdrücken: Unser Gehirn produziert ein Selbstgefühl, und dieses Ich im Kopf ist der Regisseur hinter all den mentalen Aufführungen unseres Lebens.
Ist das Ego-Gefühl völlig nutzlos?
Ist Asmita grundsätzlich schlecht? Diese Aussage wäre nicht im Sinne des Yoga. So ist die Identifikation mit dem Ego hilfreich dabei, sich als Individuum weiterzuentwickeln. Motiviert zum Üben. Nur wird auf diesem Weg Asmita halt irgendwann zum Hindernis ...
Wie kommt es überhaupt dazu, dass Asmita entsteht?
Dazu Wim van den Dungen: „Letzterer [der Seher, Purusha] ist es, der die Individuation ermöglicht, nicht die Natur, das Gesehene. Der Seher [Purusha] ist, wie Sâmkhya [Yogaphilosophie] dies nennt, ein „Ich-Macher“ („ahamkâra“). Der Wille zur Emanzipation ist also im Seher verwurzelt, nicht im Gesehenen oder dem Urwillen der Natur.”
Wie werde ich dieser inneren Vorgänge gewahr?
Man kann ganze Bibliotheken über das Ego und die daraus resultierenden Probleme lesen, ohne dass man dessen Natur bei sich erkennt. Es hilft nichts: wir müssen selber in uns forschen, um wirklich zu verstehen, was Ego ist, was es vom wahren Selbst unterscheidet, wie es entsteht und auf welchen Wegen es zu Problemen führt. Der Yoga gibt uns die notwendigen Mittel (Konzentration, Achtsamkeit, Meditation …), aber anwenden und wirklich hinschauen müssen wir selbst. Das kann ernüchternd und anstrengend sein, darum machen es vermutlich nur so wenige …

Weitere klassische Kommentare: Vom Yogi mit den vielen Geistern
Die alten Kommentatoren des Yogasutra haben Sutra 4.4 teils wortwörtlich und äußerst fantasievoll interpretiert.
Desikachar übersetzt hier:
“Ein Mensch, der außergewöhnliche Fähigkeiten in seinem Geist entwickelt hat, kann eine Veränderung im Geist anderer Menschen bewirken.”
Der “leitende Geist” (nayaka citta) sei dabei der Geisteszustand eines weit entwickelten Menschen, der Einfluss auf den Geist anderer Menschen nehmen kann.
Coster:
„Wer die Siddhis beherrscht, besitzt die Fähigkeit, sich zu gleicher Zeit in verschiedenen Körpern zu offenbaren.“
Eine mögliche Erklärung für diese Fähigkeiten lautet: Ein vollkommener Yogi kann so fortgeschritten sein, dass er mehrere Körper gleichzeitig manifestiert – und natürlich braucht jeder dieser Körper einen eigenen Geist. Woher stammen nun all diese zusätzlichen „Geister“? Patanjali beantwortet es mit Sutra 4.4: Sie entspringen alle dem einen Ego des Yogi! Der Yoga-Bhashya (der grundlegende Kommentar, traditionell Vyasa zugeschrieben) beschreibt diese Situation ausführlich: „Wenn der Yogi viele Körper erschafft – haben diese Körper viele Geister oder nur einen gemeinsamen Geist?“ fragt Vyasa. Die Antwort: „Die geschaffenen Geister gehen allein aus dem Egoismus hervor“, d.h. der Yogi nimmt sein eigenes Ich-Prinzip als Ursache und sendet daraus für jeden Körper einen eigenen Geist aus. Bildhaft gesprochen verbreitet ein einziges Bewusstsein Funken in mehrere Flammen. Mehr zu Vyasa wie immer unten.
Der mittelalterliche Gelehrte König Bhoja illustriert dies im Rāja-mārtaṇḍa-Kommentar mit einer eindringlichen Metapher: So wie ein Feuer Funken versprüht, die sofort zu eigenständigen kleinen Flämmchen werden, so kann das zentrale Ego des Yogi Geistesfunken aussenden, die die zusätzlichen Körper beleben. Diese Fähigkeit, viele Körper gleichzeitig zu bewohnen, nennt man laut Kommentar Kāya-vyūha-Yoga. Im Klartext: Ein erleuchteter Meister könnte durch seinen Willen sein Ich vervielfältigen. Das klingt heute nach Fantasy oder Comic – mehrere Körper, die alle vom gleichen Ego gesteuert sind, wie Klone mit einem gemeinsamen Geist. Tatsächlich halten es die klassischen Interpreten für eine logische Konsequenz yogischer Meisterschaft. Sie argumentieren sogar, dass es anders gar nicht funktionieren könnte: Würde jeder geschaffene Körper denselben einen Geist teilen, gäbe es Chaos – jeder Körper hätte eigene Begierden und Ziele, sie wären uneins. Also braucht jeder Körper einen separaten Geist, der jedoch aus dem einer zentralen Instanz entspringt, ähnlich wie eine Lampe, die mehrere Räume zugleich erleuchtet.
Diese klassische Auslegung mag uns Heutige schmunzeln lassen, doch sie offenbart die tiefe Überzeugung der alten Yogis in die Macht des Geistes. Sutra 4.4 wird hier als Beschreibung einer Siddhi (einer übernatürlichen Fähigkeit) gelesen: der Yogi kann seinen Geist vervielfachen. Wichtig ist dabei, dass all diese „Geistfelder“ letztlich von einem Kern-Ich erzeugt und beherrscht werden. Im nächsten Sutra (4.5) betont Patanjali nämlich: Trotz vielfältiger Aktivitäten bleibt ein Geist der Antrieb für die vielen – das Eine dirigiert die Vielen. Die Klassiker erklären dazu, der Yogi installiere ein „Haupt-Geistfeld“ als dirigierendes Zentrum, damit die vielen geschaffenen Geister harmonisch seinem Willen folgen. Man spürt: Hier denken die Kommentatoren in Kategorien der Samkhya-Philosophie, wo ein Mahat (Großes Prinzip) viele Ausformungen hervorbringen kann.

Philosophische Bedeutung: Das Ego als Urheber aller Gedanken
Abseits solcher mystischen Erzählungen lässt sich Yogasutra 4.4 auch als allgemeine Wahrheit über unser tägliches Bewusstsein lesen. In diesem Sinne sagen traditionelle Lehrer: Sämtliche Gedanken, Rollen und Persönlichkeiten in uns werden vom Ego geformt. Ein moderner Kommentator formuliert es so: „All minds that we experience normally are artificially constructed or built-up minds – and ‘we’ are their unconscious constructors. ... All these artificially constructed minds have actually evolved from our ego or the feeling of I-ness.“. (Übersetzt: Alle Gedanken, die wir normalerweise erleben, sind künstlich konstruierte oder aufgebaute Gedanken – und „wir“ sind ihre unbewussten Konstrukteure. ... All diese künstlich konstruierten Gedanken haben sich tatsächlich aus unserem Ego oder dem Gefühl des Ichs entwickelt.)
Mit anderen Worten: Das Ego sitzt im Zentrum und bläst zahllose mentale Konstrukte auf, genau wie Patanjali andeutet. Unsere Persönlichkeit ist letztlich ein Bündel von Gedankenmustern, Erinnerungen, Vorlieben – und all das gruppiert sich um das Grundgefühl „Ich bin“. Dieses Ichgefühl steht wie ein Regisseur im Scheinwerferlicht und lässt ununterbrochen neue „Szenen“ entstehen: Gedanken, Gefühle, Beziehungen, Vorlieben und Abneigungen, unsere gesamte „Lebensgeschichte“. Jede Überzeugung („ich mag dies, ich hasse das“), jede Erinnerung („mir ist dies widerfahren“), jede Planung („das will ich erreichen“) entspringt letztlich dem Ichbezug.
Die indische Philosophie untermauert diese Idee auch systematisch. In der Samkhya-Lehre, auf der Patanjali aufbaut, ist Ahamkára (das Ich-Macher-Prinzip) genau der Faktor, der aus dem universellen Intellekt (Buddhi) ein individuelles Geistwesen hervorbringt. „From Buddhi arises Ahamkara. From Ahamkara arises Manas (mind)...“ (Übersetzt: Aus Buddhi entsteht Ahamkara. Aus Ahamkara entsteht Manas (Geist) ...) heißt es in klassischen Texten. Das Ego generiert also den Verstand und die Sinne – der individuelle Geist ist ein Produkt des Ichs. Patanjalis Sutra 4.4 spiegelt diese Sicht wider: Ohne Ego kein getrennter Geist.
Spannend ist, dass hier nicht notwendigerweise von schlechtem Ego die Rede ist. In der Bhagavad Gita etwa unterscheidet Krishna zwischen dem reinen, zeugenden Selbst und dem „ichhaften“ Mindset, das sich mit Namen und Formen identifiziert – letzteres ist das Ego-Prinzip. Dieses Ego ist für das Funktionieren in der Welt nötig, aber aus yogischer Sicht auch der zentrale Illusionsfaktor, der uns von unserer wahren Natur entfremdet.
Man kann Sutra 4.4 sogar psychologisch verstehen: Jeder Mensch hat viele Gesichter, spielt verschiedene Rollen (z.B. die strenge Lehrerin, den liebevollen Elternteil, den schelmischen Freund). Diese Rollen ähneln separaten „Teil-Geistern“, doch alle entspringen einem Selbstbild. Das Ego baut ganze Persönlichkeits-Aspekte auf, je nach Kontext, während im Hintergrund dasselbe Ich-Gefühl die Fäden hält.
Moderne Yogalehrer ziehen hier gerne Parallelen zur westlichen Psychologie, etwa zum Konzept innerer Sub-Persönlichkeiten oder zur Individuation nach C.G. Jung. Asmita wäre aus dieser Sicht das Zentrum, um das sich die vielen Facetten der Psyche gruppieren. Ziel der Yoga-Praxis ist es aber, dieses Zentrum nicht mehr fälschlich für das wahre Selbst zu halten, sondern einen Schritt zurückzutreten.
Interessant ist der Gedanke eines „ursprünglichen Geistes“ hinter all den Ego-Schöpfungen. Einige Interpretationen suggerieren, wir hätten jenseits der vom Ich geformten Gedanken einen reinen, unverbauten Geist. Im zitierten modernen Kommentar heißt es: „Behind all created mind-fields, there is an original mind-field, uncreated by our Egos. We come into this world with this original, clean slate of mind. The whole effort of the Sādhaka (Übender) is to reach this clean slate.“. (Übersetzt: „Hinter allen geschaffenen Gedankenfeldern gibt es ein ursprüngliches Gedankenfeld, das nicht von unserem Ego geschaffen wurde. Wir kommen mit diesem ursprünglichen, unbeschriebenen Blatt in diese Welt. Die gesamte Anstrengung des Sādhaka (Übenden) besteht darin, dieses unbeschriebene Blatt zu erreichen.“)
Diese Sicht erinnert an das Konzept des reinen Bewusstseins oder Purusha im Yoga: tief in uns existiert ein unveränderter Beobachter, während das Ego-Schichten aufschichtet wie Zwiebelhäute um diesen Kern. Yogaübung bedeutet hier, Schicht um Schicht der Ego-Konstrukte abzutragen – alle „künstlichen“ Gedankenmuster aufzulösen – bis der ursprüngliche, stille Geist hervortritt. Patanjali unterstützt diese Interpretation direkt in Sutra 4.6, wo er sagt, der im Meditationszustand geborene Geist sei frei von Prägungen (dhyāna-jam chittaṃ anāśayam). Das heißt: Von all den möglichen „Geistesfeldern“, die Asmita schafft, ist das durch tiefe Meditation entstandene frei von Karma und Vergangenheit. Es ist gewissermaßen das unbeeinflusste Original – kein von Ego und Eindrücken geformter Abklatsch mehr.

Moderne Auslegungen und wissenschaftliche Erkenntnisse
Aus moderner Sicht könnte man einwenden, Patanjalis Aussage sei beinahe selbstverständlich. Heute weiß doch jedes Kind: Wir nehmen die Welt nicht objektiv wahr, sondern durch die Filter unseres Gehirns. Was wir „Realität“ nennen, ist unser geistiges Konstrukt. Ein Online-Kommentar bemerkte pointiert: „Die Aussage dieser Sutra ist fast trivial. Wir nehmen nicht mit den Sinnen, sondern mit dem Gehirn wahr... Unsere Wirklichkeit ist ein kultureller Konsens und Anpassung an die Umwelt.“ Der Kommentator schließt: „Das Bewusstwerden über diese Konstruktion von Wirklichkeit und die Beliebigkeit unseres Wahrnehmungsraums ist ein wesentlicher Teil der yogischen Technik.“ Weiter schlägt er augenzwinkernd vor, Sutra 4.4 könne man interpretieren als: „Durch die Schaffung von anderen Wahrnehmungsräumen relativiere ich meine eigene Sicht auf die Welt und die Bindung an mein Ich.“. Das enthält gleich zwei moderne Aspekte: Erstens die Bestätigung, dass unser Ich die persönliche Wirklichkeit erschafft (insofern erschafft das Ich die geistigen Bewegungen – im Alltag würden wir sagen, jeder lebt in seiner eigenen Welt). Und zweitens einen praktischen Tipp: Wenn wir gezielt andere Perspektiven einnehmen oder veränderte Bewusstseinszustände erfahren (etwa durch Meditation, Rückzug, vielleicht sogar bewusstseinserweiternde Erfahrungen), merken wir, wie relativ unsere gewöhnliche Ego-Welt ist. Indem man aus dem gewohnten Ego-Wahrnehmungsraum ausbricht, löst sich die enge Identifikation mit dem eigenen Ich ein Stück weit. Dieser Perspektivwechsel ist genau das, was viele yogische Übungen bewirken sollen.
Auch die Neurowissenschaft spürt diesem Phänomen nach. Spannende Studien der letzten Jahre zeigen, dass es im Gehirn Netzwerke gibt, die besonders aktiv sind, wenn wir über uns selbst nachdenken oder gedankenverloren vor uns hin sinnieren. Insbesondere das sogenannte Default-Mode-Netzwerk ( (englisch DMN ‚Standard- oder Voreinstellungsmodusnetzwerk‘ bzw. sinngemäß ‚Ruhezustandsnetzwerk‘) – ein Verbund von Hirnarealen – wird aktiv, sobald wir nicht mit einer Aufgabe beschäftigt sind und innerlich „abschweifen“. Es verarbeitet autobiografische Erinnerungen, grübelt über Vergangenheit und Zukunft und konstruiert den Sinn für eine durchgehende persönliche Geschichte. Kurz: Das DMN ist stark involviert in selbstreferenzielles Denken – es kreiert einen Ich-Bezug in den Gedanken. Interessanterweise berichten Forscher, dass bei geübten Meditierenden genau dieses Netzwerk deutlich ruhiger wird. Tiefe Achtsamkeitsmeditation führt zu einer Abnahme der DMN-Aktivität, was gleichbedeutend ist mit einem Loslassen von ichbezogenen Gedanken. Wenn der Geist ganz im Hier und Jetzt ruht, ohne ständig „mich“ und „mein“ zu referenzieren, dann verschwinden die typischen Ego-bezogenen Hirnaktivitäten – man könnte sagen, die Bewegungen des Geistes verstummen, weil das Ichgefühl an Einfluss verliert. In extremen Fällen berichten Meditierende von Ego-Auflösung: einem Zustand, in dem die Grenze zwischen Selbst und Welt verschwimmt und man nur noch als reines Bewusstsein ohne Ich-Gedanken existiert. Neurowissenschaftlich wird dieser Zustand u.a. mit einer veränderten Kommunikation zwischen dem Frontalhirn und tieferliegenden Arealen in Verbindung gebracht – vereinfacht: Das gewöhnliche Kontrollzentrum des Ichs schaltet einen Gang zurück.
Solche Befunde sind eine aufregende Brücke zwischen alter innerer Erfahrung und moderner empirischer Forschung. Patanjali hätte natürlich keine fMRI-Scanner gebraucht, um zu wissen, dass das Zur-Ruhe-Bringen des Ego-Gefühls das Bewusstsein fundamental verändert. Doch heute können wir beobachten, wie das Gehirn in Meditation quasi einen „Reset“ der Ego-Netzwerke macht – was subjektiv als Frieden, Einheit oder reines Gewahrsein erlebt wird. Auch in Therapieforschung (etwa mit Psychedelika) spricht man vom Default-Mode als dem neuronalen Korrelat des Egos, das temporär heruntergefahren werden kann, um neue Bewusstseinsinhalte zuzulassen. So berichtet eine Studie: „The total loss of one’s sense of self, sometimes referred to as ego death, has been linked to inhibition of the DMN.“. (Übersetzt: „Der vollständige Verlust des Selbstbewusstseins, manchmal auch als Egotod bezeichnet, wird mit einer Hemmung des DMN in Verbindung gebracht.“) Damit finden Patanjalis Aussagen spannende Bestätigungen: Das Ichgefühl ist tatsächlich ein identifizierbarer Prozess im Gehirn, der unsere geistigen Bewegungen erzeugt – reduzieren wir diesen Prozess, kommt der Geist zur Ruhe.
Weitere Stimmen aus Wissenschaft und Psychologie zum Thema
Judson Brewer
Ein Forscher, der im Bereich Achtsamkeit und Meditation arbeitet, zeigt, dass erfahrene Meditierende weniger Aktivität in Netzwerken des Selbstbezugs (Default Mode Network, DMN) aufweisen – das Gehirn schweift weniger ab, das Ego-Ich verstummt. Eine Studie belegt: Bei Vipassana-Meditierenden ist die Aktivität im medialen präfrontalen und posterioren cingulären Kortex reduziert, und stattdessen vernetzt sich das Gehirn besser in Arealen der Selbstkontrolle. Das ist keine esoterische Erfahrung, sondern belegte Neuroforschung.
Robin Carhart-Harris
Er erforscht, was im Gehirn passiert, wenn das Ich auseinanderfällt – etwa durch Psychedelika wie LSD. Seine Arbeit zeigt: In solchen Zuständen nimmt die Konnektivität im DMN ab – das Ego-Raumgerüst bricht ein, es kommt zur Ego‑Auflösung. Das ist nicht Fantasie, sondern fMRI-gestützte Wissenschaft.
Thomas Metzinger
Ein Philosoph, der das „Ego-Tunnel“-Modell entwickelt hat: Unser Bewusstsein ist keine offene Bühne, sondern ein engen Tunnel, den das autonome Gehirn baut – ein Simulationsraum, in dem wir ein Selbst erleben. Der „Beobachter“ ist also keine greifbare Entität, sondern eine Art Betriebsmodell des Gehirns, ein informatives Phantom.
Daniel Kahneman – System 1 vs. System 2
Kahneman teilt unsere Denkprozesse in ein rasendes System 1 (intuitiv, schnell, oft unreflektiert) und ein langsames, reflektiertes System 2. Unser Ich konstruiert ständig Geschichten – System 1 flüstert spontan, System 2 nickt meist nur nach. Das Ich ist ein Geschichtenerfinder und Zuhörer zugleich.
Antonio Damasio – Selbst als neuronale Konstruktion
Nach Damasio entsteht das Bewusstsein nicht durch Gedanken, sondern durch Gefühle. Sein Modell beschreibt, wie das Gehirn unbewusst körperliche Zustände fühlt (der sogenannte „Protoself“) – und daraus wird ein Bewusstsein mit einem Ich-Gefühl aufgebaut. Das Ich ist so gesehen ein biologisch generiertes Gefühl, kein metaphysisches Zentrum.

Praxisbezug: Zwischen Theorie und Erfahrung
All diese Erläuterungen – ob alt oder neu – laufen auf eine Kernerkenntnis hinaus: Das Gefühl eines persönlichen Ich steht hinter dem Treiben unseres Geistes. Für uns Yogapraktizierende mag das zunächst eine Theorie sein, doch die wahre Kunst liegt darin, es unmittelbar zu erfahren. In der Meditation kannst du diese Dynamik direkt beobachten: Setz dich hin, werde still, und schaue deinen Gedanken zu. Schnell bemerkst du, dass fast jeder Gedanke sich um dich dreht – deine Pläne, deine Bewertungen, was du gleich einkaufen musst, was andere von dir denken. Dieses allgegenwärtige „Ich, mich, mein“ ist das Asmita in Aktion. Manchmal wird einem fast schwindelig, wie sehr das Ego im Zentrum steht und alles an sich reißt.
Hier findet sich aber auch die Tür zur Befreiung: Wenn du erkennst, dass dein Geist ständig ein Ich konstruiert, kannst du anfangen, dich davon zu lösen. Wie fühlt es sich an, wenn die Ich-Bezogenheit kurz wegfällt? Vielleicht hattest du schon Momente völliger Vertiefung – beim Yoga, in der Natur, in kreativer Versunkenheit – wo „du“ in der Tätigkeit aufgehst. Im Nachhinein sagst du dann: „Ich habe mich selbst vergessen, es gab nur noch das Tun.“ Genau das ist gemeint. In solchen Augenblicken stoppt die permanente Ego-Erzählung im Kopf, und siehe da: Der Geist wird still, weit, offen. Viele Praktizierende berichten, dass sie sich dann wahrhaft lebendig fühlen, ja eins mit dem, was sie gerade tun.
Patanjalis Sutra 4.4 erinnert uns daran, wo wir im Yoga hinschauen sollen, nämlich an die Wurzel unseres Geistes. Anstatt einzelne Gedanken bekämpfen zu wollen, lohnt es sich zu fragen: Wer denkt eigentlich? Was ist dieses Ich-Gefühl, das da ständig waltet? Ist es wirklich das Zentrum meines Seins – oder nur eine weitere Bewegung im Geist? Die alten Meister und modernen Neurowissenschaftler sind sich verblüffend einig, dass das Ich kein unveränderliches Ding ist, sondern ein Prozess, eine Konstruktion. Und was konstruiert wurde, kann man auch dekonstruieren. Diese Erkenntnis ist nicht trocken oder theoretisch, sie ist zutiefst befreiend. Sie ermöglicht es uns, einen Schritt zurückzutreten und das Schauspiel des Geistes mit Humor und Gelassenheit zu betrachten. Ja, das Ego meldet sich wieder zu Wort – es hat schließlich einen Job zu erledigen – aber wir müssen nicht jedem seiner Regungen blind folgen.
Zumindest theoretisch, denn oftmals stellt sich diese Sichtweise in der Praxis als schwierig zu realisieren dar. Aber wir üben ja ...

Übungen zu dieser Sutra
In der Meditation – das Ego beim Werkeln ertappen
1. Setz dich hin wie immer, aber mit einem neuen Auftrag:
Nicht „Gedanken beruhigen“ oder „atmen zählen“, sondern: Jede Regung im Kopf auf ihr „Ich“ abklopfen.
Kommt ein Gedanke wie „Ich sollte stiller sitzen“ – innerlich markieren: Aha, da ist es wieder, das Ich.
Es geht nicht darum, das Ich wegzubekommen (das wäre schon wieder das Ich, das sich verbessern will), sondern wie ein Naturforscher zu beobachten: „Ah, hier wächst gerade eine Ego-Pflanze.“
2. Mini-Pause zwischen Ich und Gedanke setzen:
Wenn das Ichgefühl sich meldet – etwa als innerer Kommentar „Ich mache das gut/schlecht“ – kurz innehalten. Nicht reingrätschen, einfach merken: Da ist das „Ich-bin“-Gefühl, und drumherum werkelt der Rest.
Das fühlt sich manchmal an, als würdest du im Theater sitzen und merken: „Moment, ich bin nicht die Schauspielerin auf der Bühne, sondern der Zuschauer.“
3. Längere Stille zulassen, aber nicht erzwingen:
Manchmal zieht sich das Ichgefühl zurück, wie eine Katze, die keinen Bock mehr auf Streicheln hat. Dann wird’s still – und der Atem fühlt sich an, als gehöre er niemandem. Genieße das, ohne es zu „besitzen“.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Alternative Meditationen
- Erzeuge in dir das Gefühl, eins mit allem um dich herum zu sein. Versuche, die Grenzen deines Ich-Gefühles. dessen, was du für “Ich” hältst, immer weiter auszudehnen.
- Mache dir dein Ich-Gefühl, dein Ego bewusst. Wo und wann willst du etwas sein, etwas können, darstellen? Was hat das mit deinen Sinnen zu tun? Warum ist dieses Ich-Gefühl “falsch”? Woran und wie hindert es dich?
Im Alltag – die Ich-Lupe überallhin mitnehmen
1. Beim Reden:
Jemand erzählt dir etwas, und du merkst, wie dein Kopf sofort ein „Ich-Update“ daraus macht: „Ach, das habe ich auch erlebt“ oder „Das betrifft mich so…“.
Übung: Lass den Impuls kurz stehen. Höre weiter zu, ohne sofort deine Ich-Geschichte drüber zu legen. Überraschend, wie viel mehr vom anderen übrig bleibt, wenn dein Ego nicht gleich ins Rampenlicht hüpft.
2. In Konflikten:
Nimm den Moment wahr, wo Ärger aufsteigt – oft ist das nichts anderes als „Mein Bild von mir wird gerade angekratzt“.
Frage dich mitten im Zorn: Würde mich das stören, wenn es nicht um „mich“ ginge?
Meist schrumpft die Wut dann um ein paar Nummern. (Nicht immer. Manchmal ist sie zäh. Das ist auch ok.)
3. Beim Erfolg:
Du tust etwas gut, wirst gelobt – und schon fühlt sich das Ich wie ein Pfau.
Feiere ruhig, aber sieh auch: Da bläst sich gerade mein Ich auf.
Lächeln, innerlich den Hut ziehen, weitergehen. Keine große Sache.
4. In Routine-Momenten:
Spül das Geschirr und schau, wie oft „Ich will fertig werden“ im Kopf auftaucht.
Mach dieselbe Tätigkeit, aber lass den Satz weg. Plötzlich wird aus einem banalen Handgriff eine stille Handlung – ohne Besitzer.
Warum das funktionieren kann
Diese Art zu üben ist wie das Licht einschalten in einem Raum, in dem du sonst nur im Halbdunkeln tappst. Du entdeckst, dass fast jede Bewegung deines Geistes einen kleinen „Ich“-Kern hat, der alles an sich zieht. Und wenn du das oft genug siehst, verliert dieser Kern seinen Zaubertrick. Er bleibt da, ja – aber er muss nicht ständig den Ton angeben. Und das ist schon die halbe Freiheit, von der Patanjali spricht.
Was hilft dir am meisten, dein Ichgefühl zu beobachten?

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.4: über die „vielen Körper“ des Yogis
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyasa stellt im Kommentar zu Yogasutra 4.4 eine merkwürdige – fast schon provozierende – Frage:
„Wenn der Yogi viele Körper erschafft – haben diese Körper dann viele verschiedene Geister? Oder teilen sie sich einen einzigen? Die erschaffenen Geister entspringen allein dem Egoismus. Indem er den Geist, der im Kern nur Egoismus ist, als Ursache nimmt, erschafft er diese Geister. Von da an werden die Körper von einzelnen Gemütern bewohnt.“
Was hier wie Magie klingt, ist im Kontext der klassischen Yogaphilosophie eine ernsthafte Überlegung.
Was Vyasa wirklich meint
In der alten Kommentarliteratur beschreibt man mit „viele Körper“ nicht unbedingt Science-Fiction-Doppelgänger. Gemeint ist: Ein Meister, der durch hohe meditative Fähigkeiten (Siddhis) verschiedene Körper- oder Geistesformen „erschaffen“ kann – zum Beispiel, um an mehreren Orten gleichzeitig zu wirken.
Vyasa fragt: Brauchen diese geschaffenen Körper jeweils einen eigenen Geist, oder steuert sie ein einziger Geist?
Seine Antwort: Jeder dieser Körper bekommt ein eigenes „Geistfeld“ – doch alle stammen aus einer einzigen Quelle: dem Ichgefühl (Asmita).
Man könnte sagen: Aus einem zentralen „Ich“ gehen mehrere geistige Funken hervor, die jeweils einen Körper beleben.
Ein Bild für das Verständnis
Stell dir vor, dein Geist ist wie ein Lagerfeuer. Aus dem Feuer springen Funken – jeder Funke zündet ein eigenes kleines Feuer an. Alle diese Feuer sind „eigenständig“ – aber sie haben ihren Ursprung im selben Kernfeuer.
Für Vyasa ist dieses Kernfeuer das Ichgefühl.
Praxisnah gedacht
Auch wenn du nicht gerade „viele Körper erschaffst“ (was im Alltag vermutlich für Verwirrung sorgen würde), kennst du den Effekt vielleicht im Kleinen:
- Du spielst verschiedene Rollen: die Yogalehrerin, den Kollegen, die Freundin, die Tochter.
- Jede dieser Rollen hat ihren eigenen „Tonfall“, ihre eigene Gedankenwelt.
- Und doch entspringen alle aus deinem einen Ichgefühl.
Vyasa’s Kommentar ist also nicht nur eine Beschreibung übernatürlicher Kräfte, sondern auch eine Metapher für das, was wir alle kennen: Wir bewohnen viele Gesichter, aber hinter allen steckt derselbe Kern.
Shankars Subkommentar zu Vyasa: über die Projektion der „Geister“ aus dem Ichgefühl
Über das Leben von Shankara
Śaṅkara – Leben, Werk und Bedeutung für die Yogaphilosophie
Śaṅkara (auch bekannt als Śaṅkarācārya oder Shankara), geboren im 8. Jahrhundert in Südindien (788–820), ist einer der bekanntesten Philosophen und spirituellen Lehrer des Advaita Vedānta. Sein Leben gleicht einem Wanderweg zwischen Legende und Geschichte – mit spirituellem Tiefgang, intellektuellem Feuer und einer Prise mystischer Überhöhung. Doch unabhängig von den genauen Daten und Wundergeschichten bleibt: Seine Ideen wirken bis heute. Auch im Yoga.
🧘♂️ Wer war Śaṅkara?
Śaṅkara wurde vermutlich in Kaladi, im heutigen Kerala, geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich – hochintelligent, fragend, neugierig auf das Wesentliche. Früh verließ er seine Familie, um Sannyāsin zu werden – also Wandermönch, asketisch, radikal dem Geistigen zugewandt. Ein radikaler Schritt, selbst nach damaligen Maßstäben.
Er reiste quer durch Indien, diskutierte mit Vertretern anderer Schulen (oft wortgewaltig und nicht selten siegreich), gründete Klöster und prägte eine ganze philosophische Bewegung. Sein Ziel: Das Wissen um die Einheit allen Seins wieder in den Mittelpunkt zu rücken – jenseits von Ritualismus, Jenseitsversprechen und dogmatischer Spaltung.
📚 Was hat er geschrieben? Und warum ist das wichtig?
Śaṅkara war kein Vielschreiber im modernen Sinn, aber seine Werke haben Wucht. Besonders wichtig:
- 🔹 Brahmasūtra-Bhāṣya
Sein wohl berühmtestes Werk: ein Kommentar zu den Brahmasūtras, dem philosophischen Herzstück des Vedānta. Hier entfaltet er die Kernaussage des Advaita Vedānta: Alles ist eins. Brahman ist das einzig Wirkliche. Die Welt der Formen ist letztlich Illusion (Māyā). - 🔹 Upaniṣad-Kommentare
Śaṅkara kommentierte auch zentrale Upaniṣaden – jene Texte, die die tiefsten Fragen des Selbst, der Wirklichkeit und der Befreiung behandeln. Seine Lesart macht klar: Yoga ist nicht nur Praxis, sondern Erkenntnisweg. Nicht das Tun allein befreit, sondern das Verstehen. - 🔹 Bhagavadgītā-Bhāṣya
Auch hier interpretiert Śaṅkara das Geschehen nicht als moralisches Lehrstück, sondern als spirituellen Weckruf: Handle, aber erkenne, dass du nicht der Handelnde bist. Karma-Yoga, Jñāna-Yoga, Bhakti – für ihn keine Gegensätze, sondern Stufen der Reife.
Shankaras Doppelrolle – Berühmt als Advaita-Vedanta-Philosoph, kommentierte er hier einen Yoga-Text – und brachte so zwei Philosophieströmungen miteinander ins Gespräch.
🧠 Was sagt Śaṅkara, das heute noch trägt?
Für Menschen, die sich mit Yogaphilosophie beschäftigen – und nicht nur schwitzen, sondern auch verstehen wollen – ist Śaṅkara Gold wert. Seine Lehren laden ein, hinter die Oberfläche zu schauen. Meditation? Ja, aber nicht als Methode zur Beruhigung, sondern zur Erkenntnis der wahren Natur.
Er sagt: Du bist nicht dein Körper, deine Gedanken oder dein Yoga-Fortschritt. Du bist Brahman. Schon immer. Nur vergessen.
🔍 Was bedeutet das für dich?
- Wenn du meditierst, denk daran: Du musst nicht irgendwohin kommen. Du bist schon da.
- Wenn du philosophierst, lass dich nicht verwirren von intellektueller Gymnastik. Suche das Einfache im Komplexen.
- Wenn du zweifelst, erinnere dich: Erkenntnis ist kein fernes Ziel, sondern etwas, das du jederzeit berühren kannst – still, wach, jenseits der Worte.
Shankara, der wohl bekannteste Philosoph des Advaita Vedanta, nimmt Vyasas Kommentar zu Yogasutra 4.4 auf – und treibt ihn noch tiefer in die philosophische Feinmechanik.
Die Quelle aller „projizierten Geister“
Nach Shankara entspringen diese „Geister“ – im Originaltext sind chitta, ahaṅkāra und asmitā gemeint – aus der bloßen „Ich-bin-heit“. Das ist nicht einfach nur ein vages Selbstgefühl, sondern die lebendige Bewegung des Ichs, das ahaṅkāra genannt wird. Der Yogi greift diesen Ich-Impuls auf, und aus ihm erschafft er neue, projizierte Geister – nicht aus der „Natur“ (prakṛti) geformt, sondern vollkommen neu. Das heißt: Sie sind nicht karmisch vorbelastet und nicht von einem vorangegangenen Leben geprägt.
Shankara betont, dass das Wort „Geist“ hier nur als Beispiel dient. Genauso könnten auch Sinne aus der asmitā hervorgebracht werden. Jeder geschaffene Körper erhält also seinen eigenen Geist und eigene Sinnesorgane.
Warum das wichtig ist
Shankara argumentiert klar: Ohne Geist und Sinne ist ein Körper kaum mehr als eine Hülle – er wäre funktional wie ein Leichnam.
Und: Würden sich alle erschaffenen Körper einen einzigen Geist teilen, gäbe es keine Möglichkeit für differenzierte Tätigkeiten. Das eine Bewusstsein könnte nicht gleichzeitig die feinen, unterschiedlichen Aufgaben mehrerer Körper steuern.
Mit anderen Worten:
-
Ein Geist pro Körper = viele parallele Aktivitäten möglich.
-
Ein Geist für alle Körper = ein Chaos aus halbherzigen Neben- und Haupttätigkeiten.
Die Rolle des individuellen Bewusstseins (kṣetrajña)
Laut Shankara ermöglicht es die besondere Kraft des Yogis, mehrere Körper für ein einziges individuelles Bewusstsein zu erschaffen. Er vergleicht dies mit dem Einsatz verschiedener Werkzeuge: Jede Tätigkeit braucht ihr eigenes Instrument, und so braucht auch jeder „Nebenkörper“ seinen eigenen Geist und eigene Sinne, um sinnvoll zu handeln.
Philosophische Streitpunkte
Shankara weist darauf hin, dass es über diesen Punkt Uneinigkeit gibt:
-
Gruppe A sagt: Jeder Körper hätte ein eigenes individuelles Bewusstsein (kṣetrajña). Das hieße, dass einige dieser Bewusstseine Früchte von Handlungen ernten würden, die sie gar nicht selbst begangen haben – was im klassischen Karma-Verständnis problematisch ist.
-
Gruppe B widerspricht: Nein, jedes dieser individuellen Bewusstseine hätte in seiner „gegenwärtigen Lage“ tatsächlich eigene Handlungen ausgeführt und würde dementsprechend auch eigene karmische Früchte empfangen.
Shankara lässt diese Debatte offen, zeigt aber, dass selbst im alten Indien die Frage nach Ich, Körper und Geist nicht nur mystisch, sondern auch logisch und ethisch diskutiert wurde.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-17: Vollkommene Erkenntnis (Samprajnata) wird beim Durchlauf von Ahnung, Erfahrung, Freude und Einheitswahrnehmung [in der Meditation] gewonnen
Yoga Sutra II-3: Unwissenheit, Identifikation mit dem Ego, Begierde, Abneigung und (Todes-)Furcht sind die fünf leidbringenden Zustände (Kleshas)
Yoga Sutra II-6: ›Identifikation mit dem Ego‹ [= Asmita] basiert auf Identifikation des Sehenden mit dem Instrument des Sehens
Yoga Sutra III-48: Samyama auf den Wahrnehmungsprozess der Sinnesorgane, ihre Eigennatur, ihre Verbindung zu unserem Ego, ihre Wechselwirkung untereinander und ihren Zweck führt zum Sieg über die Sinne

Schlussbemerkung
Abschließend könnte man sagen: Yogasutra 4.4 liefert sowohl eine philosophische Tiefenschicht als auch eine sehr praktische Übung. Philosophisch gesehen ruft es in Erinnerung, dass das Ego der Quell aller mentalen Vielfalt ist – was zur Aufforderung führt, diesen Quell zu erkennen, wenn man innere Freiheit erlangen will. Praktisch gesehen lädt es dazu ein, im Alltag und in der Meditation achtsam zu beobachten, wie das Ichgefühl unsere Gedanken bewegt. Diese Beobachtung bringt bereits Distanz. So verliert das Ego etwas von seiner Tyrannei – und wir gewinnen an innerer Ruhe. Die Bewegungen des Geistes entlarven ihren Urheber, und vielleicht taucht dahinter etwas viel Größeres auf: das bewusste Selbst, das in Stille und Klarheit ruht, unverändert vom Kommen und Gehen der Gedanken. Diese direkte Erfahrung ist letztlich durch keine Worte zu ersetzen – aber Patanjalis alte Sutra gibt uns einen Fingerzeig in genau diese Richtung.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-4
Gemüt und Ego – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 4-6
Länge: 6 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Übertragung von Asmita Matra – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.4
Länge: 9 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Viele Inkarnationen, ein unveränderliches Selbst: Asha Nayaswami (Class 63) zu Sutra 4.2 bis 4.6
Länge: 73 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


