pravṛtti-bhede prayojakaṁ cittam-ekam-anekeṣām
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्
Dieses Sutra erzählt von der Einheit hinter all unseren Gedanken, Rollen und Masken. Die alten Meister Vyasa, Shankara und Mishra haben darüber gestritten, erklärt, ergänzt – und die moderne Wissenschaft nickt inzwischen (teilweise) mit.
Kurz zusammengefasst
- Ein allumfassendes Bewusstsein
Yogasutra 4.5 beschreibt, dass alle individuellen Geistbewegungen letztlich Teil eines einzigen, allumfassenden Bewusstseins sind – wie viele Wellen, die denselben Ozean bilden. - Klassische Kommentare
Vyasa erklärt, wie ein Yogi mehrere Geister erschaffen und durch einen zentralen Geist lenken kann. Shankara präzisiert, dass diese Geister trotz unterschiedlicher Aktivitäten von einer übergeordneten Instanz geführt werden. Mishra entkräftet den Einwand, mehrere Geister könnten ohne Führung nicht koordiniert sein. - Psychologische und wissenschaftliche Parallelen
Daniel Siegel sieht Integration als zentrales Prinzip für psychische Gesundheit – viele Teile, ein Ganzes. Zoran Josipovic belegt, dass Einheitserfahrungen messbare Veränderungen im Gehirn hervorrufen. - Praxis in Meditation und Alltag
In Meditation wird geübt, den „Hintergrund“ zu spüren, aus dem alle Gedanken auftauchen. Im Alltag helfen kleine Achtsamkeitsmomente, sich nicht nur als getrenntes Ich, sondern als Teil eines größeren Feldes wahrzunehmen.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Pravritti, pravṛtti = Aktivität; Beschäftigung; Erscheinungsformen; gezielte Gedanken; sich vorwärts und nach außen bewegend; sich vorwärts drehend; wahrnehmen;
- Bhede, bheda = Unterschied; (aus der) Trennung; Zerbrechen; Abgrenzung; Unterscheidung; unterschiedlich; Verschiedenartigkeit;
- Prayojakam = lenkend; antreibend; veranlassend; anstiftend; Anführer; Initiator; Antriebskraft;
- Chittam, citta = Verstand; Geist; Wahrnehmungsraum; Geistfeld; Feld des Bewusstseins;
- Ekam, eka = ein; einer; einzig;
- Anekesham, anekeshâm, anekeṣām = von vielen; vielfältig; aus den anderen (bewirkten Cittas); der vielen;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
In diesem Abschnitt des vierten Kapitels vertieft Patanjali die Aussagen über das Überwinden der Identifikation mit der individuellen Persönlichkeit und die Evolution des Yogi hin zum kosmischen universellen Bewusstsein. Die zentrale Ursache unseres Leidens – und damit der Notwendigkeit, Yoga zu üben – liege laut Patanjali in unserer beherrschenden Unwissenheit über das wahre, universelle Selbst. Mit anderen Worten: wir halten uns irrtümlich für ein getrenntes Ego, während in Wahrheit etwas Allumfassendes hinter unserem Geist wirkt.

Schlüsselbegriffe und ihre Bedeutung
Das Sutra selbst lautet auf Sanskrit: pravṛtti-bhede prayojakaṁ cittaṁ ekam anekeṣām. Wörtlich übersetzt etwa: „Auch wenn die Aktivitäten der vielen Geister verschiedenartig sind, ist ein Geist der Lenker der vielen.”. Eine freie deutschsprachige Übersetzung gibt etwa den Sinn wieder: „Es existiert ein allumfassendes Bewusstsein; die vielen Bewegungen des Geistes in unzähligen Menschen sind letztlich Teil davon.“ Diese Aussage klingt zunächst abstrakt, trägt jedoch eine tiefe philosophische Botschaft in sich: Hinter der Vielfalt individueller Geist-Aktivitäten gibt es eine eine Instanz – ein allumfassendes Bewusstsein, einen einzigen Geist als Ursprung oder treibende Kraft. So lautet jedenfalls eine Interpretationsmöglichkeit dieses Verses ...
Wichtig ist zu verstehen, dass Patanjali hier an vorherige Verse anknüpft. Im Sutra 4.4 heißt es: „Die individuellen Geister (mind fields) entstehen einzig aus der Ich-Identifikation (Asmita).“ Damit wird gesagt, dass unser persönlicher Geist – unser mentales Feld – überhaupt nur durch die Identifikation mit einem Ich (Ego-Bewusstsein) entsteht. Daraus folgt Sutra 4.5: Trotz der Vielzahl solcher aus Ego-Bewusstsein entspringenden Geister gibt es etwas Einheitliches, einen gemeinsamen Urgrund. Der Vers 4.5 kann also als Korrektiv zu 4.4 gelesen werden: Ja, es gibt unzählige einzelne mentale Aktivitäten und Persönlichkeiten, aber diese sind letztlich Ausdruck oder Ausfluss eines grundlegenden Bewusstseinsprinzips.
Um Patanjalis Aussage näher zu verstehen, lohnt es sich, die Schlüsselbegriffe umfassender zu definieren:
- Citta – wird oft mit Geist, Mind oder Geistfeld übersetzt. Es umfasst im Yoga Sutra das gesamte mentale Instrumentarium: Verstand, Intellekt, Ego und unterbewusste Eindrücke. Im vorliegenden Kontext kann man citta als das individuelle Geistfeld oder den persönlichen Geist verstehen, der unsere Gedanken, Gefühle und Identität formt. Yogasutra 4.5 spricht von anekesham citta – den „vielen Geistern“ bzw. mentalen Aktivitäten der Vielen.
- Pravṛtti – bedeutet Aktivität, Bewegung, Funktion. Die pravṛtti-bhede sind die „verschiedenen Aktivitäten/Bewegungen“ der Geister. Gemeint sind damit die unzähligen Gedankenwellen, Wahrnehmungen, Willensakte und Bewusstseinsinhalte in den unzähligen individuellen Minds der Lebewesen. Jeder Mensch hat seine eigenen geistigen Bewegungen – doch all diese unterschiedlichen Vorgänge könnten auf etwas Einheitliches zurückzuführen sein.
- Ekam citta – wörtlich „ein Geist/Bewusstsein“. Hier liegt der Clou: Es gibt etwas Einheitliches hinter der Vielfalt. Ob man es allumfassendes Bewusstsein, universeller Geist oder eine geistige Ur-Instanz nennt – Patanjali spielt darauf an, dass diese eine Instanz die treibende Kraft (prayojakam) hinter den vielen mentalen Vorgängen (oder, andere Auslegung, den vielen geschaffenen Geistern) ist. In manchen Kommentaren wird citta ekam als der eine Ur-Geist eines Yogi interpretiert (dazu gleich mehr), in anderen als Hinweis auf das eine Bewusstsein hinter allen Erscheinungen.
- Prayojaka – bedeutet Lenker, Antreiber, Initiator. Das eine Geistprinzip wird als Lenker der vielfältigen geistigen Aktivitäten bezeichnet. Wie ein Dirigent im Hintergrund sorgt es dafür, dass die vielen einzelnen „Noten“ und Stimmen der Schöpfung letztlich Teil einer größeren Symphonie sind.
- Asmita – übersetzt Ich-Bewusstsein oder Ego. In Sutra 4.4 hieß es, dass aus Asmita (dem Gefühl eines separaten Ich) all die personalisierten Geister entstehen. Asmita ist sozusagen der Keim des individuellen Geistes. In unserem Alltag merken wir Asmita in jedem Moment, in dem wir denken „Ich mache, ich denke, ich fühle“. Yoga zielt darauf ab, diese enge Identifikation mit dem kleinen Ich zu durchbrechen.
- Allumfassendes Bewusstsein – Ein Begriff, der im Yoga-Kontext oft auf Purusha oder Atman verweist, das reine Bewusstsein jenseits aller Wandel. Während Prakriti (die Natur) alles Veränderliche wie Gedanken, Körper etc. beinhaltet, ist Purusha das unveränderliche, ewig reine Bewusstsein. Einige Interpretationen setzen das „eine Bewusstsein“ in Sutra 4.5 mit Purusha gleich – quasi der eine göttliche Funke oder das höchste Selbst, das in allen Wesen derselbe ist. Andere deuten es eher kosmologisch, etwa als Ishvara, einen besonderen allgegenwärtigen Purusha (Gott als Weltenseele). Wichtig ist: Im Gegensatz zum kleinteiligen, fluktuierenden Geist (citta) meint Bewusstsein hier (vermutlich) etwas Umfassendes und Stabiles.
- Geistige Aktivitäten (im Text „Bewegungen des Geistes“) – damit sind alle Vorgänge im Geistfeld gemeint, also Gedanken (Vrittis), Emotionen, Wahrnehmungen, Erinnerungen usw. Patanjali lehrt bereits im 1. Kapitel (Yoga Sutra 1.2), dass Yoga das „Zur-Ruhe-Bringen der Geistbewegungen“ ist. In Sutra 4.5 nun geht es um die Quelle dieser zahllosen Bewegungen: Letztlich stammen sie aus einem gemeinsamen Urgrund, so die Aussage.
Indem wir diese Begriffe verstehen, wird deutlicher, worauf Patanjali abzielt: Er zeichnet ein Bild, in dem viele einzelne Wellen (unsere Geister oder mentalen Persönlichkeiten und ihre Aktivitäten) auf der Oberfläche existieren, aber alle im selben Ozean des Bewusstseins. Der eine Ozean des Geistes drückt sich in unzähligen Wellen aus. Die Wellen mögen verschieden aussehen – hoch oder flach, stürmisch oder ruhig –, doch sie bestehen alle aus Wasser und sind Teil desselben Meeres.
Schauen wir uns nun einige Punkte noch näher an.
Zu Chitta
Hier wird also Chitta im Sinne vom Geist eines Menschen (oder anderen Lebewesens) verstanden. Patanjali schreibt nun, dass es so viele Chittas wie Wesen gibt, dass aber ein Bewusstsein alle diese Chittas lenkt und kontrolliert. Oder, so z. B. Swami Vishnu: “... all diese verschiedenen Gemüter sind Bestandteil des einen kosmischen Geistes.”
In Sutra gibt Patanjali das große Ziel der Yogapraxis vor:
Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im Geist
Meint: Die Geistwellen deines individuellen Chitta beruhigen und zum Stillstand bringen, so dass sich “der große Geist”, der “eine”, offenbaren kann. Swami Sivananda sagt in „Licht des Yoga“ (zitiert von Rainbowbody):
„Yoga ist die Methode, durch die das endliche Selbst oder die individuelle Seele mit dem Unendlichen Selbst oder der Höchsten Seele vereinigt wird.“
Wir als Teil des großen Ganzen
Wir sind keine getrennt von allem existierenden Wesen. Schon am Atem erkennt man, dass wir auf ständigen Austausch mit der Welt um uns herum angewiesen sind. Im Vedanta gibt es den Begriff des Viratswarupa, welcher meint, dass unser ganzes Universum mit allen Elementen darin ein organisches großes Ganzes bilde. Oder auch: Gott ist alles.
Auch unser Chitta, unser Denken, ist wohl bei kaum einem Wesen unabhängig von all den Gedanken/Wünschen/Vorstellungen anderer Menschen/Wesen um sich herum. Wir beeinflussen uns ständig emotional und lenken unsere Gedanken auf die Verweise unserer Umwelt. Wenn man nun all die Gedanken und Emotionen aller Wesen als “das große kosmische Bewusstsein” bezeichnet, so wird Patanjalis Aussage, dass wir alle Teil dieses großen kosmischen Bewusstseins sind und (zum Teil) auch von diesem gelenkt werden, verständlich.
Sukadev ist davon überzeugt, dass alles eine Manifestation einer einzigen kosmischen Seele ist und wir und alles letztlich von dieser gesteuert wird.
Wir merken diese Verbundenheit mit der großen kosmischen Seele nicht, weil wir in unserem falschen Ego-Selbstbild verstrickt sind. Unwissend sind. Rainbowbody: „Diese Unwissenheit wird Avidya (Unwissenheit) genannt, von der Asmita (das Gefühl eines getrennten Selbst oder Egos) ein Hauptleid ist. Das Leiden von asmita verursacht falsche Identifikationen …” Aber dagegen gibt es ja den Weg des Yoga ...
Hast du schon einmal in der Meditation ein Gefühl von „Einheit mit allem“ erlebt?
Ich als Teil Gottes
Eine andere Herangehensweise an die Aussage dieser Sutra sehen wir im Bhakti Yoga. Hier widmen wir unser ganzes Sein dem göttlichen Willen und sehen uns selbst – und damit auch unser gesamten Chitta mit allen Gedanken und Emotionen – als Teil Gottes.

Klassische Kommentare: Von erschaffenen Geistern und der einen lenkenden Instanz
Patanjalis Sutras sind sehr knapp gefasst, weshalb seit der Antike Kommentare entstanden, die die Bedeutung entfalten. Die älteste erhaltene Interpretation stammt von Vyasa (sein Yoga-Bhashya aus ca. 4. Jh. n.Chr.), auf den sich viele spätere Kommentatoren wie Vachaspati Misra oder Vijñanabhikshu stützen. Schauen wir, was die klassischen Quellen zu Sutra 4.5 sagen:
Vyasa stellt sich im Kommentar zu 4.5 eine für unser gängiges Weltbild abstruse Frage: Was passiert, wenn ein Yogi mehrere Körper und Geister erschafft? Die Vorstellung, dass ein Yogi „zusätzliche Geister“ erschaffen kann, wirkt wie Fantasy, ist aber fest in den klassischen Yogaschriften verankert.
Sutra 4.4 deutete Vyasa bereits so, dass ein Yogi aus purem Ego-Willen (asmitā-mātrāt) neue Geistwesen erschaffen kann. (Man denke an fortgeschrittene Yogis oder Götter, die mehrere Manifestationen gleichzeitig haben – das Konzept von Avatara in der indischen Mythologie). Vyasa fragt: Gibt es dann zu jedem Körper einen eigenen Geist, oder teilen sie sich einen? Seine Antwort: Der Yogi schafft zwar für jede geschaffene Körper-Entität einen separaten Geist, aber sein eigener ursprünglicher Geist bleibt der Regisseur im Hintergrund. Bildlich gesprochen: Viele Glühbirnen leuchten in verschiedenen Räumen, aber sie alle hängen am selben Kraftwerk.
Der Kommentar sagt ausdrücklich: „Nimmt man als Ursache den Geist, der nichts als Ichbewusstsein ist, erschafft [der Yogi] die erzeugten Geister. Diese geschaffenen Persönlichkeiten haben eigene Geister, doch sie folgen in ihrem Wirken den Absichten eines Geistes.“ Dieser eine Geist ist der des Yogi selbst, der wie ein Puppenspieler im Verborgenen die Fäden hält. So erklärt Vyasa den Satz prayojakaṁ cittaṁ ekam: der Yogi macht einen Geist zum Lenker aller anderen von ihm geschaffenen Geister. Dadurch werden ihre verschiedenen Aktivitäten letztlich von einer zentralen Instanz koordiniert.
Warum sollte ein Yogi so etwas tun? Auch darauf gehen die klassischen Kommentare ein: Es heißt, ein mächtiger Yogi oder ein göttliches Wesen könne so mehrere Leben und Erfahrungen parallel durchlaufen, um Karma schneller abzutragen und die Befreiung (Kaivalya) zu beschleunigen. Ein Yogi könnte z. B. mehrere Körper annehmen und jeder dieser Körper hat seinen eigenen Geist, sammelt Erfahrungen, begleicht karmische Schulden – und all das gesteuert von dem einen höheren Geist des Yogi, der alle überwacht. So ähnlich wird erklärt, wie Gottheiten (wie Vishnu) ihre Avatare steuern: Vishnu bleibt der eine Lenker im Hintergrund, auch wenn zeitgleich z. B. Krishna und andere Manifestationen aktiv sind. Der Yogi wird hier also quasi als multitaskender Regisseur der Geister dargestellt. Wichtig: Es geht nicht um “mind control” unter verschiedenen Personen im Alltag, sondern um einen einzigen erleuchteten Yogi, der seine eigenen, von ihm geschaffenen Mentalwesen lenkt.
Neben Vyasa haben spätere Kommentatoren unterschiedliche Akzente gesetzt. Einige, vor allem im mittelalterlichen Vedanta-Einfluss, lesen Sutra 4.5 weniger wörtlich und mehr metaphysisch: Sie sehen im „einen Geist“ den einen Purusha oder Brahman, also das eine transzendente Bewusstsein, das allen individuellen Geistern zugrunde liegt. In dieser Sicht spiegelt Yoga Sutra 4.5 eine Art Einheitsphilosophie: Es gibt nur ein Bewusstsein, das in vielen Köpfen „scheint“ wie eine Sonne, die in vielen Wassertropfen reflektiert wird. Obwohl Patanjali als Philosoph eigentlich der Sankhya-Schule nahesteht (die viele Purushas, also viele getrennte Bewusstseine, annimmt), haben Kommentatoren – insbesondere solche beeinflusst von Advaita Vedanta – den Vers gern so interpretiert, dass er mit dem Vedanta-Gedanken „ein Atman in allen“ harmoniert. Tatsächlich klingt die Formulierung „cittam ekam anekeṣām“ für einen Advaitin fast wie eine Bestätigung: Hinter der Vielheit (anekeshām) steckt Einheit (ekam).
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
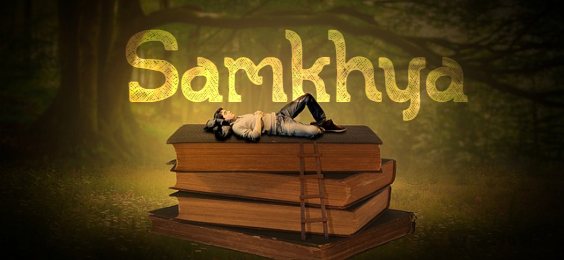
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
Das Samkhya ist eines der ältesten philosophischen Systeme indischer Herkunft. „Samkyha“ bedeutet wörtlich „Zahl“, „Aufzählung“ oder „das, was etwas in allen Einzelheiten beschreibt“. Hiermit ist die Aufzählung und Analyse jener Elemente gemeint, die gemäß Samkyha die Wirklichkeit bestimmen.
Allein das Wissen um diese Elemente soll bereits zur Erlösung vom Kreislauf der Wiedergeburten führen. Damit einher geht die Beendigung von drei Arten des Leidens (duhkha):
- adhyatmika (Leiden unter physischen oder psychischen Krankheiten),
- adhibhautika (von Außen zugefügtes Leid durch menschliche Gewalt oder Umwelteinflüsse),
- adhidaivika (Leid durch Naturgewalt, Umweltkatastrophen oder übernatürliche Phänomene).
Purusha, Prakriti, Guna
Das Universum und die Abläufe darin beruhen gemäß Samkyha auf zwei fundamentalen Prinzipien:
- Purusha: passiver aber bewusster Geist, auch Urseele, Weltgeist oder kosmisches Selbst genannt. Steht im Dualismus für Subjekt und das Wahre Selbst.
- Prakriti: aktive aber unbewusste „Urmaterie“, das Wahrnehmbare, das Benennbare oder „Natur“. Steht im Dualismus für Objekt und das Universum
Swami Satchidananda schreibt:
„Das Purusha ist das Wahre Selbst, das Purusha sieht. Prakriti ist alles andere.“
Es herrscht Uneinigkeit: Die Samkhya Philosophie sagt, dass es ein real existierendes Universum gibt. Die Vedanta-Lehre sieht alles als Maya, als Illusion an.
Prakriti und die Gunas
Der Urnatur Prakriti werden im Samkhya drei Gunas (Merkmale, Eigenschaften, von Hauer „Weltstoffenergien“ genannt) zugerechnet:
- Sattva (das Seiende, Reinheit, Klarheit). Gemäß Ayurveda-Lehre steht Sattva für Reinheit, Ausgeglichenheit, Balance und Neutralität. Charakterlich zeigt sich eine Sattva-Vorherschaft in Freigebigkeit, Gelassenheit, Zufriedenheit, Weisheit, Ausgeglichenheit und Toleranz. Menschen, die sich vorwiegend sattvisch ernähren sollen länger leben und gesünder alt werden. Als sattvische Nahrungsmittel gelten frische & reife Früchte, Honig, Milch, Reis, Weizen, Safran und Zimt.
- Rajas (Bewegung, Energie, Leidenschaft). Verantwortet Wandlung, Veränderung und Dynamik. Aber auch Zorn, Rastlosigkeit und Hektik.
- Tamas (Trägheit, Dumpfheit, Dunkelheit, Schwere). Eine Kraft, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit trübt und unsere Wirkkraft schwächt. Aber auch das Prinzip der Ruhe.
Sattva für den Yogi
Feuerstein (Buch bei Quellen ergänzen) schreibt: „Während aktive (rajas) und träge (tamas) Qualität dazu neigen, die Ich-Illusion aufrechtzuerhalten, erschafft die Qualität der Helligkeit (sattva), insoweit sie dominiert, die Vorbedingungen für das Befreiungsgeschehen. Daher erstrebt der yogin sattvische Konditionen und Zustände.“
Aber auch das Körper-Geist-System existiert auf Basis der drei Gunas. Als Yogi wisse man, dass alle drei Prinzipien miteinander wechselseitig verbunden sind. Jede Anhaftung an einen Zustand (Sattva ...) führt (ebenfalls) zu Leid.
Purusha
Purusha ist das Selbst, das allen fühlenden Wesen innewohnt. Durch Purusha erhalten Menschen, Tieren, Pflanzen und Götter ihre Empfindungsfähigkeit und Bewusstsein.
Des Menschen wahre und ursprüngliche Identität ist einzig und allein Purusha, die sich zum Zwecke des Erfahrens in Prakriti manifestiert hat, siehe Sutra II-18.
Nun verstrickt sich dieses Purusha in Prakriti, hält die zur Sphäre der Prakriti gehörigen Elemente und Bereiche irrtümlicherweise für Bestandteile seiner selbst. Daraus entsteht Leid.
Grundelement der Lehre des Samkhya für den nach Erlösung Strebenden ist deshalb, die beiden Substanzen Purusha und Prakriti und ihre Merkmale streng voneinander unterscheiden zu lernen.
Vedanta
Im nondualen Vedanta ist Prakriti nur eine Täuschung, Maya.
Physik und Quantentheorie
Betrachten wir den Bildschirm vor uns, so sehen wir gemäß der Physik ein Konstrukt aus Neutronen, Elektronen und Protonen, die alle auf einer eigenen Frequenz schwingen und um sich kreisen. Nahezu 100 Prozent des Bildschirmes besteht aus Vakuum! Nur unsere Sinne – die Sinne des Wahrnehmenden – machen daraus einen Monitor.
Die Quantenphysik macht alles noch verschwommener: Ob sich ein subatomares Partikel als Teilchen oder als Welle verhält, hängt vom Beobachter ab. Anders ausgedrückt: vom beobachtenden Bewusstsein. Vom Wahrnehmenden und dessen Wahrnehmung. Eigenschaften der Partikel wie dessen Lokalität können nicht vom Betrachter getrennt werden. Dies geht mehr in Vedanta (und Buddhismus)-Richtung als die Samkhya-Behauptung eines unabhängig von Purusha existierenden Universums Prakriti.
Andere Ausleger betonen wiederum den psychologischen Aspekt: Das eine Geistprinzip ist das Individuationszentrum in uns, der Kern des mentalen Selbst (man könnte sagen die tiefe Ich-Identität), aus dem alle unsere vielen Gedanken, Rollen und Teilpersönlichkeiten hervorgehen. Swami Jnaneshvara interpretiert Sutra 4.5 etwa so, dass aus dem feinstofflichen Ich-Sinn (I-ness, Asmita) ein Wurzel-Geist entspringt, der dann viele mentale Identitätscluster hervorbringen kann. Mit anderen Worten: Innerhalb eines Individuums gibt es ein zentrales Selbstgefühl, und darum herum formieren sich die „vielen Geister“ in Form unserer verschiedenen Masken, Stimmungen, Neigungen. All die mentalen Konstrukte, die wir für unser Ich halten (Persönlichkeitsaspekte, Ego-Strukturen), sind in diesem Sinn sekundär und untergeordnet gegenüber dem einen inneren Kern, der sie verursacht. ("All of the mental constructs of who we think we are, are false identities that are secondary to that central mental identity.") Diese Deutung liest Sutra 4.5 also nicht kosmisch, sondern intra-psychisch: Der Mensch hat einen Wesenskern, aus dem viele mentale Aktivitäten entspringen.
Man sieht: Die klassischen und traditionellen Kommentare bieten mehrere Ebenen an:
- Mystisch-kosmisch-göttlich: Ein universales Bewusstsein, ein Gott, aus dem alle Einzelseelen hervorgehen.
- Yogisch-spezifisch: Ein Yogi, der mehrere Nirmita Cittas (geschaffene Geister) steuert, um Karma abzuarbeiten.
- Psychologisch: Ein zentrales Ich-Gefühl, aus dem viele mentale Facetten entstehen.
Interessanterweise schließen sich diese Lesarten nicht unbedingt aus. Sie beleuchten das Sutra eventuell nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Patanjalis Sprache ist abstrakt genug, um sowohl eine praktische yogische Siddhi (Fähigkeit) zu beschreiben, als auch ein metaphysisches Prinzip. Genau diese Vielschichtigkeit macht die Yoga Sutras so spannend – jeder Vers hat „so viele Ebenen der Interpretation und so viel Potenzial, missverstanden zu werden”, dass der Vergleich verschiedener Übersetzungen und Kommentare äußerst aufschlussreich ist. Sutra 4.5 bildet da keine Ausnahme.

Moderne Auslegungen und wissenschaftliche Einblicke
In der Neuzeit wird Yogasutra 4.5 oft im Lichte moderner Begriffe und Erkenntnisse diskutiert. Viele zeitgenössische Kommentatoren – insbesondere solche, die Yoga mit Spiritualität und Advaita verbinden – betonen die Einheitsdimension dieser Sutra. So heißt es beispielsweise in einem neueren Kommentar: „Das eine, allumfassende Bewusstsein liegt dem individuellen Geist zugrunde. Wenn wir die Identifikationen auflösen und das starre, egozentrierte Denken überwinden, können wir eins werden mit dem universellen Geist. Diese Union ist das Ziel des Yoga… Das eine Bewusstsein, das sich in der Vielfalt offenbart, ist unser wahres Wesen, nicht der Geist unserer selbstgeschaffenen Person.“ Hier klingt eine moderne, fast poetische Interpretation an, die sehr an Upanishaden oder Vedanta erinnert – nämlich die Identität des individuellen Selbst mit dem All-Bewusstsein. Für Yoga-Praktizierende heute ist diese Lesart attraktiv, weil sie die Erfahrung von Verbundenheit und Ganzheit betont: Yoga führt zu dem Gefühl, Teil eines größeren Bewusstseins zu sein, oder genauer: dieses größere Bewusstsein selbst zu sein.
Andere moderne Lehrer interpretieren Sutra 4.5 pragmatischer, ohne notwendigerweise auf metaphysische Einheit zu pochen. Sie sehen darin z. B. eine Beschreibung dessen, was im Zustand tiefer Meditation passiert: Alle zerstreuten geistigen Aktivitäten integrieren sich, es wird ein fokussiertes Bewusstsein aus der zuvor fragmentierten Aufmerksamkeit. In diesem Sinn könnte man sagen: normalerweise zappelt unser Geist in tausend Richtungen – aber im Yoga sammeln wir ihn zu einer Gerichtetheit, einem stillen Bewusstseinsfeld, aus dem heraus alles andere gesteuert wird. Das passt zum nächsten Sutra (4.6), in dem es heißt, dass der aus Meditation geborene Geist keine neuen Eindrücke (Karmaspuren) mehr erzeugt. Ein ruhiger, klarer Geist also, der nicht mehr zerfasert in unzählige unbewusste Tendenzen.
Psychologische Parallelen
Interessant ist, dass auch in westlicher Psychologie Gedanken existieren, die an Patanjalis Aussage erinnern. Carl Gustav Jung etwa führte das Konzept des kollektiven Unbewussten ein – einer gemeinsamen seelischen Grundschicht aller Menschen. Er beschrieb dieses kollektive Unbewusste als ein „omnipräsentes Kontinuum, eine unausgedehnte Gegenwart“, in dem alle menschlichen Psychen gewissermaßen verbunden sind. Wenn an einem Punkt der Menschheit etwas das kollektive Unbewusste berührt, so Jung, geschehe es gleichsam überall. Das erinnert stark an ein einziges geistiges Feld, in dem individuelle Unterschiede letztlich relativ werden. Zwar spricht Jung vom Unbewussten, nicht vom Bewusstsein – dennoch ist die Idee eines geteilten seelischen Hintergrundes vergleichbar mit Patanjalis allumfassendem Bewusstsein, das den vielen Geistern zugrunde liegt. Auch Jung betonte, dass die Menschheit gemeinsame Archetypen und Symbole teilt, die aus dieser einen tieferen Schicht stammen.
Man könnte also sagen: Was Yogis als transzendentes Bewusstsein erfahren, äußert sich in der Psychologie vielleicht als kollektive Psyche. Beide Male geht es um ein Einheitsprinzip hinter der Vielheit.
Neurowissenschaftliche Perspektive
Spannend ist, dass moderne Wissenschaft versucht, dem Gefühl der Einheit empirisch auf die Spur zu kommen. In den letzten Jahren haben Neurowissenschaftler Studien mit Meditierenden durchgeführt, um sogenannte Einheitserfahrungen oder nonduale Bewusstseinszustände zu untersuchen.
In New York z.B. scannen Forscher die Gehirne von buddhistischen Mönchen und erfahrenen Meditierenden per fMRI, während diese versuchen, in einen Zustand des „Einsseins“ (Oneness) einzutauchen. Die Meditierenden üben eine Form der nicht-dualen Meditation, bei der sie ein Bewusstsein kultivieren, das frei von der Trennung zwischen Selbst und Anderem, Innen und Außen ist. Mit anderen Worten: Sie lassen die Grenzen des individuellen Geistes zeitweilig verschwinden, um eine Art allumfassendes Gewahrsein zu erfahren.
Die Forscher um Zoran Josipovic wollen herausfinden, ob es spezifische Muster der Gehirnaktivität gibt, die diese Oneness-Erfahrung begleiten. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass in tiefen Meditationen gewisse Hirnnetzwerke – insbesondere das Default Mode Network, das mit Selbstbezogenheit und Tagträumen verknüpft ist – heruntergefahren werden, während andere Verbindungen zunehmen.
Das passt zur subjektiven Schilderung vieler Yogis: Wenn das kleine Ich im Hintergrund tritt (neurologisch gesprochen: wenn die Selbstbezogenheits-Netzwerke schweigen), stellt sich ein Gefühl von Verbundenheit mit allem ein. Einige Probanden berichten, sie hätten ein Empfinden, „eins mit dem Universum“ zu sein, ungetrennt und zeitlos.
Die Neurowissenschaft steht zwar noch am Anfang, solche Bewusstseinszustände zu verstehen, doch sie nimmt die alte Yogierfahrung ernst. Es wird deutlich: Das, was Patanjali als philosophisches Konzept formulierte, hat einen erlebbaren Kern – und dieser lässt sich heute bis in gewisse neuronale Korrelate hinein nachvollziehen. Zwar wird ein Naturwissenschaftler vielleicht nicht von „allumfassendem Bewusstsein“ sprechen, aber die erfahrbare Einheit jenseits des gewöhnlichen Ego-Bewusstseins ist mittlerweile gut dokumentiert.
Noch eine Stimme aus der modernen Psychologie, die erstaunlich nah an die Essenz von Yogasutra 4.5 heranreicht:
Daniel Siegel, M.D., Psychiater und Neurowissenschaftler, hat mit seinem Konzept der „Mindsight“ ein Modell entwickelt, das die Integration des Geistes ins Zentrum stellt. Unter Integration versteht er das bewusste Verbinden vieler einzelner Aspekte – Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Sinneseindrücke – zu einem stimmigen Ganzen. Dieses „Viele in Eins“ entspricht in psychologisch-empirischer Sprache genau der Aussage von 4.5: Hinter der Vielfalt geistiger Bewegungen wirkt eine einende Instanz.
Siegel beschreibt, dass ein integrierter Geist nicht nur psychisch gesünder und flexibler ist, sondern auch mehr Verbundenheit mit anderen Menschen ermöglicht – eine Parallele zu der yogischen Idee, dass wir Teil eines größeren Bewusstseinsfeldes sind.
Quelle: Siegel, D. (2010). Mindsight: The New Science of Personal Transformation. Bantam Books.
https://www.drdansiegel.com/books/mindsight/
Ein weiterer moderner Diskurs, der indirekt an Yogasutra 4.5 erinnert, ist die Philosophie des Panpsychismus. Einige zeitgenössische Geist-Wissenschaftler und Philosophen (z. B. David Chalmers oder Teilhard de Chardin früher) vertreten die Auffassung, dass Bewusstsein eine grundlegende Eigenschaft des Universums sein könnte – nicht nur ein Zufallsprodukt des Gehirns. In manchen Theorien wird ein Bild gezeichnet, wonach Bewusstsein kein isoliertes Phänomen in einzelnen Köpfen ist, sondern ein allgegenwärtiges Feld, in dem unsere individuellen Geister eher wie Knotenpunkte wirken.
Das geht natürlich über das hinaus, was empirisch belegbar ist, und bleibt spekulativ. Dennoch zeigt es: Die Idee eines „großen Einen“ hinter den „vielen Vielen“ fasziniert auch heute noch – ob in Form eines quantenphysikalischen Feldes, eines Informationsnetzes oder eben eines spirituellen Bewusstseinsfeldes.

Praktische Bedeutung: Einheit erfahren statt nur darüber reden
Philosophische Interpretationen hin oder her – für Yogapraktizierende stellt sich die Frage: Was bedeutet das im Alltag? Wie fühlt es sich an, was bringt es auf der Matte oder im Leben? Schließlich, so wurde eingangs betont, schlägt Praxisnähe die graue Theorie. Patanjali wollte mit seinen Sutras ja nicht bloß abstrakte Ideen liefern, sondern einen praktischen Weg zur Erfahrung weisen.
In der Meditationspraxis kann Sutra 4.5 eine inspirierende Veranschaulichung sein. Wenn man sich in die Stille setzt, erlebt man zunächst das Affengehabe des eigenen Geistes – Gedanken hüpfen hierhin und dorthin, tausend „vritte“ (Wellen) ziehen vorbei. Man fühlt sich als kleines Ich, das mit seinen Sorgen und Plänen im eigenen Kopf gefangen ist. Doch mit fortschreitender Konzentration und Loslassen beginnt manchmal ein Wandel: Die Grenzen zwischen „Ich“ und „nicht-Ich“ verwischen. In Momenten tiefer Versenkung hat man das Gefühl, als ob der Geist sich weitet und mit etwas Größerem verbindet. Getrenntheit macht einem Empfinden von Verbundenheit Platz – zunächst vielleicht nur als leises Geborgenheitsgefühl, manchmal als überwältigendes Einssein. Viele Yogis berichten, in der Meditation oder im Savasana nach einer intensiven Yogastunde erahnt zu haben, was gemeint ist: ein Zustand, in dem man zugleich vollkommen man selbst und zugleich eins mit allem ist.
So eine Erfahrung zu beschreiben, ist natürlich heikel – Sprache gerät an ihre Grenzen. Ironischerweise laufen wir Gefahr, wieder glatt und klischeehaft zu klingen, wo doch die Erfahrung selbst sehr lebendig und überraschend sein kann. Wie fühlt es sich an? Vielleicht wie das Aufwachen aus einem Traum der Trennung. Man könnte sagen: es ist, als ob man immer in einem kleinen Kämmerlein gewohnt hat und plötzlich die Wände wegfallen – man ist unter freiem Himmel, im offenen Land, und merkt: Oh, da war nie ein echtes Dach, das mich vom Himmel getrennt hat. Der persönliche Geist, so mühsam er sich sonst anfühlt, ruht dann im Bewusstsein wie eine Welle im Ozean. Es gibt nicht mehr das angestrengte Machen, sondern ein Getragensein vom Fluss des Bewusstseins. Manche nennen das Gnade, andere schlicht Yoga.
Die alten Texte – Patanjali eingeschlossen – suggerieren, dass unser grundlegendes Wesen diese Weite ist. Der individuelle Geist ist nur eine Modulation dessen, so wie ein Strudel nur Wasser in Bewegung ist. In der Praxis heißt das: Je mehr wir uns mit Yoga von unseren Verhaftungen, Gedankenflut und Ego-Schichten lösen, desto mehr erinnern wir uns an dieses Gefühl der Einheit. Es ist eigentlich immer da, aber überlagert von Lärm. Das Sutra 4.5 erinnert uns: Es gibt im Grunde keinen absoluten Bruch zwischen mir und dir, meinem Geist und deinem Geist – die Unterschiede spielen sich an der Oberfläche ab. Tief unten sind wir verbunden.
"Hmmh, wo bleibt da meine Individualität?", mag da der kritische Verstand fragen. Doch interessanterweise berichten viele, die eine Einheitserfahrung machten, nicht von einem Verlust, sondern von einem Zugewinn. Statt Enge spürten sie Weite, statt Isolation ein tiefes Gefühl von Zugehörigkeit. Es ist paradox: Das Ego fürchtet die Auflösung, aber was man „dahinter“ findet, wird als weit wahrhaftiger empfunden als die enge Ego-Perspektive.
Für einen **Yogalehrerin** oder Übenden kann es sehr wertvoll sein, diese Zusammenhänge auch im Unterricht oder der eigenen Praxis zu reflektieren. Wenn wir z. B. Pranayama oder Meditation anleiten, können wir behutsam darauf hinweisen, dass alle im Raum gemeinsam atmen und Bewusstsein teilen. Nicht als esoterische Behauptung, sondern als Einladung, die feinen Empfindungen wahrzunehmen: Spürt man vielleicht, dass eine tiefe Stille gemeinschaftlich getragen wird? Dass wir Teil eines Feldes sind? Solche Hinweise können Schülerinnen helfen, ein Gefühl von Einheit zu kultivieren, ohne dass man große Vorträge über Patanjali halten muss. Die Philosophie bekommt so Hand und Fuß im Erlebnis.
Natürlich kann man Yoga auch üben, ohne sich um solche hohen Konzepte zu scheren. Niemand muss an ein „allumfassendes Bewusstsein“ glauben, um Nutzen aus Yoga zu ziehen. Doch für Fortgeschrittene oder philosophisch Interessierte bietet Sutra 4.5 einen faszinierenden Denkanstoß: Wer bin ich wirklich, wenn nicht die Summe meiner Gedanken? Könnte es sein, dass mein Bewusstsein und dein Bewusstsein am Grunde dasselbe sind? Und was bedeutet das für den Umgang mit anderen? Vielleicht wächst aus der Einsicht ein natürlicher Mitgefühl – wenn alle Geister im Tiefsten eins sind, dann verletze ich letztlich mich selbst, wenn ich anderen Schaden zufüge.
Patanjali deutet an, jedenfalls nach einer gewissen Lesart dieser Sutra, dass der vollständig verwirklichte Yogi genau das erkannt hat: Er sieht das Selbst in allen Wesen. Im Zustand von Kaivalya (der absoluten Befreiung) ruht das Bewusstsein in seiner universalen Natur und ist nicht länger getäuscht von den Oberflächenwellen der Getrenntheit.
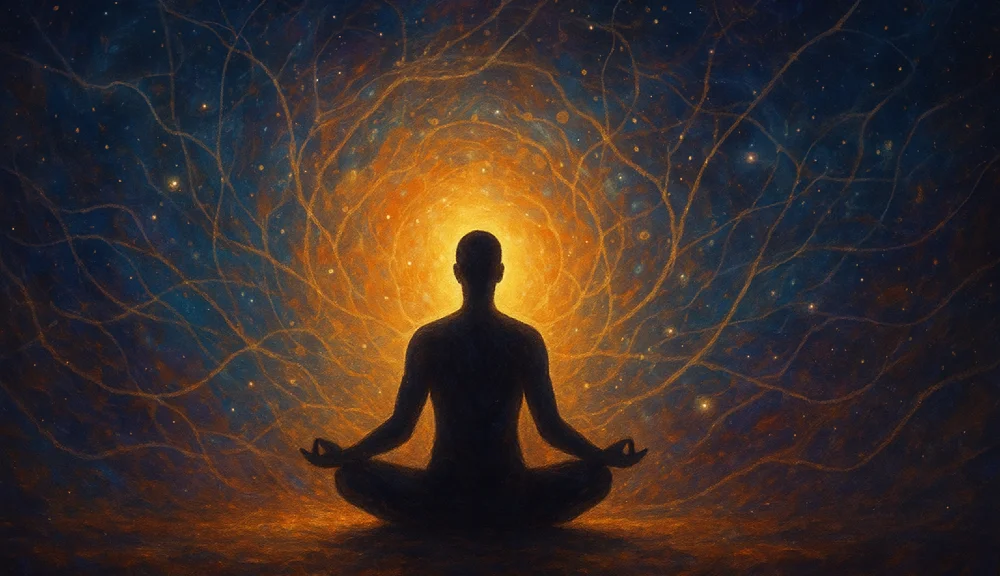
Übungsvorschläge zu Sutra IV-5
In der Meditation: den „einen Geist“ schmecken
Stell dir vor, du sitzt in deiner Meditationshaltung. Die ersten Minuten sind wie immer:
die innere Geräuschkulisse erinnert an einen Bahnhof kurz vor Feierabend. Gedanken steigen ein, steigen aus, beschweren sich über den Sitzplatz, andere trinken imaginären Kaffee.
- Schritt 1 – den Lärm nicht bekämpfen, sondern wahrnehmen
Statt sofort „Ruhe!“ zu schreien, nimm die vielen Gedanken einfach als das wahr, was sie sind: Bewegungen deines Geistes. Sag dir innerlich: Das ist eine Welle. Und das. Und das. Jede Welle anders, und doch alle aus demselben Wasser. - Schritt 2 – nach dem Wasser schauen
Irgendwann, wenn du nicht mehr jedem Gedanken hinterherläufst, merkst du: Da ist etwas Stilles, Weites, das nicht mitwippt.
Diese Weite ist das, worauf das Sutra zielt – das eine Bewusstsein hinter den vielen Bewegungen. Du suchst es nicht aktiv (das erzeugt nur neue Wellen), sondern lässt dich eher vom Rauschen in die Tiefe sinken. - Schritt 3 – kurz verweilen
Selbst wenn du nur zwei Atemzüge lang das Gefühl hast: Alles, was gerade in mir geschieht, geschieht in einem Raum, der größer ist als „mein“ kleiner Kopf – hast du die Essenz geübt. Das ist kein Dauerzustand, aber wie ein Foto, das du später innerlich wieder hervorholen kannst.
Versuche, bis an die Wurzel deines Bewusstseins zu gelangen. Werde dir bewusst, was diese Bewusstheit eigentlich ist. Findest du Hinweise, dass du mit allem und allen verbunden bist?
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Im Alltag: vom Ozean ins Büro (und zurück)
Die Meditation ist der Trainingsraum. Der Alltag ist das Spielfeld, auf dem du das Sutra wirklich testest.
- Beispiel 1 – Streitgespräch
Kollege XY fährt dir über den Mund. Sofort gehen die Wellen hoch: Ärger, Verteidigungsreden, die „Wie-kann-der-nur!“-Spirale.
Pause. Innerlich einen halben Schritt zurücktreten. Dich daran erinnern: Sein Geist, mein Geist – unterschiedliche Wellen, gleicher Ozean.
Das heißt nicht, dass du dir alles gefallen lässt. Aber du reagierst vielleicht aus mehr Weite heraus, weniger aus Reflex. - Beispiel 2 – Warteschlange
Im Supermarkt starrt jemand auf sein Handy, die Kasse kommt nicht voran. Perfekter Ort für Mikro-Übung.
Statt innerlich den Roman „Warum immer ich?“ zu schreiben, richte deine Aufmerksamkeit auf die Menschen um dich. Spür den gemeinsamen Raum. Alle warten. Alle atmen. Für einen Moment bist du nicht der Held einer tragischen Einzelgeschichte, sondern Teil einer kleinen, wortlosen Gemeinschaft. - Beispiel 3 – Naturmoment
Im Park, am Fluss, auf dem Balkon: Schließe für ein paar Atemzüge die Augen. Lausche. Wind, Vogelruf, Kinderstimme. Erlaube dem Eindruck, dich zu durchströmen. Keine Trennung zwischen „Ich höre“ und „Da draußen passiert etwas“ – nur ein Hören.
Diese Verschmelzung ist eine alltagstaugliche Kostprobe von „ein Geist, viele Bewegungen“.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.5: über den „einen Geist“ hinter vielen Geistern
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyasa stellt im Kommentar zu diesem Sutra eine Frage, die fast wie ein kleines Rätsel klingt:
Wie kann es sein, dass viele einzelne Geister in ihrem Handeln den Absichten nur eines Geistes folgen?
Seine Antwort ist ebenso knapp wie tief: Ein Yogi – oder eine besondere geistige Instanz – kann einen bestimmten Geist zum Lenker machen, der alle anderen Geister steuert. Aus dieser zentralen Führung ergibt sich, dass die vielen einzelnen Geister unterschiedliche Tätigkeiten ausführen, und doch in einer gemeinsamen Ausrichtung handeln.
Was Vyasa hier meint
Das ist keine Alltagspsychologie im Stil von „Wie führe ich mein Team effizient“. In der klassischen yogischen Vorstellung kann ein Yogi durch besondere Fähigkeiten (siddhis) zusätzliche Geister erschaffen – etwa für verschiedene Körper oder Manifestationen – und dennoch alle aus einem zentralen Bewusstsein heraus lenken.
- Das „Lenker“-Prinzip: Der eine zentrale Geist ist wie ein Dirigent. Die einzelnen Geister sind Instrumente – sie spielen unterschiedliche Stimmen, doch die Partitur stammt aus einer Quelle.
- Vielfalt und Einheit: Die Vielfalt der Aktivitäten widerspricht nicht der Einheit des Ursprungs. Im Gegenteil – die Unterschiede der Bewegungen entstehen gerade aus der Fähigkeit des „einen Geistes“, verschiedene Rollen gleichzeitig zu steuern.
💡 Merke:
Vyasa formuliert hier keine poetische Metapher, sondern beschreibt für damalige Yogis eine reale Erfahrungsmöglichkeit: Einheit inmitten der Vielfalt erleben – und diese Einheit bewusst als Führungsinstanz einsetzen.
Shankara über den „einen Geist“ als treibende Kraft
Über das Leben von Shankara
Śaṅkara – Leben, Werk und Bedeutung für die Yogaphilosophie
Śaṅkara (auch bekannt als Śaṅkarācārya oder Shankara), geboren im 8. Jahrhundert in Südindien (788–820), ist einer der bekanntesten Philosophen und spirituellen Lehrer des Advaita Vedānta. Sein Leben gleicht einem Wanderweg zwischen Legende und Geschichte – mit spirituellem Tiefgang, intellektuellem Feuer und einer Prise mystischer Überhöhung. Doch unabhängig von den genauen Daten und Wundergeschichten bleibt: Seine Ideen wirken bis heute. Auch im Yoga.
🧘♂️ Wer war Śaṅkara?
Śaṅkara wurde vermutlich in Kaladi, im heutigen Kerala, geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich – hochintelligent, fragend, neugierig auf das Wesentliche. Früh verließ er seine Familie, um Sannyāsin zu werden – also Wandermönch, asketisch, radikal dem Geistigen zugewandt. Ein radikaler Schritt, selbst nach damaligen Maßstäben.
Er reiste quer durch Indien, diskutierte mit Vertretern anderer Schulen (oft wortgewaltig und nicht selten siegreich), gründete Klöster und prägte eine ganze philosophische Bewegung. Sein Ziel: Das Wissen um die Einheit allen Seins wieder in den Mittelpunkt zu rücken – jenseits von Ritualismus, Jenseitsversprechen und dogmatischer Spaltung.
📚 Was hat er geschrieben? Und warum ist das wichtig?
Śaṅkara war kein Vielschreiber im modernen Sinn, aber seine Werke haben Wucht. Besonders wichtig:
- 🔹 Brahmasūtra-Bhāṣya
Sein wohl berühmtestes Werk: ein Kommentar zu den Brahmasūtras, dem philosophischen Herzstück des Vedānta. Hier entfaltet er die Kernaussage des Advaita Vedānta: Alles ist eins. Brahman ist das einzig Wirkliche. Die Welt der Formen ist letztlich Illusion (Māyā). - 🔹 Upaniṣad-Kommentare
Śaṅkara kommentierte auch zentrale Upaniṣaden – jene Texte, die die tiefsten Fragen des Selbst, der Wirklichkeit und der Befreiung behandeln. Seine Lesart macht klar: Yoga ist nicht nur Praxis, sondern Erkenntnisweg. Nicht das Tun allein befreit, sondern das Verstehen. - 🔹 Bhagavadgītā-Bhāṣya
Auch hier interpretiert Śaṅkara das Geschehen nicht als moralisches Lehrstück, sondern als spirituellen Weckruf: Handle, aber erkenne, dass du nicht der Handelnde bist. Karma-Yoga, Jñāna-Yoga, Bhakti – für ihn keine Gegensätze, sondern Stufen der Reife.
Shankaras Doppelrolle – Berühmt als Advaita-Vedanta-Philosoph, kommentierte er hier einen Yoga-Text – und brachte so zwei Philosophieströmungen miteinander ins Gespräch.
🧠 Was sagt Śaṅkara, das heute noch trägt?
Für Menschen, die sich mit Yogaphilosophie beschäftigen – und nicht nur schwitzen, sondern auch verstehen wollen – ist Śaṅkara Gold wert. Seine Lehren laden ein, hinter die Oberfläche zu schauen. Meditation? Ja, aber nicht als Methode zur Beruhigung, sondern zur Erkenntnis der wahren Natur.
Er sagt: Du bist nicht dein Körper, deine Gedanken oder dein Yoga-Fortschritt. Du bist Brahman. Schon immer. Nur vergessen.
🔍 Was bedeutet das für dich?
- Wenn du meditierst, denk daran: Du musst nicht irgendwohin kommen. Du bist schon da.
- Wenn du philosophierst, lass dich nicht verwirren von intellektueller Gymnastik. Suche das Einfache im Komplexen.
- Wenn du zweifelst, erinnere dich: Erkenntnis ist kein fernes Ziel, sondern etwas, das du jederzeit berühren kannst – still, wach, jenseits der Worte.
Shankara, der Meister der präzisen Formulierungen, greift Vyasas Bild vom einen Geist hinter vielen Geistern auf – und legt es noch eine Spur deutlicher aus.
Er beschreibt, wie trotz der Vielfalt an Aktivitäten – viele Körper, viele Gedankenströme, viele Handlungen – ein einziger Geist (der des Yogis) alle von ihm geschaffenen Geister antreibt und lenkt. Man kann es sich vorstellen wie einen Yogi, der mehrere Figuren auf einem Spielbrett in Bewegung setzt: Jede Figur bewegt sich auf ihre Weise, aber alle folgen letztlich der Strategie des einen Spielers.
Der steuernde Geist
- Überwachung und Ausrichtung: Der zentrale Geist des Yogis „beaufsichtigt“ die Aktivitäten aller anderen projizierten Geister. Er ist nicht in jedem Detail verstrickt, aber er hält den Überblick – wie ein Regisseur, der zwar nicht jede Geste der Schauspieler vorgibt, aber den roten Faden der Handlung bestimmt.
- Vielfalt als Ausdruck: Die Unterschiede in den Handlungen der einzelnen Geister entstehen aus den jeweiligen Körpern, Rollen und Umständen, in denen sie wirken. Dennoch – und das betont Shankara – bleiben sie auf die Ziele des einen Geistes ausgerichtet.
- Gehorsam im alten Sinn: Hier geht es nicht um blinden Gehorsam, sondern um eine Art natürliche Gefolgschaft: Die anderen Geister sind Schöpfungen des Yogis, also folgen sie selbstverständlich seiner inneren Ausrichtung.
So könnte sich das anfühlen
Übertragen in deine Welt: Stell dir vor, du spielst in einer Theateraufführung gleich mehrere Rollen – mit unterschiedlichen Kostümen, Stimmen, Gesten. Außenstehende sehen verschiedene Charaktere, aber innen weißt du: Ich bin in allen Figuren derselbe. Shankara sagt: Für einen Yogi mit dieser Fähigkeit ist es genau so. Er „bewohnt“ verschiedene Geister, doch das eine Bewusstsein bleibt der Taktgeber.
Mishra über den „einen Leiter vieler Geister“
Mishra setzt in seinem Kommentar zum Yogasutra bei einem Einwand an, der fast logisch klingt:
Wenn es mehrere Geister gibt, wie soll dann einer gehorchen – und wie könnte überhaupt eine gegenseitige Ausrichtung bestehen?
Ohne eine gemeinsame Führung, so der Gedanke, würde jeder Geist sein eigenes Ding machen.
Mishras Klärung
Für Mishra liegt die Antwort im Kern des Aphorismus selbst:
- Ein Geist als Leiter – Wenn ein Yogi einen bestimmten Geist zum Führenden macht, kann dieser auch mehrere Geister koordinieren, selbst wenn diese in verschiedenen Körpern wirken.
- Gefahr des „Fehlers“ – Gäbe es keine solche Führung, würden die Geister unverbunden nebeneinanderlaufen – wie unkoordinierte Musiker in einem Orchester ohne Dirigenten. Das Ergebnis: Disharmonie.
- Fehler behoben – Sobald der Yogi einen Geist klar als Leiter bestimmt, verschwindet das Problem. Die Vielfalt der Aktivitäten bleibt, aber sie ist nun eingebettet in eine gemeinsame Ausrichtung.
Übersetzt in den Alltag
Auch ohne yogische „Geistererschaffung“ kennst du die Situation:
- Du führst ein Projekt, hast verschiedene Teams oder Lebensbereiche, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben.
- Ohne ein zentrales Ziel oder eine innere Ausrichtung zerfasert alles.
- Sobald klar ist, welche Instanz (bei dir: deine innere Priorität, dein stilles „Warum“) die Leitung hat, können selbst völlig unterschiedliche Aktivitäten in einem größeren Sinn zusammenarbeiten.
💡 Mishras Kernpunkt:
Die Vielheit muss nicht verschwinden, um Einheit zu entstehen – sie braucht eine Instanz, die sie bündelt. Für den Yogi ist es der zentrale Geist. Für dich kann es die bewusste Rückkehr zu deinem innersten Kompass sein, mitten im Durcheinander deiner verschiedenen Rollen.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im Geist
Yoga Sutra I-17: Vollkommene Erkenntnis (Samprajnata) wird beim Durchlauf von Ahnung, Erfahrung, Freude und Einheitswahrnehmung [in der Meditation] gewonnen
Yoga Sutra II-6: ›Identifikation mit dem Ego‹ [= Asmita] basiert auf Identifikation des Sehenden mit dem Instrument des Sehens
Yoga Sutra III-13: Durch die transformierenden Prozesse erklären sich die Veränderungen in der Form, der Zeit und dem Zustand der Elemente und der Sinnesorgane
Yoga Sutra III-14: Frühere (śānta), momentane (udita) und zukünftige (avyapadeśya) Eigenheiten bzw. Beschaffenheiten (dharma) eines Objektes basieren auf einem grundlegenden Eigenschaftsträger (dharmin)
Yoga Sutra IV-1: Die außergewöhnlichen Kräfte (Siddhis) können von Geburt an bestehen oder durch Kräuter, Mantren, Selbstzucht/Askese oder Samadhi (tiefe Meditation) erlangt werden
Yoga Sutra IV-3: Das Wirken (sichtbare Ursachen, das Üben) setzt die natürlichen Abläufe nicht in Gang, es beseitigt aber die Hindernisse aus den Kanälen, ähnlich einem Bauern, der ein Hindernis entfernt und so Wasser auf seine Felder lässt

Schlusswort
Zum Abschluss sei gesagt: Yogasutra 4.5 lässt sich nicht in einem einzigen endgültigen „So ist es!“ erklären – und genau darin liegt sein Wert. Es regt uns an, mit dem Geist tiefer zu tauchen. Ob man es nun als Beschreibung einer yogischen Siddhi (Fähigkeit) liest oder als Hinweis auf metaphysische Einheit, oder als psychologische Wahrheit über unser Innenleben: in jedem Fall fordert es uns subtil auf, über die Begrenzung unseres kleinen Geistes hinauszuwachsen. Die alten Meister kommentierten es mit einer Mischung aus Rationalität und Mystik – und wir heutigen können es mit moderner Wissenschaft und eigener Erfahrung ergänzen. Am Ende aber geht nichts über die Praxis: Patanjali würde wohl sagen, anstatt nur darüber zu lesen, setze dich hin, komme zur Ruhe – und erfahre selbst, was es bedeutet, dass alle Geister Bewegungen des einen Geistes sind. Yoga ist der Weg dorthin, die Einheit zu fühlen statt nur darüber zu philosophieren.
So schließt sich der Kreis: Was als theoretische Aussage beginnt – „ein Bewusstsein lenkt die vielen Geister“ – wird zur ganz intimen Erkenntnis auf dem Kissen oder der Matte. Und vielleicht blickt man danach in die Augen eines anderen Menschen und spürt einen Hauch jener Wahrheit, die schon die alten Yogis in Worte fassten. In jedem Geist leuchtet dieselbe Bewusstheit, und die Vielfalt der Gedanken und Leben ist letztlich das kreative Spiel eines einzigen Bewusstseinsfeldes. Patanjali, die klassischen Kommentatoren und moderne Yogis scheinen sich darüber einig zu sein: Dies zu erkennen – besser noch, direkt zu erfahren – ist ein – oder der – Schlüssel zur Freiheit.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-5
Gemüt und Ego – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 4-6
Länge: 6 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Viele Bewusstseine schaffen – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.5
Länge: 8 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Viele Inkarnationen, ein unveränderliches Selbst: Asha Nayaswami (Class 63) zu Sutra 4.2 bis 4.6
Länge: 73 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


