Sada jnâtash chitta-vrittayas tat-prabhoh purushasyâparinâmitvât
सदाज्ञाताः चित्तव्र्त्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्
Weiter geht es mit yogischen Erkenntnissen zur Natur unseres denkenden Geistes (yogisch: Citta) und zu dessen Verhältnis zu dem, was wir wirklich sind – unserem Wahren Selbst, unserer Seele, auf yogisch: Purusha.
Sutra 4.18 erklärt, dass hinter all dem mentalen Durcheinander ein ruhiger Beobachter lebt. Dieser Artikel bietet Übersetzungen und Kommentare von Klassikern wie Vyāsa oder Vācaspati Miśra, sowie Brücken in die heutige Praxis, bis hin zu Einsichten aus Psychologie und Neurowissenschaft. Leserinnen und Leser finden auch Anregungen, wie sich die alte Weisheit im Alltag spüren lässt.
Kurz zusammengefasst
- Purusha (wahres Selbst)
Das unveränderliche Bewusstsein, der stille Zeuge aller mentalen Vorgänge. Purusha ist nicht wechselhaft wie der Geist, sondern bleibt konstant. - Citta (Geist)
Der wandelbare Spiegel, in dem Gedanken, Gefühle und Erinnerungen auftauchen. Ohne Purusha bliebe er unbemerkt. - Sutra 4.18
Alle Bewegungen des Geistes sind dem Purusha bekannt, weil er unveränderlich ist. Das macht ihn zum Garanten von stets präsentem Bewusstsein. - Vyāsa
Argumentiert: Wäre Purusha veränderlich, könnten Gedanken unbemerkt bleiben. Da das nicht so ist, muss es ein stabiles Zeugenbewusstsein geben. - Spätere Kommentatoren
Vācaspati Miśra und Vijñānabhikshu betonen, dass der Geist nie sein eigener Zeuge sein kann. Bhoja bringt poetische Bilder wie Sonne und Spiegel. - Moderne Stimmen
Lehrer und Forscher übertragen Purusha auf heutige Begriffe wie „Beobachter-Selbst“. Praktische Anleitungen reichen von Achtsamkeit bis „bewusster Schlaf“. - Wissenschaftliche Bezüge
Psychologie, Neurowissenschaften und Quantenphysik diskutieren bis heute Phänomene, die Purusha ähneln – etwa das „Selbst als Kontext“ oder die Rolle des Beobachters. - Praxis
Meditation und Alltag bieten Felder, um die Sutra zu üben: Abstand gewinnen, beobachten statt identifizieren, innere Unbewegtheit erleben.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Sada, sadâ = immer; jederzeit;
- Jnata, jnâtâh = bekannt; gewusst; das, was vom Wissenden gewusst wird; ist gewiss; erkennend;
- Citta = Verstand; Geist; Raum der Wahrnehmung; Bewusstheit; Bewusstsein;
- Vritti, vṛttayaḥ = Gedanken; Wellen; Modifikationen; Bewegungen; Fluktuationen;
- Citta-vrittayah = die Modifikationen/Bewegungen des Geistes; Gedanken; Fluktuationen und wiederkehrende Muster des Geistesfeldes;
- Tat = der, die das;
- Praboh, prabhu = Kontrolleur des Geistes; Herrscher; Quelle des Geistes (purusa); Meister; Gebieter; höhere Instanz;
- Tat-prabhoh, tat-prabhoḥ = von seinem Herrn/Gebieter;
- Purushasya = des Purushas; des wahren Selbst; der Seele; universelle Quelle des Bewusstsein;
- Aparinamitvat, aparinâmitvât = (infolge der) Unveränderlichkeit; gleichbleibend; unveränderlich; die Nicht-Veränderbarkeit;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Im vierten Kapitel des Yogasūtra, genannt Kaivalya Pāda, beschreibt Patañjali die Natur der übernatürlichen Kräfte (siddhis) und ihre Ursachen. Diese entstehen nicht nur aus disziplinierter Praxis des Yoga, sondern können auch durch Geburt, bestimmte Substanzen, Mantras oder Askese hervorgerufen werden. Zugleich betont er, dass diese Kräfte nicht das Ziel sind, sondern Nebenprodukte auf dem Weg zur Befreiung. Der eigentliche Zweck ist die vollkommene Loslösung des Geistes von allen Bindungen. In diesem Zusammenhang wird erklärt, dass das Bewusstsein stets von Eindrücken (saṃskāras) geprägt ist, und diese Eindrücke wiederum das Kontinuum der individuellen Persönlichkeit formen. Der Yogi erkennt, dass alle Handlungen und Erfahrungen Spuren hinterlassen, die sich in weiteren Gedanken und Taten manifestieren.
Bis Sutra 4.18 führt Patañjali aus, dass das Bewusstsein zwar wandelbar ist und sich durch verschiedene Prägungen ausdrückt, der innere Seher (puruṣa) jedoch unveränderlich bleibt. Alle Bewusstseinsinhalte sind für den puruṣa zugänglich – nichts bleibt dem inneren Seher verborgen. So macht der Text deutlich, dass die Vielfalt der mentalen Vorgänge nicht zufällig ist, sondern eine geordnete Kette von Ursachen und Wirkungen darstellt. Durch diese Einsicht kann der Übende erkennen, dass wahre Freiheit nicht im Spiel des Geistes liegt, sondern in der reinen Schau des puruṣa, der jenseits aller Veränderungen ist.
| Abschnitt | Hauptthema | Kernaussage |
|---|---|---|
| 4.1–4.6 | Ursprung der siddhis | Übernatürliche Kräfte können aus Geburt, Substanzen, Mantras, Askese oder Samādhi entstehen; sie sind Nebenprodukte und kein Ziel. |
| 4.7–4.11 | Rolle von Karma und Eindrücken (saṃskāras) | Handlungen hinterlassen Eindrücke, die das Bewusstsein prägen; beim Yogi ist Karma nicht mehr bindend, sondern durch Bewusstseinstransformation aufgehoben. |
| 4.12–4.15 | Zeit, Ursache und Wahrnehmung | Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beruhen auf Ursachenketten; Wahrnehmungen unterscheiden sich je nach mentaler Prägung. |
| 4.16–4.18 | Beziehung von Geist (citta) und puruṣa | Geist ist wandelbar und von Eindrücken bestimmt, der puruṣa bleibt unveränderlich und nimmt alle Bewusstseinsinhalte wahr. |

Wie der Wanderer über das Tal blickt, so schaut das wahre Selbst (Purusha) still auf die Bewegungen des Geistes – unverändert, gegenwärtig, zeugend.
Yogasutra 4.18 – Purusha als ewiger Beobachter des Geistes
Im Yoga-Sutra 4.18 beschreibt Patanjali eine zentrale Erkenntnis der Yogaphilosophie: Es gibt ein unveränderliches Bewusstsein hinter unserem Geist, und dieses Bewusstsein nimmt alle Vorgänge im Geist wahr. Eine mögliche Übersetzung lautet: „Herr des Bewusstseins ist das wahre Selbst (Purusha). Es kennt infolge seiner unveränderlichen Natur alle Vorgänge im Geist.“ Anders formuliert: Die Aktivitäten unseres Denkens – alle Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen – sind stets dem wahren Selbst bekannt, weil dieses wahre Selbst, Purusha, immer gegenwärtig und unbewegt ist. Unbewegt: also reines Bewusstsein, ohne Gefühlsschwankungen oder Gedanken.
Unser Geist hingegen, Citta, besteht aus Gefühlen, Gedanken, Prägungen usw. Purusha nimmt alle Bewegungen unseres Geistes wahr und ist auch bewusst, während wir schlafen, so die Lehre der alten Yogis zu Zeiten Patanjalis. Sukadev bezeichnet dies als die „Wahrnehmungstheorie“ von Raja-Yoga und Samkhya.
“Herr des Bewusstseins ist der Seher. Er ist unwandelbar und beständig und geht nie fehl.”
Iyengar, S. 307
Ebenfalls im Zusammenhang wichtig, so merkt Feuerstein an, dass unser individuelles Bewusstsein (Chitta) mit all den Gedanken und Gefühlen zu den wandelbaren (und vergehenden) Dingen der Natur gehört.
Patanjali hält uns damit gewissermaßen den Spiegel vor: Wir denken, wir seien unser Geist, doch in Wahrheit sind wir das gar nicht in unserer Essenz, denn da gibt eseinen tieferen Beobachter in uns, der allem geistigen Treiben zugrunde liegt.
Diese Aussage knüpft an das übergeordnete Ziel des Yoga an. Bereits zu Beginn der Sutras definiert Patanjali Yoga als das „Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen des Geistes“ (Sutra I-2). Warum? Damit der Sehende, unser wahres Selbst, in seiner eigenen Natur ruht (und sich erkennt, wir Frieden und Freiheit gefunden haben ...). Purusha also, das unbeeinflusste Bewusstsein. Alles Denken und Fühlen erscheint vor diesem Hintergrund wie Wolken, die am Himmel des Bewusstseins vorbeiziehen. Purusha ist der Himmel selbst: ruhig, unverändert, und alle Wolken werden darin sichtbar. So betrachtet ist es nicht der Geist, der sich selbst erleuchtet, sondern das Bewusstsein leuchtet durch den Geist hindurch, sobald dieser klar genug ist.
Welche Erfahrungen hast du in der Meditation schon gemacht?
Schlüsselbegriffe: Purusha, Citta und Co. erklärt
Damit wir uns dem Verständnis der Sutra weiter nähern, werfen wir einen Blick auf die Schlüsselbegriffe und Konzepte:
- Purusha – wörtlich der Mensch/der Geistige: In der Samkhya- und Yoga-Philosophie bezeichnet Purusha das wahre Selbst oder reine Bewusstsein. Es ist unveränderlich, ewig und passiv. Purusha ist der Beobachter, das Prinzip in uns, das alles wahrnimmt, ohne selbst zu handeln. Man kann es auch die Seele oder den inneren Zeugen nennen. Patanjali beschreibt Purusha als “reines, zeitloses und unbegrenztes Bewusstsein, das immer präsent und immer gewahr ist”. In unserer Sutra ist Purusha der „Herr“ bzw. Meister des Geistes – übergeordnet, tragend und zeugend zugleich. Wichtig: Purusha ist nicht etwas, das man mit den Sinnen greifen könnte; es ist das Subjekt aller Erfahrung.
- Citta – meist übersetzt als Geist, Verstand oder Psyche: Damit ist das gesamte mentale Instrument gemeint – also Intellekt (Buddhi), Ego-Gefühl (Ahamkara) und Denkvermögen (Manas). Citta umfasst all unsere Gedanken, Emotionen, Erinnerungen und Wahrnehmungen. In der deutschen Übersetzung oben wurde dafür das Wort „Geist“ genutzt. Dieser Geist ist laut Yoga-Sutra ein Teil der materiellen Natur (Prakriti); er besteht aus feinstofflicher Materie (den drei Gunas) und ist veränderlich. Man könnte sagen, Citta ist wie ein Spiegel, der die Lichter und Schatten der Welt reflektiert – aber er hat kein eigenes Licht. Genau das betont Patanjali: Der Geist leuchtet nicht aus sich selbst heraus, er ist nicht selbst-bewusst im wörtlichen Sinne. Er wird erst bewusst, wenn das Licht des Purusha darauf fällt. Daher heißt es in Sutra 4.19 (dem Folgevers): „Der Geist ist nicht selbst-erleuchtend, da er ein Objekt der Wahrnehmung durch das Bewusstsein ist“.
- Vrittis – übersetzt als Regungen, Fluktuationen, Wellen oder Aktivitäten des Geistes: Damit sind die Bewusstseinsinhalte gemeint, all die Gedankenwellen und Gemütsbewegungen, die im Meer des Citta auftauchen. In Yoga-Sutra 1.2 definiert Patanjali Yoga als das Zur-Ruhe-Bringen ebendieser Vrittis. Hier in 4.18 sagt er nun: Diese mentalen Wellen sind immer bekannt – und zwar dem Purusha. Man könnte auch sagen: Jede Gedankenwelle spiegelt sich im Bewusstseins-Ozean des Purusha wider. Nichts, was in unserem Innenleben auftaucht, bleibt letztlich unbemerkt von diesem höheren Selbst. Selbst unbewusste Vorgänge im gewöhnlichen Sinne (etwa tief verborgene Gefühle oder Erinnerungen) liegen aus Sicht des Purusha im Licht. „Keine mentale Regung bleibt manchmal bekannt und manchmal unbekannt – alle sind ausnahmslos im Bewusstsein wahrnehmbar“, dem Purusha bekannt, betont ein klassischer Kommentar. Das klingt fast unglaublich, aber gemeint ist: Auch wenn wir (als Ego oder Alltagsbewusstsein) etwas nicht bemerken, so ist doch das Selbst als Zeugendes immer im Bilde.
- Apariṇāmitva – Unveränderlichkeit: Dieses sperrige Sanskritwort beschreibt die Natur des Purusha. Purusha wandelt sich nicht, im Gegensatz zum Geist, der stetig Veränderungen (pariṇāma) unterworfen ist. Weil Purusha unbewegt und ewig gleich bleibt, kann er als konstanter Zeuge fungieren. Wäre Purusha selbst veränderlich, so argumentieren die Yogis, dann könnten ihm manche Vorgänge entgehen – denn er wäre mal bewusst, mal unbewusst. Genau das schließt Patanjali aus: Purusha ist immer bewusst, daher gehen keine Informationen verloren. Dieses unveränderliche Bewusstsein ist quasi die Grundlage dafür, dass es so etwas wie kontinuierliches Gewahrsein gibt.
- Tat-prabhuḥ – „dessen Herr“: Im Sutra-Text heißt es wörtlich: „Die Bewegungen des Geistes (citta-vrittayaḥ) sind immer bekannt (sadā jñātāḥ) durch dessen Herrn (tat-prabhuḥ), [nämlich] Purusha, aufgrund von dessen Unveränderlichkeit.“ Purusha wird also als Herr des Geistes bezeichnet. Das impliziert nicht, dass Purusha den Geist aktiv steuert wie ein Puppenspieler; eher ist gemeint, Purusha ist der übergeordnete Prinzipal, das Selbst, dem der Geist gewissermaßen „dient“. In vielen Kommentaren wird erläutert, Purusha sei übergeordnet, tragend und kontrollierend gegenüber dem Geist. Ähnlich wie das Licht einer Lampe die Existenz der Objekte im Raum erst sichtbar macht, so „beherrscht“ Purushas Bewusstsein den Geist, indem es ihn durchdringt und erhellt. (Nebenbei: Patanjali verwendet hier Singular – er spricht von dem Purusha. In der klassischen Samkhya-Philosophie gibt es hingegen viele Purushas, für jedes Wesen einen. Kommentatoren diskutieren an solchen Stellen, ob Patanjali vielleicht doch auf einen einzigen universellen Purusha anspielt oder einfach exemplarisch spricht. Manche Interpretationen setzen Purusha hier auch mit Ishvara (Gott) gleich, da Ishvara im Yoga-Sutra als besonderer Purusha vorgestellt wird. Die gängigere Auffassung ist jedoch, dass hier der individuelle Purusha jedes Einzelnen gemeint ist, der als innere Göttlichkeit den Geist belebt.)
Zusammengefasst: Purusha ist das unveränderliche Licht des Bewusstseins, Citta der wandelbare Spiegel bzw. der mentale Apparat, und die Vrittis sind die Spiegelungen darin. Sutra 4.18 sagt aus, dass das Licht immer auf den Spiegel scheint – jeder Fleck und jede Bewegung auf der Spiegeloberfläche sind im Licht offenbar.
Klassische Kommentare: Alte Meister über Purusha und den Geist
Die alten Yoga-Meister haben Patanjalis knappen Sutra mit ausführlichen Kommentaren versehen. Schauen wir, was einige klassische Kommentare zu Sutra 4.18 betonen – und wo sie unterschiedliche Nuancen setzen:
- Vyāsa (5. Jh. n. Chr.) – der Urautor des Yoga-Bhāṣya: Vyasa ist der traditionelle Hauptkommentator der Yoga-Sutras. In seinem Kommentar zu 4.18 erklärt er sinngemäß: Weil Purusha unveränderlich ist, entgeht ihm keine Regung des Geistes. Purusha ist immer der Sehende, nie „offline“. Wäre Purusha wechselhaft wie der Geist, dann wäre er manchmal sehend, manchmal nicht-sehend – was jedoch nicht der Fall ist. Also folgert Vyasa: Purushas Unwandelbarkeit bedeutet ewiges Gewahrsein, und dank dieses ewigen Gewahrseins sind alle Gedanken und Gefühle dem Selbst stets bekannt. Er untermauert dies mit Logik: Wir erinnern uns an mentale Vorgänge als etwas, das direkt erfahren wurde (so klar wie ein externer Gegenstand, z. B. ein Ton oder ein Bild) und nicht bloß indirekt durch Schlussfolgerung. Kein Gedanke bleibt völlig unsicher oder ungewiss in unserer Erfahrung – selbst wenn er vage ist, wissen wir dass da ein Gedanke war. Das ist nur erklärbar, weil ein unveränderliches Bewusstsein im Hintergrund jeden Gedanken direkt beleuchtet. Vyasa vergleicht Purusha mit einem Licht, das die Inhalte des Geistes erhellt. Gäbe es Momente, in denen ein Gedanke gar nie vom Licht erfasst wird, wäre er wie ein Gegenstand im Dunkeln – niemals wirklich „gewusst“. Doch „nicht einmal einer der mentalen Vorgänge ist jemals unbekannt; sie sind ausnahmslos nichts als bekannt“ schreibt Vyasa deutlich. Damit ist Purusha als allgegenwärtiger Zeuge etabliert.
- Vācaspati Miśra (9. Jh.) und Vijñāna Bhikṣu (16. Jh.) – vertiefende indische Kommentare: Spätere Gelehrte wie Vachaspati (Autor der Tattva-Vaiśāradī) und Vijnana Bhikshu (Yoga-Vārttika) griffen Vyasas Interpretation auf und verteidigten sie gegen philosophische Einwände. Ein typischer Diskurs dieser Kommentatoren: Braucht es wirklich einen Purusha als Zeugen, könnte nicht der Geist sich selbst erkennen? Die Gegner (darunter buddhistische Denker jener Zeit) meinten, das Bewusstsein sei vielleicht selbstleuchtend – so wie eine Kerze sowohl andere Objekte beleuchtet als auch sich selbst sichtbar macht. Warum also ein extra „Purusha“ annehmen? Vācaspati Miśra hält dagegen: Der Geist ist nie sein eigener Zeuge, denn er ist in jedem Moment ein Objekt vor dem Purusha. Er argumentiert sinngemäß: „Kein mentaler Prozess kann auftreten, ohne vom Selbst unmittelbar wahrgenommen zu werden.“ Wäre dem anders, dann hätten wir in unserem Inneren dieselbe Ungewissheit wie bei äußeren Dingen – manches bekämen wir mit, manches nicht. Doch dem ist nicht so: In unserem Bewusstsein findet sich nicht plötzlich ein blinder Fleck, in dem eine Gedankenwelle völlig unsichtbar bleibt. Vijnana Bhikshu ergänzt: Wenn man postuliert, der Geist leuchte sich selbst, gerät man in ein endloses Regress – dann bräuchte man einen zweiten Geist, der den ersten beleuchtet, und einen dritten für den zweiten und so fort. Dies führt zu Absurditäten („ein endloses und absurdes Fortschreiten von Erkenntnissen“). Daher muss es ein einziges Bewusstsein geben, das allem Erkennen zugrunde liegt, aber selbst unverändert bleibt. Genau das ist Purusha. Interessant am Rande: In solchen Diskussionen kamen auch verschiedene Schulen ins Spiel – etwa Vertreter des Buddhismus, die eher die Selbstleuchtkraft des Geistes betonten, während die Yogis hier eine vom Geist getrennte Seher-Instanz behaupten. Die klassischen Yoga-Kommentatoren waren sich jedoch in der Mehrheit einig mit Patanjali: Der Geist ist letztlich drishya (ein Objekt), Purusha allein ist drashta (der Sehende).
- Bhoja (11. Jh.) – der königliche Kommentator: König Bhoja, ein weiterer bekannter Erläuterer der Yoga-Sutras, beschreibt in seinem Werk Rajamartanda den Purusha poetisch als Sonnenlicht, das auf den Geist fällt. Jede Modifikation des Geistes wird durch dieses Licht offenkundig – so wie Farben erst unter Sonnenstrahlen sichtbar werden. Bhoja betont auch, dass Purusha unberührt bleibt von den Schwankungen: Er kennt zwar alle Gedanken, identifiziert sich aber mit keinem. Sein Kommentar unterstreicht damit die Leidfreiheit und Unberührtheit des Purusha – ein Gedanke, der in der letzten Sutra 4.34 (Kaivalya) vollendet wird: Purusha bleibt frei, egal was in Prakriti (der Natur, inkl. Geist) vor sich geht.
Man könnte einzelne Stationen dieser Kommentierungen so punktuell darstellen:
| Station / Kommentator (Name) | Zeit (Jh.) | Kurzes Zitat (sinngemäß) | Heutige Übertragung (in klarer Sprache) | Vorteil (historische Tiefe) |
|---|---|---|---|---|
| Vyāsa (Yoga-Bhāṣya) | 5 | „Weil **Purusha** unveränderlich ist, bleibt ihm **keine** Regung des Geistes verborgen.“ | Bewusstsein ist wie ein konstanter Beobachter: Jede Gedankenwelle wird gesehen – auch wenn du sie im Alltag übersiehst. | Grundlage der klassischen Auslegung; verankert 4.18 in strenger Logik (Zeuge ≠ Geist). |
| Vācaspati Miśra (Tattva-Vaiśāradī) | 9 | „Der Geist ist **nie** sein eigener Zeuge; er steht **immer** vor Purusha als Objekt.“ | Du bist nicht „dein Denken“. Denken erscheint vor dir – wie ein Film vor dem Zuschauer. | Vertieft Vyāsas Linie und kontert Selbst-Leucht-Einwände (buddhistische Debatte). |
| Bhoja (Rājamārtaṇḍa) | 11 | „**Purusha** ist wie die Sonne; der Geist zeigt seine Farben nur im Licht des Sehers.“ | Poetisches Bild für Praxis: Du musst den Geist nicht „wahrnehmbar machen“ – lass ihn im Licht des Gewahrseins sichtbar werden. | Bringt anschauliche Metaphern, macht die Lehre lehrbar und merkfähig. |
| Vijñānabhikṣu (Yoga-Vārttika) | 16 | „Ohne Purusha gäbe es einen **unendlichen Regress** des Erkennens.“ | Es braucht einen stillen „Endpunkt“: das Bewusstsein, das alles erkennt, ohne selbst Objekt zu werden. | Systematisch-philosophischer Versuch der Absicherung gegen logische Endlos-Ketten. |
| Moderne Kommentatoren (z. B. Edwin Bryant, Georg Feuerstein, Philipp Maas) | 20 | „**Purusha** = **Zeugenbewusstsein**; Übung: identifiziere dich mit dem Beobachter, nicht mit den Inhalten.“ | Alltagstauglich: Zwei Atemzüge Abstand, dann sehen: „Da ist ein Gedanke, da ist Wut – und hier ist das ruhige Sehen.“ | Verbindet Sanskrit-Überlieferung mit Praxis, Philologie und moderner Forschung (z. B. Achtsamkeit, „witnessing“). |
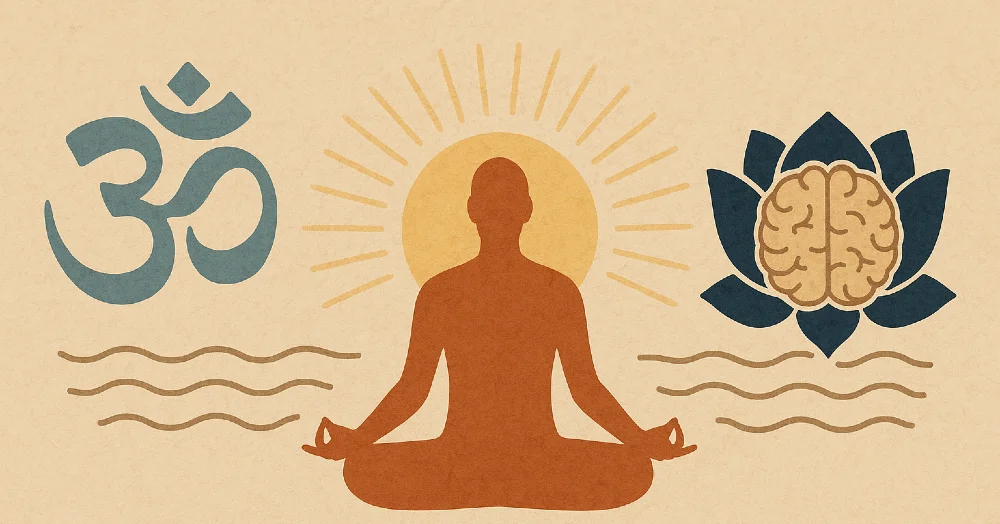
Unterschiedliche Perspektiven: Samkhya-Dualismus vs. Vedanta-Nondualismus
Patanjalis Lehre fußt auf der Samkhya-Philosophie, die dualistisch ist. Das heißt, sie trennt zwischen Purusha (Bewusstsein) und Prakriti (Materie/Natur, zu der auch der Geist zählt). In unserem Sutra sehen wir genau diese Trennung: Hier Bewusstsein, dort Geist.
Advaita Vedanta – eine andere große philosophische Richtung Indiens – würde dem teilweise widersprechen. Advaita ist nondual und sagt: Es gibt letztlich nur eine Wirklichkeit (Brahman/Atman); die Unterscheidung in Zeuge und Gesehenes ist relativ. Der bedeutendste Vertreter dieser Philosophie ist Shankara, der zwischen 788 und 820 n. Chr. lebte. Ein Advaita-Kommentator würde Sutra 4.18 vielleicht so interpretieren: Das „wahre Selbst“ (Atman = Purusha) ist das einzige Reale; der Geist und seine Vorgänge sind Erscheinungen in diesem einen Bewusstsein.
In Shankaras Sichtweise ist die Welt zwar nicht illusorisch, aber sie ist nur relativ real, ein Produkt von Maya (Illusion oder Unwissenheit), die das Unveränderliche Brahman als veränderliche Welt erscheinen lässt. Für Shankara ist die individuelle Seele (Jiva) nur relativ real, und ihre Individualität besteht nur so lange, wie sie durch Maya beeinflusst wird.
Samkhya hingegen, und damit Patanjali, sagt: Purusha und Prakriti sind beide eigenständige Prinzipien. Purusha beobachtet Prakriti, aber vermischt sich nie damit. Die Befreiung (Kaivalya) im Yoga Sutra wird erreicht, indem man die wahre Natur des Purusha erkennt und sich von der Identifikation mit Prakriti löst.
Klassische Yogakommentare aus der Samkhya-Tradition betonen also die Zwei-Ebenen-Theorie: Auf der einen Seite das neutrale beobachtende Gewahrsein (Purusha), auf der anderen der wandelbare Geist mit all seinen Erfahrungen. Im Vedanta dagegen würde man hervorheben: In der höchsten Verwirklichung fallen sogar diese zwei auseinandergehaltenen Ebenen in der Erfahrung der Einheit zusammen – der Beobachter erkennt sich selbst im Beobachteten.
Patanjali bleibt jedoch innerhalb der dualen Sicht und lehrt die Befreiung als Trennung (kaivalya) des Bewusstseins von der Materie. Das spiegelt sich auch hier: Purusha als Beobachter, Citta als beobachtetes Objekt. Diese Unterscheidung ist der Kern der Unterscheidungskraft (viveka), die Yogis üben – das klare Erkennen: „Ich bin der Sehende, nicht das Gesehene.“
Ein gemeinsames Ziel?
Dennoch scheint der yogische Weg von einem gewissen Standpunkt aus ganz gut zur advaitischen Metaphysik zu passen. Im Samadhi verlieren wir die dualistische Subjekt-Objekt-Sichtweise und werden eins mit dem Meditationsobjekt. Doch diese nicht-dualistische Erfahrung ist im Yoga (Savikalpa Samadhi) nur „vorübergehend“. Finales Ziel von Patanjalis Yogasutras ist ist die Unterscheidung des reinen Bewusstseins von all den Objekten, mit denen es sich identifiziert. Die Seele ruht in ihrer wahren Natur – reinem Bewusstsein (Nirvikalpa Samadhi) oder auch “Samadhi ohne Dualität”. Diese Erfahrung kann auch gut mit dem advaitischen Ziel „das gesamte Universum als das Selbst zu erkennen“ verglichen werden.
Wie siehst du das Verhältnis der Lehren von Advaita Vedanta und Yogasutra?
Ergänzend: Die Sichtweise im Buddhismus
Die buddhistische Philosophie weicht in einigen Punkten zumindest graduell von der Lehre im Yogasutra ab. Ein unveränderliches, ewig bestehendes und individuelles wahres Selbst wie das Purusha gibt es im Buddhismus nicht. Dennoch ist in gewissem Sinne ein ähnliches, erkennendes Bewusstsein im Spiel. Dessen Erkenntnis und Pflege führt zur Erleuchtung. Wim van den Dungen erläutert dies anschaulich in seinem Kommentar zu dieser Sutra: „Tatsächlich ist das Erkennen dieses Wurzelbewusstseins oder des sehr subtilen Geistes des klaren Lichts, der Vereinigung von Glückseligkeit und Leerheit, und das vollständige Ruhen in dieser Erkenntnis (indem man sich ihr vollständig und von ganzem Herzen hingibt), das Erwachen, die Buddhaschaft. Die Natur ist in keiner Weise ein fundamentales Hindernis, sondern lediglich eine relative Ablenkung, mit der man umgehen muss, indem man rechte Entsagung praktiziert, Bodhicitta erzeugt und über die Leerheit meditiert (bis zu dem Punkt, an dem man sie tatsächlich „sieht“, d.h. das riesige Netzwerk des abhängigen Entstehens, das sogenannte „Netz von Indra“, wahrnimmt).”

Moderne Kommentare und Auslegungen von Sutra 4.18
Neben den klassischen Auslegern aus dem Sanskrit gab und gibt es zahlreiche moderne Kommentare zum Yoga-Sutra – von indischen Gurus, westlichen Gelehrten bis hin zu Yoga-Praktizierenden von heute. Sie alle versuchen, Patanjalis zeitlose Weisheit in verständliche Worte und heutige Konzepte zu kleiden. Für Sutra 4.18 finden sich in modernen Schriften vor allem folgende Gedanken:
- „Du bist nicht dein Geist“ – Diese Essenz formulieren viele heutige Lehrer immer wieder. So erklärt etwa Yoga-Lehrer Jaganath Carrera: Wir identifizieren uns normalerweise so sehr mit unserem Denken, dass wir vergessen, wer dahintersteht. Patanjali erinnert uns daran, dass es etwas jenseits des Geistes gibt – genannt Purusha – „das nicht den Verrücktheiten des Geistes unterworfen ist“. Eine Kommentatorin fasst Sutra 4.18 so zusammen: „Die Veränderungen des Geistes werden stets vom unveränderlichen Purusha, dem Herrn, erkannt.“ Purusha wird hier als Wahrheit beschrieben – die unveränderliche Wahrheit unseres Wesenskerns, die all die mentalen Schwankungen kennt, aber davon unberührt bleibt. Selbst wenn Gedanken chaotisch kreisen oder Emotionen hochkochen, gibt es in uns diese stille Instanz, die bemerkt: Aha, da ist Wut; da ist ein Gedanke; da ist Schmerz. Moderne Lehrer laden Übende ein, genau das zu erfahren: eine innere Distanz zu den eigenen Gedanken und Gefühlen aufzubauen, um den wahren Kern freizulegen. Es geht also nicht nur um philosophisches Verständnis, sondern um eine sehr praktische Veränderung der Perspektive – weg von „Ich bin wütend“ hin zu „In mir wird Wut beobachtet“.
- Osho – der provokative Mystiker – interpretiert Sutra 4.18 auf seine unnachahmliche Weise: Er rät uns, in allen Tätigkeiten dieses ewige Prinzip im Hintergrund wachzuhalten. „Der Geist verändert sich ständig, aber etwas in dir ist ewig und schaut zu,“ sagt er. Wenn du dir dieses ewigen Zuschauers bewusst wirst, dann – so Osho – beginnen sich sogar Freude und Leid von dir zu distanzieren. Man ist nicht mehr überwältigt von Glück oder Unglück; beides wird gesehen wie Wolken am Himmel, die kommen und gehen. Dieses bewusste Verankern im beobachtenden Selbst nennt Osho (und die Yogatradition) Viveka, die Unterscheidungskraft. Mit feiner Ironie könnte man sagen: Wir alle sind ein bisschen wie Zuschauer im Kino, die den Film ihres eigenen Geistes schauen. Normalerweise sind wir aber so in den Film vertieft, dass wir vergessen, im Kinosessel zu sitzen. Patanjali – und Osho erinnert uns – laden uns ein, uns zurückzulehnen und bewusst der Zuschauer zu sein. Dann verliert das Drama auf der Leinwand an Macht über uns. Diese Haltung findet sich auch in modernen Achtsamkeits- und Meditationstechniken wieder.
Das Denken an sich wird dann zum beobachteten Phänomen.
- Alltagsbezug und Praxisnähe: Obwohl es hier um ein abstraktes Konzept geht, betonen viele moderne Kommentatoren die praktische Bedeutung für unser tägliches Leben und die Meditationspraxis. Swami Jnaneshvara, ein zeitgenössischer Vertreter der himalayanischen Tradition, schreibt beispielsweise, Sutra 4.18 sei nicht bloße Philosophie, sondern Teil der feinsten Meditationspraxis. Was meint er damit? In der Meditation kann man tatsächlich Schritt für Schritt erleben, was es heißt, dass der Geist ein Objekt und Purusha der Zeuge ist. Anfangs lernt der Übende, einzelne Gedanken zu beobachten und loszulassen – das sind die „groben“ Vrittis, die man kommen und gehen sieht. Aber irgendwann, in tiefer Stille, kann es geschehen, dass man sogar den Geist als Ganzes von außen betrachtet. Das Denken an sich wird dann zum beobachteten Phänomen. Swami J. beschreibt es so: Schließlich sieht der Yogi den Geist wie einen Gegenstand, den er mit Nicht-Anhaftung beiseite stellen kann, um direkt das reine Bewusstsein zu erfahren. Das ist ein höchst praxisnaher Rat: Yoga zielt darauf, diesen beobachtenden Abstand zu kultivieren.
Im Alltag bedeutet das z. B.: Wenn Angst aufsteigt, nimm wahr „Da ist Angst“, statt dich mit „Ich habe Angst, ich bin die Angst“ zu identifizieren. Durch diese innere Haltung verliert die mentale Aktivität ihren absoluten Ernst – man erkennt eine gewisse Leichtigkeit oder gar Humor in dem Spiel der Gedanken.
Einige moderne Autoren vergleichen Purusha mit dem Himmel und die Gedanken mit dem Wetter: Der Himmel lächelt auch über Sturm und Regen, er bleibt unberührt blau dahinter. Dieses Bild hilft Praktizierenden, sich mit dem Himmel-Bewusstsein zu identifizieren, statt mit den Wetterlaunen des Geistes.
Aber irgendwann, in tiefer Stille, kann es geschehen, dass man sogar den Geist als Ganzes von außen betrachtet.
- „Der Geist dient dem Purusha“ – Ein weiterer Punkt heutiger Interpretationen ist die Idee, dass unser ganzes mentales Wesen letztlich dafür da ist, dem wahren Selbst zu dienen. Patanjali sagt an anderer Stelle, der Geist existiert „für einen Anderen“ (parartham) – nämlich für Purusha (vgl. YS 2.21). Modern ausgedrückt: Unser Intellekt, unser Ego, selbst unsere Sinne – sie alle sollen dem höheren Selbst Erfahrungen liefern, aus denen es lernt und schließlich zur Befreiung gelangt. Man könnte es so formulieren: „Der Geist existiert, um Purusha zu dienen, indem er ihm die Welt erfahrbar macht“. Purusha selbst bleibt dabei der stille Chef im Hintergrund. Sobald der Geist seine Aufgabe – genug Erfahrungen zu sammeln und schließlich Unterscheidungskraft (viveka-khyati) zu entwickeln – erfüllt hat, kann er zur Ruhe kommen. Dann „hat der Geist sein Ziel erreicht“ und kehrt in die Stille zurück, während Purusha in seiner vollen Pracht strahlt (das ist das finale Ziel Kaivalya). Für uns heißt das: Wir müssen den Geist nicht bekämpfen oder komplett auslöschen; wir wollen ihn läutern und ausrichten, bis er durchsichtig wird wie ein klarer See, in dem sich der Mond (Purusha) spiegelt.
In dem Moment, wo der Geist vollkommen ruhig ist, erkennt Purusha sich selbst in diesem Spiegel – Selbstrealisation tritt ein.
Zusammengefasst mahnen uns moderne Auslegungen, die Lehre von Purusha als Beobachter ganz konkret umzusetzen: in Meditation, in der Art, wie wir mit unseren Gedanken umgehen, und wie wir unsere Identität definieren. Wir sind – so die Botschaft – viel mehr als das rastlose Köpfchen, das uns den ganzen Tag vollquatscht. Es gibt da diese tiefe stille Bewusstheit, unser eigentliches Wesen.
Übrigens decken heutige Wissenschaften und therapeutische Methoden diesen Punkt auf ihre Weise: In der Psychologie etwa fördert die Achtsamkeitspraxis genau das beschriebene Phänomen – man übt, die eigenen Gedanken nur zu beobachten, statt sich mit ihnen zu identifizieren. In Ansätzen wie der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) spricht man vom „Selbst als Kontext“ oder Beobachter-Selbst, das man stärken kann, um psychisches Leid zu lindern. Patanjalis Sutra aus der Antike findet also in moderner Psychologie ein praktisches Echo.

Wissenschaftliche und philosophische Bezüge von Sutra 4.18
Spannend ist, dass auch aktuelle Wissenschaften – von der Hirnforschung bis zur Quantenphysik – Aspekte liefern, die Patanjalis alte Weisheit stützen. Natürlich bewegen wir uns hier teils im hypothetischen Bereich, aber die Parallelen sind bemerkenswert:
- Kognitionswissenschaft und Neuropsychologie: Die Erforschung des Bewusstseins stößt bis heute an Grenzen – das sogenannte „harte Problem“ (Warum gibt es subjektives Erleben?) ist ungelöst. Einige Forscher blicken daher auf alte Meditationstraditionen, um das Rätsel anzugehen. Interessanterweise haben zeitgenössische Wissenschaftler begonnen, das Samkhya-Modell zu studieren, auf dem die Yoga-Sutras beruhen. In einem wissenschaftlichen Artikel wird z. B. das folgende Modell beschrieben:
Es gibt zwei grundlegende „Essensen“ im Universum –
(1) ein Grund-Bewusstsein, genannt Purusha, das als zeugenhaftes Bewusstsein fungiert (ohne selbst mentale Aktivität zu besitzen), und
(2) eine aktive Energie namens Prakriti, welche die mentale und materielle Aktivität antreibt.
Das entspricht genau Patanjalis Darstellung! Die Autoren erklären weiter: Purusha steht dafür, dass es überhaupt Bewusstsein gibt, während Prakriti für die Inhalte der Erfahrung sorgt. Als Metapher wird das gern so veranschaulicht: Purusha ist das Licht, das einen Raum erhellt, Prakriti sind die Objekte, die im Raum erscheinen. Diese Gegenüberstellung erinnert stark an die Lampen-Analogie der klassischen Kommentatoren. - Auch die Meditationserfahrung des „Zeugen-Bewusstseins“ – also ein Zustand, in dem man nur noch Bewusstsein als solches erlebt ohne ein spezifisches Objekt – wird wissenschaftlich untersucht. Neurowissenschaftler haben etwa langjährige Meditierende in Gehirnscanner gelegt und sogenannte nonduale Zustände oder reines Gewahrsein analysiert. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich im Gehirn tatsächlich etwas verändert, wenn die Subjekt-Objekt-Trennung wegfällt – manche Bereiche der Selbstwahrnehmung treten zurück, während ein Gefühl von Raumeinheit bestehen bleibt. Könnte man sagen, hier „beobachtet Purusha den Geist“? Die Wissenschaft würde es anders formulieren, aber das Phänomen ähnelt dem, was Yogis seit Jahrtausenden berichten.
- Bewusstseinsforschung und Erfahrungsberichte: Eine besonders faszinierende Bestätigung von Patanjalis Behauptung kommt aus der Schlaf- und Traumforschung. Normalerweise ist in tiefem Schlaf das bewusste Erleben weg – der Geist ruht, und wir merken uns nichts. Doch es gibt Berichte von Meditierenden, die selbst im Tiefschlaf bei vollem Bewusstsein bleiben, als stiller Zeuge des Schlafs. Dieses Phänomen nennt man „witnessing sleep“ – beobachteter Schlaf. In Studien mit Transzendentaler Meditation fand man z. B., dass einige Übende während des Tiefschlafs Alpha-Wellen im EEG zeigten und hinterher klar aussagen konnten, sie seien sich des Schlafs bewusst gewesen. „Eine friedliche innere Wachheit, sogar im Tiefschlaf“ – so werden diese Berichte beschrieben. Die Probanden fühlten sich wie ein unbeteiligter Beobachter, grenzenlos und still, während Körper und Geist ruhten. Genau das würde man erwarten, wenn Patanjalis Sutra wörtlich stimmt: Purusha, der unveränderliche Zeuge, leuchtet auch dann, wenn der Geist völlig abgeschaltet ist. Dass solche Erfahrungen möglich sind, stützt die Idee eines vom Gehirn unbeeinflussten Gewahrseins. Natürlich sind dies besondere Fälle und noch keine Allgemeinwissenschaft, aber sie zeigen: Bewusstsein muss nicht erlöschen, nur weil der mentale Apparat pausiert.
Viele Upanishaden (spirituelle Schriften Indiens) sagen sinngemäß dasselbe: Im Tiefschlaf existiert Glückseligkeit und Bewusstsein ohne Traum – man erinnert sich nur nicht als gewöhnlicher Mensch, aber das Selbst erfährt Frieden. Die moderne Forschung tastet sich hier eventuell an uraltes Wissen heran. - Physik und der bewusste Beobachter: In der Quantenphysik gibt es das berühmte Rätsel des Beobachters. Einige der Begründer der Quantenmechanik – u. a. Niels Bohr, Werner Heisenberg, John von Neumann und Eugene Wigner – vertraten die Auffassung, dass ein quantenphysikalischer Messvorgang ohne einen bewussten Beobachter nicht vollständig beschrieben werden kann. Vereinfacht: Das Bewusstsein des Experimentators spielt eine entscheidende Rolle beim „Kollaps der Wellenfunktion“ (dem Übergang vom unbestimmten Quantenzustand zur gemessenen Realität). Diese Haltung („consciousness causes collapse“) ist heute zwar umstritten und wird von anderen Physikern abgelehnt, aber der Gedanke selbst ist verblüffend: Bewusstsein als fundamental – fast wie Purusha, das zur Existenz der Welt beiträgt, indem es sie wahrnimmt bzw. beleuchtet. Eugene Wigner, ein Nobelpreisträger, ging sogar so weit zu sagen, dass die Dualität von Geist und Materie respektiert werden müsse: Der Geist sei nichtmateriell und beeinflusse doch die Materie. Hier klingt Samkhya in moderner Sprache an. Manche interpretieren quantenphysikalische Phänomene so, dass das Universum ohne Bewusstsein „unsauber“ bleibt, erst der Beobachter schafft konkrete Realitäten. Das mag spekulativ sein, doch es ist ein faszinierender Schulterschluss von moderner Physik und spiritueller Philosophie: Die Rolle des Beobachters wird auch in der Physik als wesentlich erkannt – wenn auch auf andere Art. Selbst wenn die Mehrheit der Wissenschaftler heute andere Erklärungen bevorzugt, bleibt die Frage: Was ist Bewusstsein und warum ist es da? – und diese Frage führt vielleicht zu dem, was Patanjali Purusha nennt.
- Philosophie und Geist: Westliche Philosophen haben Konzepte entwickelt, die an Purusha erinnern. René Descartes sprach vom res cogitans (dem denkenden Ding) getrennt von der res extensa (Materie) – er trennte zwar nicht Beobachter und Denken, aber legte den Grundstein für Geist-Materie-Dualismus. Im 20. Jahrhundert haben Phänomenologen wie Edmund Husserl die Idee des reinen Bewusstseinsstroms untersucht, und Thomas Nagel fragte berühmt „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“ – womit er auf die Unfassbarkeit subjektiven Erlebens für Außenstehende hinwies.
Einige moderne Philosophen wie David Chalmers ziehen in Betracht, dass Bewusstsein eine grundlegende Eigenschaft des Universums sein könnte (Panpsychismus), weil es sich nicht auf Hirnprozesse reduzieren lässt. Das alles sind keine direkten Beweise für Purusha, aber sie zeigen: Es gibt einen Aspekt an unserer Existenz – das subjektive Ich-Bewusstsein – der sich bislang jeder vollständigen materiellen Erklärung entzieht. Patanjali gibt diesem Mysterium einen Namen und einen Platz im Weltbild. Er liefert quasi eine Landkarte: Hier das Bewusstsein (Purusha), dort die Natur samt Gehirn und Geist (Prakriti), und so interagieren sie. Auch wenn die Sprache anders ist, suchen moderne Denker letztlich nach dem, was die Yogis schon lange kennen: dem unveränderlichen Selbst, das Grundlage aller Erfahrung ist.
Zum Schluss noch ein pragmatischer wissenschaftlicher Abgleich: Die Psychologie kennt den Zustand des Flow (des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit). In Flow-Momenten hört oft die selbstreflektierende Gedankentätigkeit auf – man „denkt nicht mehr nach“, man ist einfach da. Manche Flow-Forscher sagen, in solchen Augenblicken tritt das Ego beiseite; etwas Tieferes übernimmt, eine stille, konzentrierte Präsenz. Das kommt dem Erleben des Purusha nahe, auch wenn es nicht explizit so benannt wird.
Ebenso zeigen Meditationsstudien, dass regelmäßige Meditierende eine dichtere Verbindung zu dem Teil des Gehirns entwickeln, der für Meta-Bewusstsein zuständig ist – also für die Fähigkeit, die eigenen Gedanken wie ein Beobachter wahrzunehmen.
Unser Gehirn scheint gewissermaßen darauf ausgelegt, einen „inneren Zeugen“ auszubilden, wenn wir es trainieren.
Das ist doch erstaunlich: Übung im Sinn von Patanjali (Meditation, Achtsamkeit) kann messbar zu einem Zustand führen, in dem wir unseren Geist bewusst beobachten, statt blind in ihm verstrickt zu sein. Die alte Sutra erwiese sich damit als empirisch überprüfbar – in unseren eigenen Erfahrungen und irgendwann vielleicht auch in der Laborforschung.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-18
In der Meditation
Sutra 4.18 sagt: Da ist einer in dir, der alles sieht – der Purusha, unveränderlich, ungerührt. Wie übst du das?
- Setz dich hin – und tu erstmal gar nichts. Wirklich, kein Mantra, kein Zählen, kein Atemmanipulieren. Nur still sitzen. Schon nach ein paar Sekunden fängt dein Kopf an, dir Theaterstücke vorzuführen: Einkaufsliste, Streit mit der Kollegin, Zukunftssorgen. Normalerweise bist du sofort Mitspieler in diesem Stück. Heute nicht. Heute bist du der Zuschauer. Dein einziger Job: wahrnehmen. „Aha, da läuft die Sorge.“ Punkt. Mehr nicht.
- Verwende das Bild vom Kino. Stell dir vor, deine Gedanken sind der Film, der läuft. Du bist nicht die Hauptfigur auf der Leinwand, du bist der im Sessel. Genau das will Patanjali: dass du merkst, da ist ein Abstand zwischen Film und Zuschauer. Manchmal, wenn du’s wirklich triffst, kommt ein Moment, in dem du denkst: „Oh, das läuft alles einfach – ohne dass ich etwas machen muss.“ Genau das ist der Geschmack von Purusha.
- Erwarte keine Explosion von Erkenntnis. Das Bewusstsein als Zeuge taucht oft unscheinbar auf – wie ein stiller Hintergrund, den du zuerst gar nicht ernst nimmst. Aber je öfter du diese Haltung übst, desto klarer wird dir: Ich bin nicht meine Gedanken, ich sehe sie. Das ist der Kern.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Im Alltag
Meditation ist schön, aber was bringt’s beim Wocheneinkauf oder im Büro? Genau da wird’s interessant.
- In Konflikten: Stell dir vor, jemand schießt dir einen spitzen Kommentar ins Gesicht. Normalerweise ballt sich dein Bauch zusammen und der Kopf feuert sofort zurück. Stop. Versuch mal: „Aha, da ist Wut. Da ist Kränkung.“ Du atmest – und merkst: Ich bin nicht der Ärger. Er taucht auf, er rauscht durch. Der Beobachter in dir ist unbeeindruckt. Das verändert, wie du reagierst – oft milder, manchmal sogar mit Humor.
- Beim Zähneputzen: Ja, banal. Aber hier übst du: Da ist Bewegung. Da ist Geschmack von Zahnpasta. Da ist das Denken an die Arbeit. Alles läuft, und du bleibst der stille Beobachter. Ganz unspektakulär, aber genau so wächst dieses „Zeugen-Gefühl“ in deinem Alltag.
- In der Freude: Nicht nur bei Stress. Stell dir vor, du sitzt mit Freunden beim Essen, und das Lachen sprudelt. Versuch auch da kurz innerlich einen Schritt zurückzutreten: „Da ist Freude.“ Nicht, um sie kaputtzumachen, sondern um zu spüren: Ich bin das Bewusstsein, das auch diese Freude trägt. Der Unterschied: du hängst dich weniger an, wenn’s vorbei ist, weil du weißt: Der Beobachter bleibt, egal ob’s gerade hell oder dunkel ist.
- Als Mini-Ritual: Mach dir einen kleinen Anker im Alltag. Zum Beispiel jedes Mal, wenn dein Handy vibriert: Kurz spüren – „Da ist Erwartung, da ist Reiz, da ist Impuls.“ Beobachte das Ganze für zwei Atemzüge, bevor du reagierst. Zwei Atemzüge reichen schon, um dich daran zu erinnern: Ich bin der, der sieht.
Kurz zusammengefasst:
Bemühe dich in Meditation und Alltag darum, den Beobachter hinter deinem Bewusstsein wahrzunehmen.
Am Anfang mögen diese Phasen der Zeugen-Bewusstheit kaum wahrnehmbar sein. Mit der Zeit soll es zu innerer Stabilität dieses Phänomens bei erfahrenen Meditierenden kommen. Als ob in dir ein ruhiger Raum ist, egal wie laut draußen (oder drinnen) alles wird.
Also: Bleib dran, auch wenn du manchmal wieder voll in den Film reinrutscht, dich mit Ärger, Stress, Freude identifizierst . Macht nichts. Auch das kannst du sehen: „Da ist Verstrickung.“ Zack – du bist wieder Beobachter.
Sutra 4.18 kannst du nicht nur im Meditationsraum verstehen, sondern überall da, wo du dein Leben lebst. Die Kunst ist, dich immer wieder daran zu erinnern:
Du bist nicht der Film. Du bist der, der schaut.
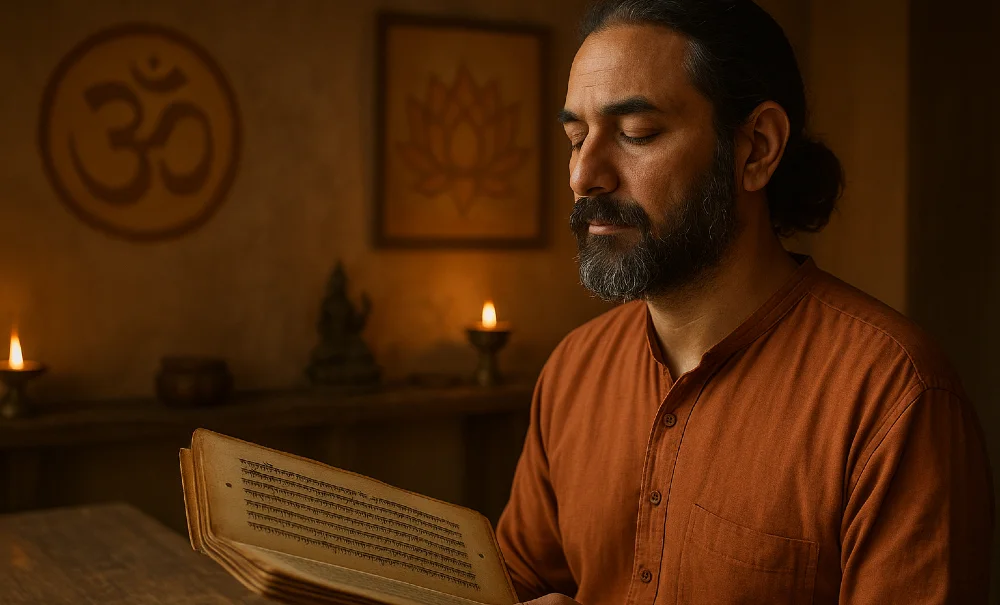
Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.18
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Gehen wir noch einmal näher auf Vyāsa, den ältesten und wichtigsten Kommentator des Yogasūtra ein. Vyasa schreibt:
Der Purusha, das wahre Selbst, kennt die Veränderungen des Geistes jederzeit, weil er unveränderlich ist.
Worum es Vyāsa geht
Stell dir vor, Purusha – dein innerer Zeuge – wäre selbst so wechselhaft wie dein Denken. Dann wäre er mal bewusst, mal unbewusst, je nachdem, wie es gerade läuft. Genau das verneint Vyāsa: Das Bewusstsein kennt immer die Bewegungen des Geistes.
-
Purusha ist das stille, konstante Licht im Hintergrund.
-
Citta (der Verstand, das innere Instrument) ist das Feld, in dem sich Gedanken, Gefühle und Erinnerungen verändern.
-
Auch wenn der Geist schwankt wie eine Wasseroberfläche im Wind, der Purusha nimmt jede Bewegung wahr – ohne selbst mitzuwackeln.
Wenn Purusha sich ändern würde, dann könnten manche Gedankenwellen unbemerkt bleiben, so wie du einen Ton überhörst oder ein Bild übersiehst. Doch Purusha ist nicht so. Er bleibt gleich, und deshalb ist jede Bewegung des Geistes von ihm umfasst.
Warum ist das überhaupt wichtig? Manche sehen es so: Die Unveränderlichkeit des Purusha ist die Voraussetzung dafür, dass Befreiung überhaupt möglich ist. Denn wenn Bewusstsein selbst instabil wäre, gäbe es keinen festen Punkt, an dem wir Halt finden.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra II-17: Die Identifikation des wahrnehmenden Selbstes mit den wahrgenommenen Objekten ist Ursache [des Leides] und sollte überwunden werden
Yoga Sutra II-20: Der Sehende ist reines Bewusstsein; doch er sieht [die Welt] durch den [täuschungsanfälligen] Geist
Yoga Sutra II-22: Die Welt verschwindet für den, für den sie ihren Zweck erfüllt hat; für alle anderen existiert sie als gemeinsame Realität weiter
Yoga Sutra II-23: Der Sinn der (scheinbaren) Verbindung (Samyoga) unseres wahren Selbstes (Purusha) mit der äußeren Welt (Prakriti) besteht darin, dass wir unsere wahre Natur und deren Kräfte erkennen
Yoga Sutra II-24: Die Ursache dieser Verbindung (Samyoga) von wahrem Selbst und der äußeren Welt ist Unwissenheit (Avidya)
Yoga Sutra IV-30: Dann folgt das Ende aller Leiden und des Karma

Fazit: Ein zeitloser Blick hinter die Stirn
Yoga-Sutra 4.18 mag auf den ersten Blick sehr philosophisch klingen – doch in Wahrheit hält es uns einen Spiegel vor, in dem wir etwas Essenzielles erkennen können. Patanjali sagt uns: Du hast in dir ein unveränderliches Bewusstsein, einen inneren Zeugen, der alle Veränderungen deines Geistes miterlebt, ohne selbst davon verändert zu werden. Dieses wahre Selbst, Purusha, ist der stille Herrscher im eigenen Haus – oft übertönt vom Lärm der Gedanken, aber immer da. Die klassischen Kommentare untermauern diese Sicht mit scharfer Logik und anschaulichen Analogien: Purusha als Licht, Purusha als ewiger Seher, Purusha als Garant dafür, dass überhaupt Wissen möglich ist. Alte Meister wie Vyasa versuchten zu beweisen, warum der Geist nicht sich selbst gehören kann und warum ein unveränderliches Bewusstsein hinter allem stehen muss.
Für uns heute liegt der Wert dieser Erkenntnis vor allem darin, sie erlebbar zu machen. Jeder Moment, in dem wir innehalten und die Rolle des Beobachters einnehmen – sei es im Zen-Meditationsraum, auf der Yogamatte oder während wir morgens den Kaffee trinken – erfüllt den Sinn von Sutra 4.18 mit Leben. Es geht darum zu spüren:
Gedanken kommen und gehen, aber ich bin der, der sie kommen und gehen sieht.
Dieses „Ich“ ist nicht das kleine Ego, sondern jenes große Bewusstsein, das Patanjali Purusha nennt. In dem Moment, wo wir uns damit identifizieren, tritt eine tiefe Ruhe ein: Wir müssen den Geist nicht mehr kontrollieren oder fürchten, wir schauen ihm mit mildem Interesse zu. Ein erfahrerer Yoga-Schüler könnte scherzen: „Mein Geist darf ruhig verrückt spielen – ich hab’ Popcorn, ich sitze in der Loge und schaue dem Treiben zu.“ Damit will er ausdrücken, dass er sich nicht mehr total mit seinen mentalen Dramen identifiziert. Ironischerweise verhilft genau diese gelöste Zeugenhaltung dem Geist eher zur Ruhe, als krampfhaftes Kontrollieren es je könnte.
Patanjalis Sutra ist also Einladung und Versprechen zugleich: Einladung, dich selbst als Bewusstsein hinter dem Denken kennenzulernen, und Versprechen, dass in dir ein unverletzlicher, klarer Kern existiert, egal wie chaotisch dein Geist manchmal sein mag. Die alten Yogis und modernen Wissenschaftler stimmen hier überraschend überein: Da ist etwas in uns, das zuschaut. Wer einmal diese beobachtende Instanz erlebt – vielleicht nur für ein paar kostbare Sekunden in tiefer Meditation oder in einem Moment vollkommenen Gewahrseins – der vergisst es vermutlich nicht mehr. Genau solche Erfahrungen machen einen Yoga-Lehrenden oder -Übenden demütig und zugleich zuversichtlich: Demütig, weil man erkennt, dass das persönliche Getriebe „Geist“ nur ein Werkzeug ist, nicht das Zentrum des Universums. Und zuversichtlich, weil man ahnt, dass tief drinnen eine innere Stärke und Beständigkeit wohnt, auf die man sich letztlich verlassen kann.
Yogasutra 4.18, diese eine Zeile, bündelt all das in knapper Form. Es lohnt, sie nicht nur intellektuell zu begreifen, sondern meditativ zu erforschen: Wer bin „Ich“, der all dies weiß? – Wenn wir diese Frage still stellen, kommen wir dem Purusha näher. Patanjali hat uns mit dieser Sutra einen Schlüssel gegeben, um die Tür zur Selbsterkenntnis aufzustoßen. Hinter dieser Tür wartet ein Raum stillen Lichts – zeitlos, unbewegt, doch allem bewusst. Genau dort, würden die Yogis sagen, wohnst du wirklich. Du warst es die ganze Zeit, der dem Spiel deines Geistes zusah. Und nun beginnt das große Abenteuer, es voll und ganz zu realisieren
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-18
Selbst, Gedanken und Psyche – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 18 bis Vers 22
Länge: 7 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Kenntnis der Chitta Vrittis – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.18
Länge: 8 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Der denkende Geist ist nicht selbstleuchtend: Asha Nayaswami (Class 66) zu Sutra 4.18 bis 4.23
Länge: 76 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


