tad-uparâgâpekæitvâc-cittasya vastu jõâtâjõâtam
तदुपरागापेक्षत्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्
Wer das vierte Kapitel des Yogasutra liest, begegnet einer irritierenden Wahrheit: Die Welt liegt nicht einfach so offen vor uns, sie wird uns vielmehr nur dort sichtbar, wo unser Geist bereit ist, sich färben zu lassen. Ein Satz wie aus einem alten Text, und doch wirkt er aktueller als manch modernes Achtsamkeitsbuch. Dieser Artikel bündelt klassische Kommentare, moderne Auslegungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sutra 4.17 – und zeigt, warum es nicht egal ist, ob der Geist wie blankes Eisen auf die Magneten der Welt reagiert oder stur in seiner eigenen Ecke rostet.
Kurz zusammengefasst
- Geist und Färbung: Der Geist (citta) erkennt Objekte nur, wenn er von ihnen geprägt wird – bleibt diese Färbung aus, bleibt das Objekt unbekannt.
- Vyāsa: Vergleicht Objekte mit Magneten und den Geist mit Eisen – die Erkenntnis ist die Färbung, die entsteht, wenn Geist und Objekt aufeinandertreffen.
- Śaṅkara: Präzisiert, dass der Geist wandelbar sein muss, da manche Dinge bekannt, andere unbekannt bleiben – und wendet sich gegen die Idee, alles sei bloß Geist.
- Puruṣa: Das reine Bewusstsein bleibt unberührt, es kann nicht vom Geist erfasst oder gefärbt werden.
- Praxisbezug: In Meditation und Alltag wird deutlich, dass Wahrnehmung selektiv ist – was nicht in die Ausrichtung des Geistes fällt, existiert zwar, bleibt aber unbemerkt.
- Moderne Wissenschaft: Phänomene wie selektive Wahrnehmung, Confirmation Bias oder das Gorilla-Experiment zeigen, wie sehr Erwartungen unsere Wahrnehmung formen.
- Philosophische Brücke: Patanjali vereint Realismus und Subjektivität – die Welt ist real, doch der Zugang hängt vom Zustand des Geistes ab.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Tad = das; dessen; der;
- Uparaga, uparāga = färben; nahe sein; erregen; einfärben; Verfärbung; verzerren; verdrehen; es kann das Wirken oder Beeinflussen eines Objekts beschreiben.
- Tad-uparâga = die Färbung dadurch; emotionale Vorprägung;
- Apekshita, Apekshitvat, apekshitvât, apekṣitvāt = weil es nötig ist; erwarten; Erwartung; Vorfreude; Vorliebe; aus der Hoffnung; aufgrund von Erwartung; gewünscht; erstrebt; Zustand der Notwendigkeit;
- Citta = Verstand; Geist; Raum der Wahrnehmung; Bewusstheit;
- Chittasya, cittasya = für, durch den Verstand/Geist (Chitta);
- Vastu = Objekt; Situation; Person; Fokus der Aufmerksamkeit;
- Jnata, jnâta, jñāta = gewusst; erkannt; gekannt; was vom Wissenden gewusst wird; das Erkennen;
- Ajnatam, ajnâtam, ajñātaṁ = nicht gewusst; verkannt; vom Beobachter nicht erkannt; das Nicht-Erkennen;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Das vierte Kapitel des Yogasutra, das Kaivalya-Pada („Kapitel über die Befreiung“), beginnt mit einer Diskussion über die Entstehung übernatürlicher Fähigkeiten (siddhis). Patanjali betont, dass diese nicht nur aus strenger Yogapraxis erwachsen, sondern auch durch Geburt, Kräuter, Mantras oder asketische Übungen entstehen können. Doch er warnt: Auch wenn solche Kräfte beeindruckend wirken, sind sie für den Yogi nicht das Ziel. Wichtiger ist die Einsicht, dass alle Erscheinungen, ob subtil oder grob, aus den drei gunas (Grundqualitäten der Natur) hervorgehen und vergänglich sind. Darauf aufbauend erklärt Patanjali die Beziehung zwischen Geist (citta) und Bewusstsein (puruṣa): Der Geist ist wandelbar, abhängig von Eindrücken und Handlungen, während das reine Bewusstsein unverändert bleibt.
Ab Sutra 4.12 bis 4.17 verlagert sich die Perspektive stärker auf Zeit, Wahrnehmung und Erkenntnis. Patanjali erklärt, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Formen der gunas angelegt sind. Mit Sutra 4.16 wird betont, dass Objekte unabhängig von individueller Wahrnehmung existieren – ein realistischer Gegenpol zu rein subjektivistischen Positionen. Und schließlich Sutra 4.17: Ob ein Objekt für den Geist bekannt oder unbekannt ist, hängt davon ab, ob es den Geist färbt, also Eindruck hinterlässt. Damit öffnet Patanjali den Weg für eine tiefe Auseinandersetzung mit Wahrnehmung: Die Welt ist zwar da, aber ob wir sie erkennen, hängt von der Empfänglichkeit unseres Geistes ab.
Die Sutras IV-17 bis IV-26 handeln von der Beziehung des wahren Selbst (Purusha, unseres Wesenskerns, unserer Seele) zum normalen Bewusstsein (Chitta, unser Geist, unsere Gedanken und Gefühle).

Bedeutung der Sutra und Schlüsselbegriffe
Das Sanskrit dieser Sutra lautet: tad-uparāga-apekṣitvāt cittasya vastu jñātājñātam. Wörtlich übersetzt: „Aufgrund der Färbung (uparāga) des Geistes (cittasya) durch dieses [Objekt] (tad) ist das Objekt (vastu) bekannt (jñāta) oder unbekannt (ajñāta)“. In moderner Sprache ausgedrückt: Ein Ding wird vom Geist erkannt, wenn es den Geist beeinflusst oder „einfärbt“ – bleibt dieser Einfluss aus, bleibt das Ding unbemerkt. Färbung (uparāga) meint hier die Prägung oder Konditionierung des Geistes durch Eindrücke. Patanjali greift damit ein Kernthema der Yoga-Philosophie auf: Unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit hängt nicht allein vom Objekt ab, sondern vor allem vom Zustand und den Erwartungen des Geistes.
Wichtige Begriffe in diesem Sutra sind
- citta (übersetzt als Geist, Bewusstsein oder „Mind-Stuff“) und
- vastu (das Objekt oder „Ding an sich“).
Citta bezeichnet in den Yogasutras das gesamte mentale Feld – einschließlich Intellekt, Ego und Unterbewusstsein – praktisch unser denkender Geist. Vastu meint das Objekt der Wahrnehmung, irgendein Gegenstand oder Sachverhalt der Außenwelt (oder auch ein innerer Vorgang), den der Geist potenziell erkennen könnte. Patanjali sagt: Ob das Objekt im Geist auftaucht, hängt davon ab, ob das Objekt eine Spur im Geist hinterlässt – also ob der Geist sich davon „einfärben“ lässt. Bleibt der Geist unberührt, geht das Objekt im wahrsten Sinne des Wortes am Geist vorbei.
Diese Idee erinnert an Erkenntnisse der modernen Psychologie. Unser Gehirn filtert ständig die Reize, denen wir ausgesetzt sind, und lässt nur Bedeutungsvolles ins Bewusstsein treten. Zahlreiche Experimente belegen, dass Erwartungen und mentale Ausrichtung unsere Wahrnehmung wie Schablonen formen. Wir nehmen bevorzugt wahr, was zu unseren Erfahrungen, Zielen oder Befürchtungen passt, und blenden anderes aus. Anders formuliert: Was unser Geist nicht erwartet oder wofür er nicht empfänglich ist, das „sieht“ er oft nicht – genau wie Patanjali in Sutra 4.17 beschreibt.

Yogasutra 4.17 – Wie der Geist ein Objekt erkennt (oder nicht erkennt)
Kennst du das Phänomen, dass man etwas Offensichtliches nicht bemerkt, weil der Geist ganz woanders ist? Zum Beispiel sucht jemand hektisch seine Brille, obwohl sie die ganze Zeit auf dem Kopf sitzt. Oder man übersieht eine rote Ampel, vertieft in Gedanken. Unser Geist sieht oft nur, was er sehen will – oder wozu er geprägt und ausgerichtet ist. Genau diesen Zusammenhang formulierten die alten Yogis vor rund 2000 Jahren. Im Yoga-Sūtra IV.17 heißt es sinngemäß: „Je nach Ausrichtung und Erwartungshaltung des Geistes wird ein Objekt erkannt oder nicht erkannt.“ Mit anderen Worten: Ob wir etwas wahrnehmen, hängt davon ab, wie unser Geist (citta) durch das Objekt gefärbt wird. Ein Objekt der Welt kann für uns entweder bekannt sein, oder es bleibt unbekannt – abhängig davon, ob unser Geist eine Spur dieses Objekts aufnimmt oder nicht.
Färbung des Geistes durch ein Objekt
Diese Sutra besagt, dass wir Dinge/Objekte/Situationen/Stimmungen etc. nur wahrnehmen, wenn die Wahrnehmung dieser Dinge etc. eine Resonanz, einen Wiederhall (hier als Färbung bezeichnet) in unserem Geist auslösen. In unserem Gedächtnis, so Govindan, muss irgendetwas abgespeichert sein, was mit “einer früheren Erfahrung mit diesem Objekt in Zusammenhang steht”. Dies würde von Patanjali “Färbung des Bewusstseins” genannt werden - eine Metapher.
Klassische Kommentare: Magnet und Eisen, bekannt und unbekannt
Die alten Meister haben Yogasutra 4.17 ausführlich kommentiert. Ihr Tenor: Der Geist muss die Form des Objekts annehmen, damit Erkenntnis entsteht. Der vielleicht berühmteste Kommentar stammt von Vyāsa (ca. 5. Jh.), der einprägsame Bilder nutzt. Vyāsa vergleicht die Objekte der Welt mit einem Magneten (loadstone) und den Geist mit einem Stück Eisen. Kommt ein Objekt in die Nähe des Geistes, „zieht“ es den Geist an sich und färbt ihn – so wie ein Magnet Eisen anzieht und magnetisiert. Womit auch immer der Geist gefärbt wird, das wird dem Geist bekannt; alles andere bleibt unbekannt. Vyāsa folgert: Daher hat der Geist wechselnde Zustände – mal kennt er ein Objekt, mal nicht – und genau diese Veränderlichkeit (pariṇāma) ist seine Natur. Was der Geist kennt, muss ihn in irgendeiner Weise beeinflusst haben. Umgekehrt: Was ihn nicht beeinflusst, bleibt ihm verborgen.
Ein wichtiger Zusatz Vyāsas: “Das, was auf diese Weise nicht erkannt wird, ist der Puruṣa; dieser bleibt unbekannt.”. Puruṣa ist in der Yoga-Philosophie das reine Bewusstsein, das wahre Selbst jenseits des Geistes. Hier deutet Vyāsa an, dass der Puruṣa – der Beobachter – vom Geist nicht als Objekt erfasst werden kann. Der Puruṣa färbt den Geist eben nicht, er ist das Lichte, in dem der Geist und die Objekte überhaupt erst erscheinen. Daher bleibt der Puruṣa dem denkenden Geist unsichtbar (weil er kein Objekt unter Objekten ist). Dieses Detail zeigt die Tiefe der Sutra: Sie handelt nicht nur von Wahrnehmungspsychologie, sondern auch vom Verhältnis zwischen dem veränderlichen Geist und dem unveränderlichen bewussten Selbst.
Ein weiterer klassischer Kommentar ist der des Vācaspati Miśra (9. Jh.), der in seiner Tattvavaiśāradī-Glosse Sutra 4.17 philosophisch verteidigt. Er argumentiert, dass ein an sich bewusstloses Objekt (jada vastu) niemals von selbst erleuchtet oder “belebt” sein kann – es braucht den Kontakt mit einem bewussten Prinzip, damit es erkannt wird. Das Objekt “färbt” zwar den Geist über die Sinne, aber erst das darin reflektierte Bewusstsein (Puruṣa als Lichtquelle) macht das Erkannte lebendig. Vācaspati beschreibt den Geist als eine Art Spiegel: Das Objekt gibt dem Spiegel-Geist einen Abdruck (die Färbung oder Form), und das Licht des Bewusstseins, das sich im Geist spiegelt, ermöglicht die Erkenntnis. Ohne Bewusstsein bliebe das Abbild leblos, ohne Objekt gäbe es nichts abzubilden – erst das Zusammenwirken ergibt Wahrnehmung. Dieser nicht ganz einfach nachzuvollziehende Kommentar betont also die Kooperation von Objekt, Geist und Bewusstsein.
Andere klassische Autoren stimmen in der Sache überein, variieren aber die Worte. Bhoja (11. Jh.) in seinem Rāja-mārtaṇḍa-Kommentar etwa erklärt, der Geist müsse die Form des Objekts annehmen – wie flüssiges Metall, das in eine Form gegossen wird – damit Wissen entsteht. Vijñāna Bhikṣu (16. Jh.) greift ebenfalls Vyāsas Magnet-Analogie auf und fügt hinzu, dass aus dem Wechsel von erkannt und nicht erkannt auch folgt, dass der Geist weder alles weiß (denn vieles färbt ihn nicht) noch gar nichts weiß (denn einiges färbt ihn eben doch). Damit wendet er sich gegen extreme Positionen: Wäre die Welt nur Projektion des Geistes, müsste der Geist allwissend sein; wäre der Geist völlig passiv, käme keine Erkenntnis zustande, so seine Folgerungen. Patanjali positioniere sich dazwischen: Es braucht beides – ein Objekt und einen aufnahmebereiten Geist, der dessen Prägung annimmt.
Man sieht an diesen alten Kommentaren die philosophische Raffinesse: Yogasutra 4.17 wird genutzt, um den Realitätscharakter der Außenwelt zu diskutieren. Im Sutra 4.16 zuvor hatte Patanjali ja klargestellt, dass das Objekt nicht von einem einzelnen Geist abhängt – es existiert also auch unabhängig von unserer Wahrnehmung. Sutra 4.17 ergänzt: Dennoch bestimmt unser Geist, ob und wie wir dieses Objekt wahrnehmen. Die klassischen Ausleger betonen damit sowohl die objektive Realität der Dinge (gegen reinen Idealismus) als auch die subjektive Färbung der Wahrnehmung (gegen naiven Realismus). Das Objekt existiert zwar für sich (die Blume blüht auch ohne Betrachter), aber was der Geist daraus macht, ist seine Sache.

Moderne Auslegungen und wissenschaftliche Parallelen
Auch moderne Yogalehrer und Autoren haben Yogasutra 4.17 kommentiert – oft mit Fokus auf die praktische Selbsterfahrung. Swami Satchidananda übersetzt z.B.: “Ein Objekt ist dem Geist bekannt oder unbekannt, je nachdem, ob der Geist davon gefärbt wird oder nicht.” Er erläutert, dass unser Geisteszustand darüber entscheidet, was wir erleben: “Der Geist ist wie ein farbloses Prisma. Jede Erfahrung gibt ihm eine Tönung. In Meditation lernt man, diese Tönungen zu reduzieren, um die Dinge klarer zu sehen.” Diese Betonung der Klarheit des Geistes zieht sich durch viele moderne Kommentare. B.K.S. Iyengar etwa weist darauf hin, dass Vrittis – die Bewegungen und Eindrücke im Geist – wie Wellen sind, die das Bild verzerren können. Nur ein beruhigter, ungefärbter See reflektiert den Mond klar. Genauso reflektiert ein ungefärbter Geist die Realität unverzerrt. Yogasutra 4.17 würde so zum Aufruf, die eigenen Denkmuster, Vorurteile und Erwartungen zu erkennen. Denn diese sind die „Farben“, die wir ständig auf die Welt projizieren.
Aktuelle Kommentatoren schlagen manchmal Brücken zur Psychologie und Neurowissenschaft. Das Sutra lässt sich zum Beispiel im Licht der kognitiven Psychologie als frühe Form der Erkenntnis lesen, dass Wahrnehmung konstruiert ist. Begriffe wie selektive Aufmerksamkeit, Confirmation Bias, Top-Down-Verarbeitung spiegeln genau das wider: Unser Gehirn wählt aus und interpretiert Sinnesdaten anhand dessen, was es bereits kennt oder erwartet.
Die "Färbung" des Verstandes kann als Ablauf verstanden werden, bei dem Erfahrungen, Erwartungen und kognitive Strukturen die Wahrnehmung und das Verständnis von Objekten beeinflussen.
Neurowissenschaftliche Perspektiven
In der Neurowissenschaft wird die Wahrnehmung als ein komplexer Prozess gesehen, bei dem das Gehirn Informationen aus der Umwelt aufnimmt und interpretiert. Dieser Prozess ist nicht nur passiv; vielmehr spielt das Gehirn eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Wahrnehmung, basierend auf früheren Erfahrungen, Erwartungen und dem Kontext. Dieses Phänomen wird in der Neurowissenschaft als "Top-Down-Verarbeitung" bezeichnet.
Top-Down-Verarbeitung
In diesem Prozess leiten höhere kognitive Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Erwartungen die Wahrnehmung. Das bedeutet, dass das, was wir bereits kennen oder erwarten, unsere Wahrnehmung der Realität beeinflusst. Dies deckt sich mit der Idee des Yogasutras, dass die "Färbung" des Verstandes die Wahrnehmung eines Objekts bestimmt.
Neuroplastizität: Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, sich im Laufe der Zeit durch Erfahrungen zu verändern. Neue Erfahrungen können die Art und Weise, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, abwandeln, was wiederum die Wahrnehmung beeinflusst.
Selektive Wahrnehmung und Aufmerksamkeit: Neurowissenschaftliche Studien zeigen auch, dass wir selektiv auf bestimmte Reize in unserer Umgebung achten, basierend auf dem, was wir für relevant halten. Dies kann erklären, warum manche Objekte uns "bekannt" erscheinen, während andere als "unbekannt" oder weniger wichtig wahrgenommen werden.
Synthese von Yoga und Wissenschaft
In der Zusammenschau zeigt sich, dass das Yogasutra und neurowissenschaftliche Erkenntnisse eine ähnliche Grundidee teilen: Die Wahrnehmung ist kein objektiver, sondern ein subjektiver Prozess, der stark von unseren vorherigen Erfahrungen, unserem Wissen und unseren Erwartungen geprägt ist. Beide Perspektiven betonen die Rolle des Verstandes oder Gehirns bei der Gestaltung unserer individuellen Wirklichkeitserfahrung.
Beispiele für selektive Wahrnehmung
Die Legende um Kolumbus' Schiffe und die Ureinwohner
Der historische Kontext
Christoph Kolumbus, ein Entdecker des 15. Jahrhunderts, wollte ursprünglich einen Seeweg nach Asien finden und landete stattdessen 1492 in Amerika. Seine Ankunft markierte den Beginn einer neuen Ära, die für die Ureinwohner Amerikas mit unermesslichem Leid verbunden war. Die ersten Begegnungen zwischen Kolumbus und den Ureinwohnern, die er als „Indianer“ bezeichnete, waren anfangs friedlich, wobei die Einheimischen die Neuankömmlinge sogar mit Geschenken willkommen hießen. Kolumbus setzte seine Reise fort, gründete Kolonien und kehrte mit Schätzen nach Spanien zurück. Doch die folgenden Jahre brachten Gewalt und Zerstörung, vor allem für die Ureinwohner, von denen Hunderttausende durch Krieg, Krankheiten und Unterdrückung starben.
Die Legende und ihre neurowissenschaftliche Betrachtung
Es existiert eine verbreitete Erzählung, die besagt, dass die Ureinwohner Amerikas Kolumbus’ Schiffe zunächst nicht sehen konnten, da sie völlig anders waren als alles, was sie zuvor gesehen hatten. Erst nachdem ein Schamane, der Veränderungen im Wasser bemerkte, sie erkannte und die anderen darauf aufmerksam machte, konnten auch sie die Schiffe wahrnehmen.
Diese Geschichte ist jedoch umstritten. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist zwar bekannt, dass das Gehirn dazu neigt, das wahrzunehmen, was es kennt, und unbekannte Informationen möglicherweise ignoriert oder nicht richtig verarbeitet. Dieses Phänomen ist Teil der Neuroplastizität des Gehirns, die es ermöglicht, dass sich neuronale Verbindungen im Laufe des Lebens verändern und anpassen. Dennoch ist die Vorstellung, dass die Ureinwohner die Schiffe aufgrund ihrer Unbekanntheit nicht sehen konnten, skeptisch zu betrachten. Die Schiffe waren zwar neuartig, bestanden jedoch aus Materialien wie Holz, die den Ureinwohnern bekannt waren.
Fazit
Die Geschichte, dass die Ureinwohner Amerikas die Schiffe von Kolumbus nicht erkennen konnten, ist eher eine Legende als eine historische Tatsache. Sie illustriert zwar interessante Aspekte der menschlichen Wahrnehmung und Neuroplastizität, aber aus historischer und wissenschaftlicher Sicht gibt es wenig Belege, die diese spezifische Erzählung stützen.

Das Bild vom Kristall
In der Samkhya-Philosophie wird der Geist gerne mit einem Kristall verglichen. Betrachtet man Objekte durch einen Kristall, so werden die Farben des Objektes nur in Abhängigkeit von dem erkannt, was der Kristall durchlässt. So könnte man auch die Filterfunktion des menschlichen Geistes betrachten.
Blickst du beispielsweise durch einen grünen Malachit, so sehen alle Objekte grün aus.
Mithilfe der Anleitungen im Yogasutra verwandeln wir unseren Geist dann in einen durchsichtigen Kristall, der alle Dinge so erkennt, wie sie wirklich sind. Dies ist in Sutra I-41 erläutert:
Yoga Sutra I-41: Für den, der die Bewegungen des Geistes auf ein Minimum reduziert, verschmelzen Wahrnehmender, Wahrgenommenes und Wahrnehmung, so wie ein Kristall Form und Farbe eines Hintergrundes reflektiert. Das ist Samapatti (Verschmelzung).
Test auf selektive Wahrnehmung: Zähle die Pässe
Hier ein anschauliches Beispiel, wie unser Fokus unsere Wahrnehmung bestimmt. Wenn du ihn selbst ausführen willst, lies nicht weiter, sondern führe zunächst eine der beiden Möglichkeiten aus:
Video: Test in Videoform
Länge: Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Test als Online-Tool
Aufmerksamkeits-Test: Zähle die Pässe des weißen Teams
Fokus auf die weißen Spieler. Zähle ihre Pässe. Ignoriere alle anderen Reize.
Dieses Experiment von 1999 wird Invisible-Gorilla-Experiment genannt. Probanden sollten in einem Video die Ballpässe eines Teams zählen. Mitten durchs Bild läuft deutlich sichtbar eine Person im Gorillakostüm – doch rund die Hälfte der konzentrierten Beobachter bemerkte den Gorilla überhaupt nicht! Das überraschende Ergebnis machte Schlagzeilen als Beleg für „Unaufmerksamkeitsblindheit“: Man übersieht etwas, das man nicht erwartet, selbst wenn es direkt vor einem passiert. Patanjali würde hier wohl lächeln und sagen: „Wie erwartet – der Geist wurde eben nicht vom Gorilla geprägt, daher blieb er unbekannt.“
Kurze Frage: Hast du den Test eben selbst gemacht?
Weitere neue neurowissenschaftliche Studien stützen Patanjalis Aussage. Ein EU-Forschungsteam untersuchte etwa, wie Erwartung die bewusste Wahrnehmung beeinflusst. Die Ergebnisse: Erwartete Reize dringen messbar schneller ins Bewusstsein, während unerwartete Reize langsamer oder gar nicht durchdringen. Mit anderen Worten: Das Gehirn “lässt” erwartete Objekte eher bewusst werden, Unerwartetes bleibt länger unsichtbar.
Die Forscher erklären dies mit dem Konzept des Predictive Coding: Das Gehirn sagt permanent voraus, was als Nächstes kommt, und vergleicht eintreffende Signale mit diesen Erwartungen. Passt ein Sinneseindruck ins erwartete Muster, wird er schnell integriert (der Geist wird bereitwillig „gefärbt“); passt er nicht, braucht das Gehirn länger – oder verwirft den Eindruck als irrelevant Rauschen. Diese neurokognitiven Erkenntnisse sind erstaunlich kongruent mit Patanjalis uralter Feststellung.
Sogar in der Physik findet sich ein verblüffendes Gleichnis: In der Quantenmechanik hat die Beobachtung Einfluss auf den Zustand eines Systems. Berühmt ist der Doppelspalt-Versuch: Licht zeigt ein Wellenmuster – es sei denn, man „schaut hin“, welcher Spalt benutzt wird, dann verhält es sich wie Teilchen. Vereinfacht gesagt: Das Verhalten des Licht-Objekts hängt davon ab, ob ein Beobachter es misst oder nicht. Das Ergebnis erscheint anders, je nachdem ob ein „Geist“ beteiligt ist. Populär wird das als Beobachter-Effekt beschrieben, wo allein die Messung das Ergebnis verändert. Nun unterscheiden sich subatomare Teilchen natürlich von unseren Alltagserfahrungen, und Physiker betonen, dass hier Messgeräte und Wahrscheinlichkeiten im Spiel sind – nicht einfach das menschliche Wollen.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-17
In der Meditation üben
Du sitzt in deiner Meditation. Dein Objekt – sagen wir der Atem – ist da. Aber kennst du den Moment, wo du zehn Minuten später merkst: „Oh, ich war weg“? Das ist genau Sutra 4.17 in Aktion. Dein Atem war da, aber dein Geist hat sich nicht davon prägen lassen. Er ist lieber spazieren gegangen.
Ein kleines Übungsexperiment:
- Richte deine Aufmerksamkeit auf den Atem, aber nicht mit Gewalt. Lass dich wirklich vom Atem berühren. Spür die Kühle beim Einatmen, die Wärme beim Ausatmen. Das könnte man als Färben des Geistes ansehen.
- Wenn du merkst, dass du zwar den Atem „zählst“, aber ihn nicht fühlst, dann ist dein Geist formal beim Objekt, aber eigentlich farblos. Er erkennt nicht, was da ist.
- Übe, immer wieder zu diesem „berührt sein“ zurückzukehren. Nicht nur hinschauen, sondern dich einfärben lassen.
Noch spannender wird’s mit Geräuschen: Höre eine Weile bewusst auf alle Töne um dich herum. Nicht bewerten („Auto nervt, Vogel schön“), sondern spüren, wie der Geist jeweils anders gefärbt wird. Mal hektisch, mal weich, mal schrill. Das ist Sutra 4.17 zum Selbererfahren.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Im Alltag üben
Im Alltag erwischt dich die Sutra bei jeder Kleinigkeit. Drei Beispiele:
- Das Gespräch, das du verpasst.
Dein Partner erzählt dir etwas Wichtiges, aber dein Geist hängt noch bei der Arbeit. Ergebnis: Die Worte prallen ab, färben dich nicht, und du sagst am Ende: „Was hast du gerade gesagt?“ – Genau das. Objekt vorhanden, Geist nicht empfänglich. Übung: Nimm dir bewusst einen Atemzug, bevor du antwortest. Lass die Worte in dich hineinfallen, spüre ihren Nachhall. Dann erkennst du wirklich, was gesagt wurde. - Das übersehene Wunder.
Du gehst durch die Stadt, alles grau. Doch am Straßenrand blüht eine kleine Blume. Du kannst vorbeirennen, ohne sie zu sehen – oder du lässt dich einen Moment von ihr berühren. Zwei Welten, ein und dieselbe Blume. Übung: Trainiere täglich, bewusst etwas Kleines zu bemerken, das sonst untergeht. Ein Geräusch, eine Farbe, ein Gesichtsausdruck. Dein Geist wird feinfühliger für das, was er sonst überblendet. - Der innere Kritiker.
Du hältst eine Yogastunde und denkst: „Die Hälfte langweilt sich bestimmt.“ Zack – dein Geist färbt die Realität mit Erwartung und Vorurteil. Die Schüler*innen sehen plötzlich tatsächlich gelangweilt aus (zumindest in deinem Kopf). Übung: Erkenne, dass du gerade deine eigene Färbung siehst. Mach eine kleine Pause, atme, und erinnere dich: Vielleicht sind sie einfach konzentriert. Du lockerst dich – und der Raum färbt sich neu. - Eigene Filter bewusst machen
Beschäftige dich die kommende Woche immer mal wieder mit den Filtern deiner Wahrnehmung. Gehe davon aus, dass diese Filter auch bei dir vorhanden sind. Versuche beispielsweise zu ergründen, wo dich deine Überzeugungen in einer Sache daran hindern, andere/weitere Aspekte an diesem Umstand/Objekt/Situation wahrzunehmen als diejenigen, die mit deiner Überzeugung übereinstimmen. - Erinnerung prüfen
Schaue ob du ergründen kannst, wie Wahrnehmung eines Objektes auf einer Erinnerung an (Aspekte) dieses Objekt(es) beruht.
Sutra 4.17 will dir (auch) sagen: Dein Geist ist kein neutraler Spiegel, er ist ein Prisma. Je nachdem, wie du ihn hinhältst und welche „Filter“ drinstecken, erscheint die Welt anders. In der Meditation kannst du üben, wirklich vom Objekt geprägt zu werden – statt es durch Gewohnheit oder Gedanken zu übermalen. Im Alltag lernst du, dass du oft nicht die Dinge an sich siehst, sondern deine Erwartungen.
Und wenn du das erkennst, hast du zwei Optionen: dich weniger täuschen zu lassen – oder wenigstens mit einem Augenzwinkern zuzugeben, dass du gerade mal wieder an deinem Gorilla vorbeigelaufen bist.
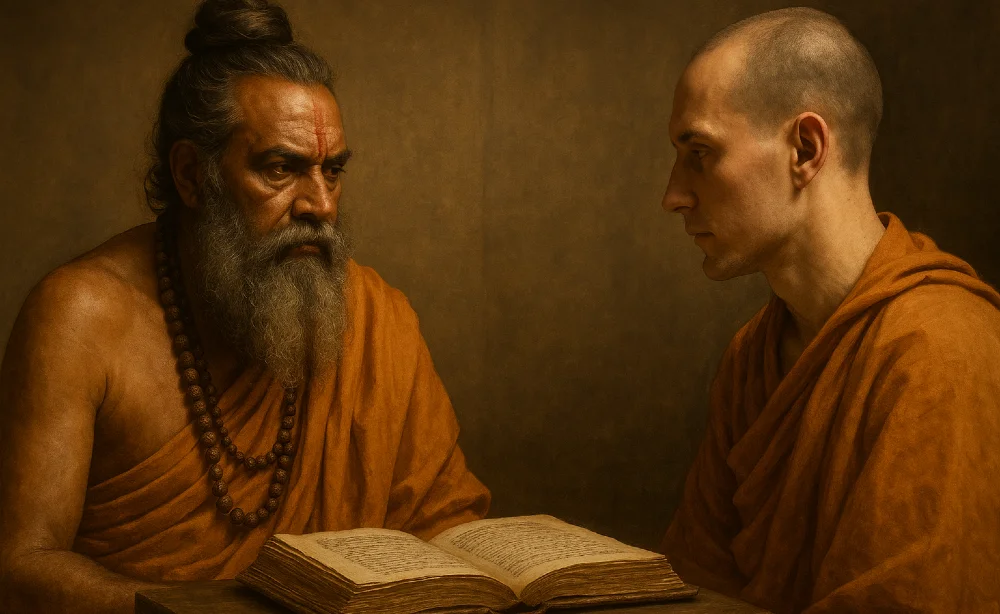
Kommentar zu Yogasutra 4.17 nach Vyāsa und Śaṅkara
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Gehen wir noch einmal näher auf Vyāsas Kommentar zu dieser Sutra ein. Er erklärt: Der Geist (citta) braucht den Kontakt mit einem Objekt, um dieses erkennen zu können. Objekte wirken dabei wie ein Laststein oder Magnet, der das Eisen anzieht. Der Geist ähnelt dem Eisen: kommt er in Berührung mit einem Objekt, wird er von ihm gefärbt. Genau in dieser Färbung liegt die Erkenntnis.
- Ein Objekt, das den Geist färbt → wird erkannt, ist bekannt.
- Ein Objekt, das den Geist nicht färbt → bleibt unbekannt.
- Das, was niemals vom Geist erkannt werden kann, ist der Puruṣa – das reine Bewusstsein, das jenseits aller Objekte liegt.
Damit macht Vyāsa deutlich:
Der Geist ist nicht fest oder einheitlich. Er verändert sich ständig, je nachdem, welches Objekt ihn gerade prägt.
Über das Leben von Shankara
Śaṅkara – Leben, Werk und Bedeutung für die Yogaphilosophie
Śaṅkara (auch bekannt als Śaṅkarācārya oder Shankara), geboren im 8. Jahrhundert in Südindien (788–820), ist einer der bekanntesten Philosophen und spirituellen Lehrer des Advaita Vedānta. Sein Leben gleicht einem Wanderweg zwischen Legende und Geschichte – mit spirituellem Tiefgang, intellektuellem Feuer und einer Prise mystischer Überhöhung. Doch unabhängig von den genauen Daten und Wundergeschichten bleibt: Seine Ideen wirken bis heute. Auch im Yoga.
🧘♂️ Wer war Śaṅkara?
Śaṅkara wurde vermutlich in Kaladi, im heutigen Kerala, geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich – hochintelligent, fragend, neugierig auf das Wesentliche. Früh verließ er seine Familie, um Sannyāsin zu werden – also Wandermönch, asketisch, radikal dem Geistigen zugewandt. Ein radikaler Schritt, selbst nach damaligen Maßstäben.
Er reiste quer durch Indien, diskutierte mit Vertretern anderer Schulen (oft wortgewaltig und nicht selten siegreich), gründete Klöster und prägte eine ganze philosophische Bewegung. Sein Ziel: Das Wissen um die Einheit allen Seins wieder in den Mittelpunkt zu rücken – jenseits von Ritualismus, Jenseitsversprechen und dogmatischer Spaltung.
📚 Was hat er geschrieben? Und warum ist das wichtig?
Śaṅkara war kein Vielschreiber im modernen Sinn, aber seine Werke haben Wucht. Besonders wichtig:
- 🔹 Brahmasūtra-Bhāṣya
Sein wohl berühmtestes Werk: ein Kommentar zu den Brahmasūtras, dem philosophischen Herzstück des Vedānta. Hier entfaltet er die Kernaussage des Advaita Vedānta: Alles ist eins. Brahman ist das einzig Wirkliche. Die Welt der Formen ist letztlich Illusion (Māyā). - 🔹 Upaniṣad-Kommentare
Śaṅkara kommentierte auch zentrale Upaniṣaden – jene Texte, die die tiefsten Fragen des Selbst, der Wirklichkeit und der Befreiung behandeln. Seine Lesart macht klar: Yoga ist nicht nur Praxis, sondern Erkenntnisweg. Nicht das Tun allein befreit, sondern das Verstehen. - 🔹 Bhagavadgītā-Bhāṣya
Auch hier interpretiert Śaṅkara das Geschehen nicht als moralisches Lehrstück, sondern als spirituellen Weckruf: Handle, aber erkenne, dass du nicht der Handelnde bist. Karma-Yoga, Jñāna-Yoga, Bhakti – für ihn keine Gegensätze, sondern Stufen der Reife.
Shankaras Doppelrolle – Berühmt als Advaita-Vedanta-Philosoph, kommentierte er hier einen Yoga-Text – und brachte so zwei Philosophieströmungen miteinander ins Gespräch.
🧠 Was sagt Śaṅkara, das heute noch trägt?
Für Menschen, die sich mit Yogaphilosophie beschäftigen – und nicht nur schwitzen, sondern auch verstehen wollen – ist Śaṅkara Gold wert. Seine Lehren laden ein, hinter die Oberfläche zu schauen. Meditation? Ja, aber nicht als Methode zur Beruhigung, sondern zur Erkenntnis der wahren Natur.
Er sagt: Du bist nicht dein Körper, deine Gedanken oder dein Yoga-Fortschritt. Du bist Brahman. Schon immer. Nur vergessen.
🔍 Was bedeutet das für dich?
- Wenn du meditierst, denk daran: Du musst nicht irgendwohin kommen. Du bist schon da.
- Wenn du philosophierst, lass dich nicht verwirren von intellektueller Gymnastik. Suche das Einfache im Komplexen.
- Wenn du zweifelst, erinnere dich: Erkenntnis ist kein fernes Ziel, sondern etwas, das du jederzeit berühren kannst – still, wach, jenseits der Worte.
Śaṅkara greift dieses Bild auf und präzisiert: Das Besondere am Objekt ist seine Kraft, den Geist schon allein durch seine Nähe zu beeinflussen. Ein Objekt zieht den Geist an, färbt ihn, und so nimmt der Geist die Form des Objekts an. Das ist der Moment des Erkennens. Alles, was den Geist nicht prägt, bleibt außerhalb des Wissens.
Śaṅkara betont außerdem: Aus dieser Tatsache folgt, dass der Geist veränderlich ist. Denn manche Dinge sind bekannt, andere nicht. Würde das Objekt bloß ein Produkt des Geistes sein, gäbe es nur zwei Möglichkeiten:
- Der Geist wäre allwissend – weil er alles, was er selbst hervorbringt, kennen müsste.
- Oder er wüsste gar nichts – weil es außerhalb von ihm nichts gäbe, das ihn färben könnte.
Beides widerspricht unserer Erfahrung. Stattdessen sehen wir: Der Geist kennt manches, anderes nicht. Deshalb muss er wandelbar sein und in Beziehung zu den Objekten treten.
Was heißt das nun für dich als Praktizierende*r?
- Dein Geist ist nicht von sich aus „bunt“. Er wird bunt durch das, womit er sich beschäftigt. Beobachte in der Meditation: Wodurch lässt du dich färben? Ein Atemzug kann ihn färben – oder der Gedanke an deine Einkaufsliste.
- Wenn du etwas nicht wahrnimmst, bedeutet das nicht, dass es nicht existiert. Es bedeutet nur, dass dein Geist es nicht aufgenommen hat. Vielleicht erinnerst du dich an Momente, in denen dir jemand sagt: „Das habe ich dir doch erzählt!“ – und du weißt, du warst schlicht nicht empfänglich.
- Der Hinweis auf den Puruṣa ist subtiler: Das reine Bewusstsein bleibt vom Geist unbeeinflusst. Es ist das, was hinter den wechselnden Färbungen liegt. In der Meditation bedeutet das: Du lernst, den Geist zu betrachten, ohne dich mit jeder Farbe zu identifizieren.
Vyāsa und Śaṅkara beschreiben mit dem Bild von Magnet und Eisen eine schlichte, aber machtvolle Wahrheit: Erkenntnis entsteht, wenn der Geist von einem Objekt berührt wird. Das erklärt, warum wir ständig zwischen „bekannt“ und „unbekannt“ schwanken – und warum wir im Yoga üben, unseren Geist bewusst auszurichten. Nur so erkennen wir klarer, was wirklich da ist – und vielleicht irgendwann auch, was sich jenseits aller Objekte befindet.
Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im Geist
Yoga Sutra I-3: Dann ruht der Wahrnehmende in seiner wahren Natur
Yoga Sutra I-4: In den anderen geistigen Zuständen – mit Vrittis – identifiziert sich der Wahrnehmende mit den Bewegungen im Geist
Yoga Sutra I-41: Für den, der die Bewegungen des Geistes auf ein Minimum reduziert, verschmelzen Wahrnehmender, Wahrgenommenes und Wahrnehmung, so wie ein Kristall Form und Farbe eines Hintergrundes reflektiert. Das ist Samapatti (Verschmelzung).
Yoga Sutra II-3: Unwissenheit, Identifikation mit dem Ego, Begierde, Abneigung und (Todes-)Furcht sind die fünf leidbringenden Zustände (Kleshas)
Yoga Sutra II-12: Die Kleshas sind [somit] die Wurzel für das gespeicherte Karma. Es wird im sichtbaren [gegenwärtigen] oder in nicht sichtbaren [zukünftigen Leben] erfahren werden.
Yoga Sutra II-13: Solange die Wurzeln [der Kleshas, der leidbringenden Hindernisse] verbleiben, muss es [das Karma] erfüllt werden, und erschafft die allgemeine Lebenssituation, die Lebensspanne und das Maß an freudvollen Erfahrungen in unserem Leben
Yoga Sutra II-14: Die Ernte aus dem Karma ist entweder freudvoll oder schmerzhaft, je nachdem, ob die zugrunde liegende Tat heilsam oder leidbringend war.
Yoga Sutra II-20: Der Sehende ist reines Bewusstsein; doch er sieht [die Welt] durch den [täuschungsanfälligen] Geist

Praktische Bedeutung für Yoga-Praktizierende
Was bedeuten all diese Kommentare und Theorien für jemanden auf dem Yogaweg, für Yogalehrende und Übende? Zunächst einmal ist Sutra 4.17 eine Erinnerung an die Subjektivität unserer Wahrnehmung. In der Yoga-Praxis erfahren wir das ständig: An einem Tag erscheint eine Meditationssitzung tief und klar, am nächsten Tag ist dieselbe Meditation unruhig und abgelenkt. Das Objekt der Meditation – sei es der Atem, ein Mantra oder ein Lichtpunkt – bleibt gleich, aber der Geist hat andere Färbungen. Vielleicht war man müde, gereizt oder voreingenommen – und prompt “erkennt” der Geist das Meditationsobjekt nicht richtig, schweift immer wieder ab (objekt ajñāta).
An einem anderen Tag, mit gesammelt-klarem Geist, stellt sich plötzlich eine tiefe Versenkung ein: Das Objekt erscheint lebendig, detailliert, erkannt (jñāta). Dieses Sutra ermuntert dazu, weniger an den Objekten selbst zu drehen, sondern mehr am Zustand des eigenen Geistes zu arbeiten. Yoga – ob durch āsana, prāṇāyāma oder dhyāna – ist letztlich die Kunst, den Geist so auszurichten und zu läutern, dass er die Wirklichkeit unverfälscht widerspiegeln kann.
Für Yogalehrende kann Sutra 4.17 ein Hinweis sein, warum Schülerinnen manchmal sehr unterschiedlich auf die gleiche Übung reagieren. Jeder bringt seine eigene Prägung mit auf die Matte. Was der eine Schüler in der Tiefenentspannung als wohltuend erlebt, bleibt für die andere vielleicht „nicht spürbar“, weil ihr Geist gerade woanders ist. Der Erwartungshorizont spielt eine Rolle: Wer skeptisch in eine Yogastunde geht, nimmt unter Umständen weniger der feinen Wirkungen wahr – sein Geist lässt sich (noch) nicht davon färben. Hier kann man als Lehrender behutsam anleiten, die Aufmerksamkeit zu schulen und Vorannahmen loszulassen, sodass sich der Geist für neue Erfahrungen öffnet.
Zuletzt hat Yogasutra 4.17 auch einen philosophischen Charme: Es lehrt Demut vor dem, was wir nicht wissen. Wenn unser Geist ein Objekt nicht erkennt, heißt das nicht unbedingt, dass nichts da ist – nur, dass wir es (noch) nicht wahrnehmen. Patanjali erinnert uns daran, dass Wirklichkeit und Wahrnehmung zweierlei sind. Für die ernsthafte Übende bedeutet dies: Innen wie außen tiefer zu schauen.
Indem wir unsere mentalen Färbungen – unsere Muster, Urteile, Erwartungen – erkennen und reduzieren, erweitern wir den Horizont dessen, was bekannt werden kann. So gesehen lädt Sutra 4.17 zu einer Meditation ein: Welchen Teil der Wirklichkeit übersehe ich vielleicht gerade, weil mein Geist anders geprägt ist? Dieses Fragezeichen verleiht dem Sutra eine zeitlose Aktualität – gewürzt mit einer Prise Ironie darüber, wie sehr wir alle in unseren mentalen Farben stecken.
Patanjalis antike Weisheit erhält durch klassische Kommentare, moderne Wissenschaft und persönliche Erfahrung immer neue Farbtöne – und doch läuft es auf das Gleiche hinaus: Das Bewusstsein leuchtet, aber was es erhellt, bestimmt die Ausrichtung des Geistes. Die Welt mag da sein, wie sie will – wir sehen sie so, wie unser Geist sie sehen kann. In diesem Sinne ist Yogasutra 4.17 eine Einladung, sowohl nach außen als auch nach innen wacher und offener zu werden.
Weitere mögliche Betrachtungen zur Aussage von Sutra IV-17
Philosophische Perspektiven
- Subjektive Realität: Die Sutra betont die subjektive Natur der Realität. Jedes Individuum erlebt die Welt durch den Filter seiner persönlichen Erfahrungen und Glaubenssätze. Dies wirft interessante Fragen über die Natur der Realität auf – ist das, was wir als "wirklich" betrachten, lediglich eine Reflexion unseres inneren Zustands?
- Buddhistische Ähnlichkeiten: Diese Idee findet Parallelen im Buddhismus, insbesondere in der Lehre von der "leeren Natur" der Phänomene – die Vorstellung, dass Dinge keine eigenständige Existenz haben, sondern durch unsere Wahrnehmungen geformt werden.
Psychologische Aspekte
- Kognitive Verzerrungen: Die Sutra spiegelt das Konzept der kognitiven Verzerrungen wider. Unsere Überzeugungen und früheren Erfahrungen beeinflussen, wie wir Informationen interpretieren und Entscheidungen treffen, was oft zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führt.
- Therapeutische Anwendungen: In der modernen Psychotherapie werden Techniken verwendet, um die "Färbung" des Verstandes zu erkennen und zu modifizieren, was hilft, dysfunktionale Gedankenmuster zu überwinden.
Soziokulturelle Implikationen
- Kulturelle Prägung: Unsere kulturellen Hintergründe und sozialen Kontexte färben ebenfalls unseren Verstand. Dies beeinflusst, wie wir andere Kulturen und gesellschaftliche Normen wahrnehmen und interpretieren.
- Medien und Wahrnehmung: In unserer von Medien geprägten Welt können die Informationen und Bilder, die wir konsumieren, unsere Wahrnehmung der Realität beeinflussen und verzerren.
Spirituelle und esoterische Überlegungen
- Bewusstseinserweiterung: Die Sutra könnte als Aufforderung zur Bewusstseinserweiterung interpretiert werden. Durch Meditation und Reflexion kann man lernen, die "Färbung" des Verstandes zu erkennen und zu transzendieren, um eine klarere Sicht der Realität zu erlangen.
- Universelle Verbundenheit: Die Idee, dass unsere Wahrnehmung die Welt formt, kann auch zu einem tieferen Verständnis der Verbundenheit aller Dinge führen, eine zentrale Idee in vielen spirituellen Traditionen.
Künstlerische und kreative Aspekte
- Kunstinterpretation: In der Kunst kann diese Sutra als Erklärung dafür dienen, warum unterschiedliche Menschen dasselbe Kunstwerk unterschiedlich interpretieren. Jeder bringt seine einzigartige "Färbung" des Verstandes in die Erfahrung ein.
- Kreativität und Inspiration: Für Kreative kann die Sutra eine Ermutigung sein, über den Tellerrand hinauszublicken und neue Perspektiven zu erkunden, um ihre Arbeit zu bereichern.
Zusammenfassung von Sutra IV-16 und IV-17
Swami Venkatesananda (zitiert von Rainbowbody) fasst beide Sutra kurz und bündig zusammen:
„Ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Substanz wird jedoch begriffen oder ignoriert, je nachdem, ob der Verstand von diesem Objekt gefärbt ist oder nicht, und daher von dieser Substanz angezogen oder abgestoßen wird. Daher ist die Qualität oder die Beschreibung der Substanz vom Verstand abhängig: während ihre Existenz unabhängig von ihm ist.“
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-17
Zeit und Existenz – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 12 bis 17
Länge: 11 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Warum Wahrnehmung wichtig ist – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.17
Länge: 5 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Gott ist der Tätige: Asha Nayaswami (Class 65) zu Sutra 4.11 (Rest) bis 4.17
Länge: 70 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


