tad asaòkhyeya-vâsanâbhiå citram api parârthaä saähatya-kâritvât
तदसंख्येयवासनाभिश्र्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्
Auch wenn die Übersetzung dieser Sutra abstrakt klingt, merkst du, wenn du dich hineinliest, wie nah die Gedanken des Yogasūtra an deinem eigenen Erleben sind. Der Geist, so bunt er sich gebärdet, ist nicht Selbstzweck – er arbeitet, damit du als stiller Zeuge überhaupt erkennen kannst, was Genuss, Leid oder Freiheit bedeutet. Wer das begreift, findet ein Werkzeug zur Meisterung von Alltag, Meditation und dem großen, nie endenden Spiel von Geist und Bewusstsein.
Kurz zusammengefasst
- Geist (Citta): Der Geist ist ein vielschichtiges, buntes Feld voller Eindrücke und Prägungen. Er ist wandelbar, aber nie das wahre Selbst.
- Vāsanās & Samskāras: Eindrücke und latente Tendenzen prägen den Geist unaufhörlich – wie alte Spuren im Sand, die den Weg der Wellen lenken.
- Purusha: Das reine Bewusstsein, unveränderlich und unberührt. Alles, was der Geist hervorbringt, geschieht für den Purusha.
- Übersetzungsvarianten: Verschiedene Versionen der Sutra betonen mal die Vielfalt des Geistes, mal seine Instrumentalität – am Kern ändert sich nichts.
- Vyāsa & Kommentatoren: Klassische Kommentare erklären, dass der Geist wie ein Haus oder Theater wirkt – zusammengesetzt und niemals Selbstzweck.
- Praxis & Meditation: In Meditation erkennst du den Geist als Kaleidoskop; im Alltag lernst du, Abstand zu nehmen und nicht jedem Gedanken zu folgen.
- Moderne Bezüge: Neurowissenschaft, Quantenphysik und Psychologie bestätigen die Beobachtung, dass Bewusstsein und geistige Inhalte nicht identisch sind.
- Quintessenz: Der Geist ist Werkzeug, nicht Herrscher. Du bist der stille Zeuge, der Purusha, für den all das Spiel des Geistes stattfindet.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Tad = das (bezieht sich auf Chitta);
- A = nicht;
- Samkhyeya, saṁkhyeya = zählbar;
- Asamkhyeya = unzählige; unzählbar; zahlreich; in seine Teile zerlegt; zahllose;
- Vasanabhih, vâsanâbhih = durch Vasanas; durch Wünsche; durch Triebe; Neigungen; Gewohnheitsmuster;
- Chitram = mannigfaltig; bunt; angefüllt; gesprenkelt;
- Api = obgleich; sogar; auch; trotzdem;
- Para = andere;
- Artham = Sinn;
- Parartham, parartha, parârtham = um eines anderen willen; etwas anderes zum Zweck habend; höheres Ziel; höchste Absicht; wahre Motivation; dient einem anderen; ist nicht selbstständig; das Interesse eines anderen; ein Objekt, das für einen anderen bestimmt ist.
- Samhatya, saṁhatya = Verbindung; Zusammenhang; verbunden;
- Karitvat, kâritvât = Akt; Handlung; Aktivität;
- Samhatya-karitvat, samhatya–kâritvât = infolge gemeinsamen Handelns;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Im vierten Kapitel des Yogasūtra, dem Kaivalya-Pāda, widmet sich Patañjali der Natur von Befreiung (Kaivalya) und den Kräften des Geistes (Siddhis). Er beschreibt, wie übernatürliche Fähigkeiten durch Geburt, Kräuter, Mantras, Askese oder tiefe Sammlung entstehen können. Dabei betont er: Diese Kräfte sind nicht das Ziel – sie sind Nebenprodukte der Praxis. Das eigentliche Ziel bleibt die vollständige Loslösung des Bewusstseins von der Materie, das Erkennen der Unterscheidung zwischen Citta (Geist) und Puruṣa (wahres Selbst). Der Weg dorthin führt über die Läuterung der Eindrücke (Saṃskāras), das Verständnis der Kausalität und die Erkenntnis, dass alles im Geist von vergangenen Eindrücken geprägt ist.
Bis Sutra 4.24 entfaltet sich der Gedankengang Schritt für Schritt: Zuerst wird erklärt, wie Kräfte entstehen und wie karmische Eindrücke weiterwirken. Dann folgt die Erkenntnis, dass Vergangenheit und Zukunft im Geist als Eindrücke angelegt sind. Der Geist selbst wird als wandelbar, vielfältig und zusammengesetzt beschrieben – immer gefärbt von unzähligen Eindrücken (Vāsanās). Dennoch existiert er nie für sich selbst, sondern ist stets parārtha – für einen anderen Zweck. Damit leitet Sutra 4.24 in eine zentrale Einsicht: Der Geist dient dem Purusha, dem unveränderlichen Bewusstsein, und ist nicht Selbstzweck.
Übersichtstabelle
| Abschnitt / Verse | Hauptthema | Kernaussage |
|---|---|---|
| 4.1–4.3 | Entstehung von Siddhis | Übernatürliche Kräfte entstehen durch Geburt, Substanzen, Mantras, Askese oder Sammlung – sind aber Nebenprodukte, nicht Ziel des Yoga. |
| 4.4–4.6 | Vielgestaltigkeit des Geistes | Viele Geisterformen entstehen aus einem Ursprung, werden jedoch durch Eindrücke und karmische Anlagen bestimmt. |
| 4.7–4.12 | Karma und Zeit | Handlungen sind weder nur gut noch nur schlecht; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren als Samen im Geist und bestimmen die Erscheinungen. |
| 4.13–4.17 | Natur der Erscheinungen | Phänomene sind durch die drei Guṇas bestimmt; die Welt zeigt sich je nach Wahrnehmung und Bewusstsein des Betrachters. |
| 4.18–4.23 | Geist und Zeuge | Der Geist wird vom Puruṣa durchdrungen, ist beobachtbar und erkenntnisfähig, bleibt aber wandelbar und nicht identisch mit dem Selbst. |
| 4.24 | Geist dient dem Selbst | Obwohl der Geist durch unzählige Vāsanās bunt gefärbt ist, existiert er nicht für sich selbst, sondern ausschließlich für den Purusha. |
Zum Verständnis dieser Sutra lies auch alle vier Sutras: IV 22-25:
Yoga Sutra IV-22: Selbsterkenntnis tritt ein, wenn der Geist nicht mehr von Ort Ort wandert und sich selbst wahr nimmt
Yoga Sutra IV-23: Wenn der Geist in der Lage ist, den Sehenden und das Gesehene widerzuspiegeln, versteht er alles
Yoga Sutra IV-25: Wer den Unterschied zwischen Geist und wahrem Selbst erkannt hat, hört auf, den eigenen Geist bzw. dessen Regungen als Ich zu verstehen
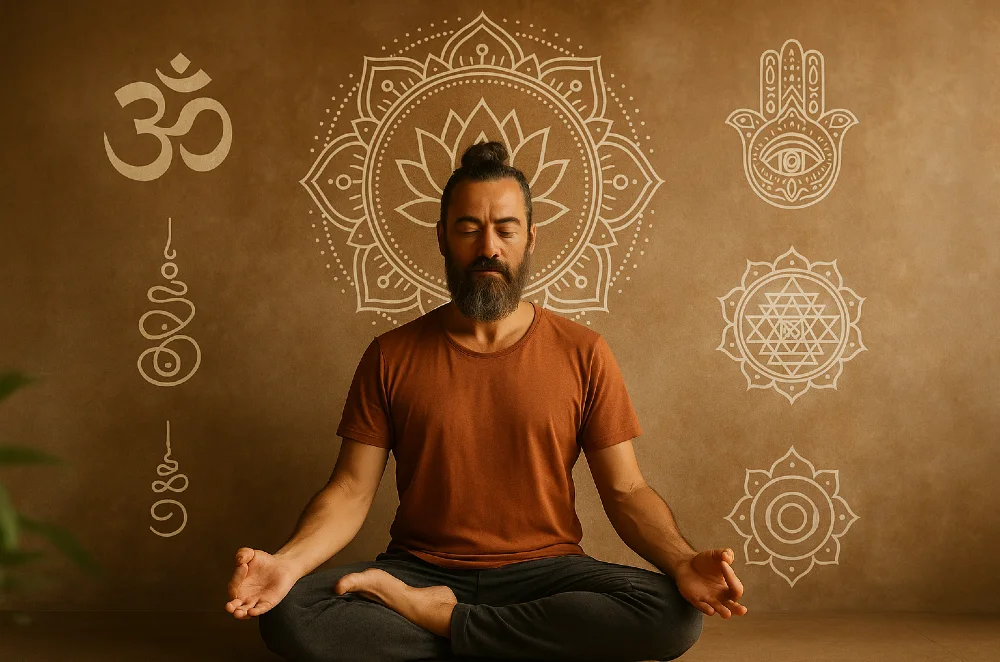
Yogasutra 4.24 – Geist dient dem Purusha
Yogasutra 4.24 lautet in Sanskrit “tad asaṅkhyeya‑vāsanābhiḥ citram api parārthaṃ saṃhatyakāritvāt”. Wörtlich bedeutet dies in etwa: “Der Geist (Citta), obwohl er von zahllosen latenten Eindrücken (Vāsanās) durchzogen ist, existiert für einen Anderen, weil er nur als zusammengesetztes Ganzes wirkt”. Anders ausgedrückt dient das Citta (der veränderliche, impressionierte Geist) nicht sich selbst, sondern stets einem Anderen – nämlich dem wahren Selbst, dem Puruṣha. Die Übersetungen dieser Sutra betonen: Der Geist ist gefärbt durch Unmengen von Vāsanās (latenten Eindrücken, Gefühlen, Wünschen, Prägungen ...) und dient deshalb oder dennoch einem höheren Ziel – er handelt nicht eigenständig, sondern zum Wohle des reinen Bewusstseins (Purusha).
Schlüsselbegriffe
- Geist (Citta) bezeichnet im Yoga die Gesamtheit von Wahrnehmung, Denken und Erinnern. Er ist wandelbar, mit Eindrücken gefüllt und wirkt wie ein Werkzeug des Bewusstseins.
- Vāsanās: Wörtlich „Duft, Geruch“ – im Yoga sind damit latente Eindrücke gemeint, die unterschwellig den Geist prägen. Sie sind feiner als Samskāras (Handlungsabdrücke), eher die Grundstimmungen, Tendenzen, Begierden, die sich aus vielen Erlebnissen ansammeln.
- asaṅkhyeya: „unzählbar“, „nicht berechenbar“. Gemeint sind nicht ein paar Erinnerungen, sondern eine unendliche Vielzahl von Eindrücken, die das Citta färben.
- Puruṣha ist das reine Selbst oder Bewusstsein, unveränderlich und unbewirkt. Er bleibt unberührt von den sinnlichen Eindrücken, er ist der stille Zeuge aller Vorgänge.
- Parārthaṃ (für einen anderen Zweck) signalisiert, dass der Geist nie für sich selbst existiert, sondern immer „für etwas Anderes“ – hier: für das Selbst (Purusha) – operiert.
- Saṃhatyakāritvāt bedeutet „aufgrund seiner Zusammengesetztheit“. Weil der Geist aus vielen Faktoren (Sinne, Körper, Einstellungen usw.) zusammengesetzt ist, kann er nicht autonom handeln, sondern nur in Kombination fungieren.
Übersetzungsvarianten und Deutungsarten
Die obige Sutra-Formulierung wird in verschiedenen Ausgaben und Kommentaren leicht unterschiedlich wiedergegeben, ohne den Kern zu verändern. Beispiele:
- “Der Geist ist mit zahllosen Eindrücken durchzogen; er existiert für ein Anderes, weil er als Zusammengesetztes wirkt”.
- “Obgleich das Bewusstseinsfeld mit unzähligen Vāsanās gefüllt ist, dient es dem höheren Zeugen-Bewusstsein, da es nur in Verbindung mit diesen Eindrücken wirkt”.
- Das deutsche Beispiel im Titel (“…dient dem wahren Selbst, denn beide sind verbunden”) fasst es sinngemäß: Alle Übersetzer stimmen darin überein, dass Citta nicht zu seinem eigenen Nutzen steht, sondern dem Purusha (dem höchsten Selbst) dient.
Diese Varianten sind grundsätzlich komplementär: Sie betonen alle die beiden Schlüsselideen – die Mannigfaltigkeit des Geistes (Anzahl der Vāsanās) und dessen Instrumentalität. Unterschiedliche Lesarten gibt es höchstens in der Hervorhebung: Einige Übersetzer legen mehr Nachdruck auf das “Dienst”-Verständnis (Instrumentalität), andere auf das “Farben/Färbung” des Geistes durch Vāsanās. Letztlich bleibt die Dualität von Geist (Prakṛti) und Bewusstsein (Purusha) erhalten: Der Geist erscheint als vielfältiges Phänomen, doch als Mittel zum Zweck eines unveränderlichen Selbst.
Chitta (Verstand/Geist) als Diener des Purusha (Seele/wahres Selbst)
In dieser Sutra gesteht Patanjali unserem menschlichen Bewusstsein – obwohl der Natur unterliegend, nicht selbstleuchtend, von zahllosen Wünschen verwirrt – einen Anteil an der spirituellen Verwirklichung, an der Beschreitung des Weges zur Erleuchtung, zu.
Govindan spitzt zu: “Zweck des individuellen Bewusstseins ist die Verwirklichung des Selbst.” Zwar hat unser Bewusstsein scheinbar viele Wünsche, aber durch den Prozess der “yogischen Reinigung”, vor allem dem vollen Gewahrsein im Augenblick, gelange man über alle diese Wünsche hinaus zur Selbst-Verwirklichung. Er betont:
“Wann immer wir bei diesem Spiel bewusst sind, >gewinnen< wir”.
Iyengar schreibt, dass unser Bewusstsein, unser Geist, auf mystische Weise ( “... durch eine verborgene Kraft …”) sowohl mit der Materie (Prakriti) als auch mit unserem wahren Selbst (Purusha) verbunden ist. Es will seinem Herrn, dem Menschen, sowohl die Verbindung zur Natur (Erfahrungen machen, Lust empfinden …) ermöglichen als auch auf dem Weg zu Kaivalya, zur Befreiung, behilflich sein. Chitta: ein Werkzeug der Seele.
Desikachar ergänzt knapp (S. 157): “Für sich allein genommen erfüllt der Geist keinen Zweck. Für sich allein kann er nicht arbeiten.” Auch Vyasa kommentiert, dass der Geist keinen Selbstzweck hat sondern als Diener des Selbst fungieren soll. Darum muss der Yogi die Gedanken (und Wünsche) im Geist entsprechend interpretieren und den Geist zu einer Form der Kooperation bringen, die ihn sein Wahres Selbst erkennen lassen. Mehr zu Vyasa unten, siehe auch die nächste Sutra IV-25:
Yoga Sutra IV-25: Wer den Unterschied zwischen Geist und wahrem Selbst erkannt hat, hört auf, den eigenen Geist bzw. dessen Regungen als Ich zu verstehen
Zu den Vasanas
Vasana mit zwei langen a steht im Sanskrit in der Regel für Wunsch, Verlangen oder Neigung. Es kann aber auch Idee, Vorstellung bzw. falsche Vorstellung meinen.
Swami Sivananda schreibt in “Erfolgreich leben und Gott verwirklichen”: “Der feinstoffliche Zustand des Verlangens, der Wünsche, Sehnsüchte und so weiter wird Vasana genannt. Manche Philosophen bezeichnen mit Vasana ein Bestreben oder eine Neigung. Andere definieren Vasana als „das blinde Hängen an Sinnesobjekten durch intensives Verlangen oder Begehren ohne Überlegung beziehungsweise Nachdenken“.
Es gibt zwei Arten von Vasanas: die „reinen“ (Shubha Vasanas; shubha = recht, gut erfreulich, wohltuend) und die „unreinen“ (Ashubha Vasanas). Die „reinen“, nicht ego- und wunschgetriebenen Shubha Vasanas befreien von Wiedergeburten, die „unreinen“, ego- und reflexgetriebenen Ashubha Vasanas schaffen Bindung. Sie lassen die Gedanken umherschweifen und bringen im Denkorgan eine Bewegung, eine Unruhe und ein Verlangen nach äußeren Objekten hervor.”
Shubha Vasanas
Als Beispiele für “reine” Wünsche nennt Sivananda den Wunsch, mit Weisen zusammen zu sein, sich spirituell zu üben, die Neigung zu Enthaltsamkeit oder zu Großzügigkeit, das Verlangen, anderen zu helfen oder Liebe zu geben.
Ashubha Vasanas
Sivananda sieht alle Bestrebungen, das Ego aufzublähen, als tendenziell unrein ein. Dazu gehören der Wunsch nach Ruhm, nach Ehre oder nach Macht. Ebenso das Bestreben, als besonders gelehrt zu erscheinen oder als Meister bewundert zu werden. Sivananda zählt aber auch ein emsiges Bestreben, besonders lange zu leben, schön und stark zu sein, Ablenkungen und Vergnügungen zu suchen oder besonders gut zu speisen zu den unreinen Wünschen. Und, last not least, zählt er Gefühle wie Hass, Lust, Gier, Ärger und Eifersucht zu den unreinen Vasanas.
Vasanas im Yogasutra
Im Yogasutra, im Vedanta und im Raja Yoga bezieht sich Vasana normalerweise auf Wünsche und Begierden, die ein spirituell Suchender ablegen sollte, so er zur Freiheit gelangen möchte. Die Sutras mit Vasana:
Yoga Sutra IV-8: Aus diesen drei Arten des Handelns (Karma) manifestieren sich [zu einem bestimmten Zeitpunkt] jene Wünsche oder Neigungen, für die günstige Bedingungen vorliegen
Yoga Sutra IV-9: Erinnerungen und unbewusste Prägungen sind einander ähnlich und überdauern Ortswechsel, Zeiten und Geburten. Darum wird jeder Wunsch bzw. jede Neigung irgendwann eine Folge haben (Karma)
Der Geist als Diener
Etwas differenzierter betrachtet Sukadev die Vasanas, die im Geist des spirituell Suchenden auftauchen. Sukadev sieht den Geist als Diener des Selbst, das erkannt werden möchte. So dienen auch die Vasanas im Geist immer irgendwie diesem Erkennen, ist in irgendeinem Kontext sinnvoll. Ärger und der Wunsch nach zorniger Reaktion, beispielsweise, eigentlich ein „unreiner“ Vasana, können dir die Kraft schenken, dich aus einer Situation zu befreien. Aber Sukadev mahnt, nicht allen diesen „Hilfsangeboten“ ungeprüft nachzugehen. Es gilt, weise zu differenzieren und vielen Vasanas eben auch nicht nachzugeben, auch wenn diese uns in irgendeiner Form etwas sagen wollen.

Klassische Kommentierungen
Die klassischen Yogaschriften liefern zahlreiche Kommentare zu 4.24, insbesondere aus der sāṃkhya-yogischen Tradition. Einleitend stellt Vyāsa fest, dass der Geist wegen seiner unzähligen Eindrücke nicht für sich selbst existieren kann. Er müsse “deshalb für einen anderen existieren, d.h. um dem anderen (Purusha) Genuss und Befreiung zu verschaffen, nicht für das eigene Ziel”. Vyāsa veranschaulicht dies mit dem Bild eines Hauses: Ein Haus, das aus vielen Einzelteilen gebaut ist, “kann nicht für sich selbst entstehen” – es dient dem Eigentümer. So muss auch das Citta, zusammengesetzt aus Sinnen und Wissen, dem Puruṣa dienen. In seinen Worten: “Sowohl Lust als auch Erkenntnis existieren nicht zu ihrem eigenen Zweck, sondern jeweils zum Wohle eines Anderen. Dieser Andere ist der Puruṣa, der sich in Gestalt von Genuss und Befreiung Ziele setzt”.
Auch Vācaspatimiśra (Tattvavaiśāradī, 9. Jh.) betont denselben Gedanken. Er räumt ein, dass es den Anschein hat, das Citta sei Subjekt und Objekt des Erlebens zugleich. Dennoch bestätigt er: “Trotz aller Eindrücke existiert der Geist nicht für sich selbst, sondern für einen anderen; warum? Weil er durch Kombination wirkt.” Damit nimmt er sogar eine Gegenfrage vorweg: Wenn der Geist so wirken könne, warum dann nicht für sich selbst? Antwort: Weil er eben zusammengesetzt ist. Vācaspatimiśra ergänzt, dass weder Lust noch Schmerz auf Purusha wirken können – nur auf das Citta. Nur ein Wesen, das „nicht durch Kombination handelt“, kann von den Zuständen begünstigt oder nicht begünstigt werden – eben der Purusha.
Unterschiede der Kommentare: Die großen Kommentatoren sind sich einig, heben aber verschiedene Aspekte hervor. Vyāsa nutzt Bilder (Haus, Akteure) und betont das Ziel (erlangen von Befreiung), während Vācaspatimiśra die Logik der Zusammensetzung („Kombination“) ins Zentrum stellt. Beide ziehen den Schluss, dass nur ein unveränderlicher Zeuge (Puruṣa) neben dem Citta existieren kann. (Andere Geisteslehren wie die Vaiśeṣika kommen zu ähnlichen Schlüssen über das Bewusstsein, jedoch meist ohne explizit den Yoga-Begriff Citta zu verwenden.) In den gängigen klassischen Quellen klingt an, dass der Geist letztlich seine Kraft und "Farbe" von den Vāsanās erhält, aber nur zum Zwecke eines anderen, höheren Selbst wirkt.
Moderne Auslegungen und Wissenschaft
Moderne Yogalehrende und Wissenschaftler ziehen oft Analogien, um Sutra 4.24 erfahrbar zu machen. Eine beliebte Metapher vergleicht den Geist mit einem Computer und das Purusha mit Elektrizität. So wie ein Computer aus vielen Teilen besteht, aber nur durch den unsichtbaren Strom betrieben wird, so “bekommt der Geist seine Lebenskraft vom reinen Bewusstsein”. Das Bewusstsein (Purusha) ist dabei die „unsichtbare Energiequelle“, die das Citta ermöglicht – selbst bleibt es aber unberührt und unendlich. Dieses Bild hilft, zu fühlen: Ohne das Licht des Bewusstseins wäre unser Denken bedeutungslos, genau wie der Chip ohne Strom.
Auch die Quantenphysik wird oft herangezogen: Der Beobachtereffekt in Experimenten zeigt, dass erst die Beobachtung (Bewusstsein) eine „Realität“ hervorbringt. Dies erinnert an die yogische Lehre, dass ohne Purusha (den Zeugen*) die Welt nicht „in Erscheinung“ tritt. Moderne Physiker wie Max Planck betonen, dass Bewusstsein fundamental sei. Ein aktueller Beitrag der Yogawissenschaft fasst es so: Laut Planck sei das Universum „mental und spirituell“ – ganz nach der yogischen Erkenntnis, dass „alles Brahman ist“. Das Yogasutra selbst lehrt, dass die erfahrbare Welt Projektionen des Geistes sind; Yoga praktiziert man, um diese Projektionen zu beenden und in den ungetrübten Purusha-Raum einzutreten.
In der Kognitionswissenschaft gibt es Konzepte, die nahelegen: Das bewusste Selbst unterscheidet sich von den Inhalten des Geistes. Einige Neurowissenschaftler sprechen etwa vom „nicht-dualen Zeugenbewusstsein“, das allen mentalen Inhalten zugrunde liegt. Dies entspricht etwa Purusha, der laut Sutra 4.24 unveränderlich als Beobachter aller Eindrucksmuster fungiert. In der Praxis bedeutet das: Wer meditiert, kann oft spüren, dass Gedanken unaufhörlich kommen und gehen, während ein ruhiges Gewahrsein im Hintergrund präsent bleibt. Dieses Gewahrsein ist – so die Sutra-Aussage – der Hauptnutznießer, dem der Geist dient.
Schließlich führen auch moderne Yoga-Lehrer alltägliche Beispiele an: So wie ein „effizienter Manager“ (das Citta) für den Geschäftsführer (Purusha) arbeitet, können wir im Üben spüren, wie wir die Kontrolle loslassen: Wir erkennen, dass wir nicht unser chaotisches Denken sind, sondern jenes stille Bewusstsein, das es betrachtet.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-24
In der Meditation
Wenn du dich hinsetzt, atmest, die Augen schließt, dann erlebst du sofort: der Geist ist bunt. Bilder, Geräusche, Erinnerungen, To-do-Listen. Ein Kaleidoskop, das sich nicht abstellen lässt. Genau hier kannst du Sutra 4.24 anwenden. Statt gegen den Strom zu kämpfen, beobachtest du: „Ah, da läuft wieder mein Citta-Programm, vollgestopft mit Vāsanās.“ Du bleibst Zeuge, nicht Schauspieler. Der Witz: In dem Moment, in dem du erkennst „dieser ganze Film läuft für das Bewusstsein, nicht umgekehrt“, beginnt eine stille Distanz.
Ein Beispiel: Stell dir vor, während der Meditation taucht die Erinnerung an ein Gespräch auf, das dich genervt hat. Normalerweise würdest du sofort wieder ins Diskutieren im Kopf einsteigen. Mit 4.24 im Hintergrund übst du: „Dieses Bild ist nur eine Bewegung des Geistes, der Dienstleister für mich, den Beobachter. Ich muss nicht aufspringen.“ Das fühlt sich an, als ob du dich innerlich leicht zurücklehnst, während der Geist weiter ackert. Und diese innere Zurücknahme – das ist die Erfahrung: Der Geist existiert für dich, nicht du für ihn.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Im Alltag
Alltag heißt: Das Kind schreit, der Chef ruft, die Kaffeetasse kippt um. Genau da kannst du die Sutra üben – nicht als Flucht, sondern als Erinnerung. Der Geist füllt sich sofort mit Reaktionen: „Mist, ich hab alles versaut“ oder „Immer ich!“ oder „Jetzt schnell putzen“. Stop. Kurzer Moment. Du erinnerst dich: „Mein Geist tobt, aber er ist nicht mein Selbst. Er spielt seine Muster ab – und ich darf Zeuge bleiben.“
Ein konkretes Beispiel: Du stehst im Stau, zu spät zum Termin. Gedanken rasen: Ärger, Selbstvorwürfe, Szenarien. Du atmest einmal tief durch und sagst dir: „Das ist nur mein Citta, bunt gefärbt von Eindrücken. Ich sitze hier als Purusha, und der Geist rennt für mich – nicht ich für ihn.“ Klingt vielleicht esoterisch, fühlt sich aber sehr nüchtern an: Ein Moment von Abstand, ein Lächeln, obwohl die Autos nicht schneller fahren.
Noch ein Beispiel aus der Kommunikation: Jemand kritisiert dich scharf. Sofort schießen Rechtfertigungen in den Kopf. Übung nach 4.24: „Okay, Geist liefert seine alten Verteidigungsmuster. Aber das bin nicht ich. Ich kann zuhören, ohne ins Karussell einzusteigen.“ Vielleicht reagierst du dann ruhiger – oder du schweigst kurz, was manchmal klüger ist als jede scharfe Antwort.
Quintessenz
Meditation ist das Labor, Alltag die Prüfung. In der Stille übst du, dein Kaleidoskop-Geist zu beobachten, ohne dich damit zu verwechseln. Im Alltag erinnerst du dich daran, dass das, was dein Kopf produziert, nicht dein Wesenskern ist. Es dient dir. Mal ist es nützlich, mal nur Rauschen. Aber es bleibt: Der Geist ist Werkzeug, Purusha der Zeuge.
Govindan empfiehlt zudem im Zusammenhang mit dieser Stura, sich darum zu bemühen, zu jeder Zeit, in angenehmen und unangenehmen Situationen, eine „freudige Bewusstheit” zu pflegen.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Vyāsa fragt zuerst: Warum existiert der Geist (Citta) überhaupt für einen anderen? Seine Antwort: Weil der Geist aus unzähligen Samskāras (Prägungen, Eindrücke, Erinnerungen) zusammengesetzt ist. Er ist nicht etwas Einfaches oder Eigenständiges, sondern etwas, das durch viele Faktoren entsteht und nur im Zusammenspiel wirkt.
Ein Bild verdeutlicht das: Ein Haus kann nicht für sich selbst entstehen. Es besteht aus vielen Teilen – Ziegeln, Holz, Lehm, Werkzeugen, Arbeitskraft. Zusammengesetzt ergibt es eine Form, die einem Menschen Schutz und Nutzen bietet. Aber niemand würde behaupten, das Haus existiere „für das Haus“. Es ist für jemanden da. Genauso ist es mit dem Geist: Er ist eine Kombination aus Eindrücken, Gedanken, Erinnerungen, Wahrnehmungen – und all das dient nicht dem Geist selbst, sondern einem Anderen.
Genuss und Befreiung – wofür der Geist wirklich da ist
Laut Vyāsa hat der Geist nur deshalb Funktionen wie Vergnügen oder Wissen, weil er damit etwas anderem dient: dem Puruṣa. Puruṣa ist das wahre Selbst, der unveränderliche Zeuge. Dieses Selbst kann durch den Geist zwei Dinge erfahren:
-
den Genuss (bhoga) der Welt, mit all ihren Sinneseindrücken und Freuden,
-
und die Emanzipation (apavarga, mokṣa), also die Befreiung von dieser Verstrickung.
Der Geist existiert also nicht, um sich selbst zu „füttern“, sondern um diese beiden Erfahrungen für den Puruṣa möglich zu machen.
Warum der Geist nicht Selbstzweck ist
Vyāsa geht noch einen Schritt weiter: Alles, was zusammengesetzt ist – wie der Geist, wie auch jedes andere Ding in der Welt – wirkt nicht für sich selbst. Es muss immer einem anderen Zweck dienen. Nur etwas, das nicht zusammengesetzt ist, kann für sich selbst existieren. Und das ist eben der Puruṣa.
Der Geist ist daher wie ein Werkzeug: fein, komplex, fast unerschöpflich bunt. Aber nie Selbstzweck. Er ist ein Diener. Der Herr, für den er arbeitet, ist das Bewusstsein selbst.
Wie schon bei den Übungen geschrieben:
- Für die Praxis bedeutet das: Wenn du dich in Gedankenstrudeln verlierst, erinnere dich: „Mein Geist ist ein Werkzeug. Er werkelt für mich, nicht ich für ihn.“ Dieses kleine Verschieben der Perspektive kann wie ein innerer Befreiungsschritt wirken.
- Vyāsa bringt mit seinem Kommentar etwas ans Licht, das in der Meditation erfahrbar wird: Vergnügen, Wissen, Sinneseindrücke – all das sind Phänomene. Sie sind real, aber sie sind nicht du. Sie existieren, damit du – als Puruṣa – erkennen kannst, dass du größer bist als dein Kaleidoskop-Geist.
👉 Eine andere Metapher zu dieser Sutra lautet: Der Geist ist wie ein prächtig ausgestattetes Theater. Die Kulissen sind Samskāras, die Schauspieler sind Eindrücke und Gedanken. Aber der Geist spielt nie für sich selbst. Das Stück wird aufgeführt für den einen Zuschauer im Publikum, der still und unverändert dasitzt: Puruṣa – dein wahres Selbst.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra I-41: Für den, der die Bewegungen des Geistes auf ein Minimum reduziert, verschmelzen Wahrnehmender, Wahrgenommenes und Wahrnehmung, so wie ein Kristall Form und Farbe eines Hintergrundes reflektiert. Das ist Samapatti (Verschmelzung).
Yoga Sutra II-18: Die wahrgenommenen Objekte sind aus den 3 Gunas mit den Eigenschaften Klarheit, Aktivität und Trägheit zusammengesetzt, bestehen aus Elementen und Wahrnehmungskräften – alles Wahrgenommene dient der sinnlichen Erfahrung und der Befreiung
Yoga Sutra II-19: Die Stufen der Eigenschaftszustände von den Grundbausteinen der Natur (den Gunas) sind spezifisch, unspezifisch, subtil-differenziert und undefinierbar.
Yoga Sutra II-22: Die Welt verschwindet für den, für den sie ihren Zweck erfüllt hat; für alle anderen existiert sie als gemeinsame Realität weiter
Yoga Sutra II-23: Der Sinn der (scheinbaren) Verbindung (Samyoga) unseres wahren Selbstes (Purusha) mit der äußeren Welt (Prakriti) besteht darin, dass wir unsere wahre Natur und deren Kräfte erkennen
Sutre IV-18: Herr des Geistes (Citta) ist das wahre Selbst (Purusha), es kennt infolge seiner unveränderlichen Natur immer alle Vorgänge im Geist (Citta)
Yoga Sutra IV-27: Jedoch kommt es aufgrund noch vorhandener Prägungen (Samskaras) immer wieder zu andersartigen Vorstellungen und damit zu Unterbrechungen (Brüchen – chidreṣu) dieser Unterscheidungskraft

Zusammenfassung
Es gibt in der Yoga-Tradition keine mir bekannten fundamental gegenläufigen Interpretationen zu dieser Sutra. Alle mir bekannten Kommentatoren bestätigen: “Geist” und “Selbst” sind verschieden. Der Geist ist bevölkert von Wünschen und Eindrücken (Vāsanās), kann aber nicht für sich selbst existieren – er dient immer dem höheren Selbst. In der Praxis heißt das: Jeder wahrgenommenen Empfindung könnte man begegnen mit dem Gedanken „Für mich passiert das alles nicht willkürlich – sondern es dient dem reinen Bewusstsein in mir“. Diese Einsicht – nüchtern wie eine Beobachtung, fast spielerisch wie ein Paradox – ist der Kern von 4.24. Durch die Sutra können Yogapraktizierende immer wieder die Vorstellung überprüfen, dass sie der stille Zeuge sind, der dem bewegten Geist übergeordnet ist. Dieses Bild hinterlässt Eindruck: Der Geist mag «bunt» sein, doch sein Zweck ist immer dienstbar, und das wirksamste Erleben ist jenes des unveränderlichen Purusha.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-24
Ruhe des Geistes führt zur Selbsterkenntnis – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 22 bis 26
Länge: 9 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Zweck des Chitta – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.24
Länge: 10 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34
Länge: 95 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


