Atîtânâgatam svarûpato ¢sty adhva-bhedâd dharmânâm
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तिअध्वभेदाद् धर्माणाम्
Zeit ist ein widerspenstiges Phänomen: sie rinnt uns zwischen den Fingern, klebt uns in Erinnerungen fest und lockt uns mit Zukunftsbildern. Patanjalis Yogasūtra 4.12 und seine alten wie modernen Kommentare drehen dieses Bild um – sie behaupten, Vergangenheit und Zukunft existierten in eigener Form, und nur die Gegenwart zeigt, was sichtbar sein soll. Wer sich darauf einlässt, entdeckt nicht nur Philosophie, sondern ein Werkzeug, das die eigene Wahrnehmung von Leben, Praxis und Bewusstsein leiser, tiefer und womöglich klarer macht.
Kurz zusammengefasst
- Vergangenheit und Zukunft: Sie existieren nicht bloß als Erinnerung oder Vorstellung, sondern besitzen ihre eigene Form – subtil, aber real.
- Gegenwart: Der Moment ist die Manifestation der Eigenschaften, die sonst verborgen bleiben. Er ist Schnittstelle von Vergangenheit und Zukunft.
- Moderne Deutungen: Autoren wie Iyengar oder Feuerstein interpretieren die Sutra psychologisch: Eindrücke der Vergangenheit und Anlagen der Zukunft prägen unser Handeln im Jetzt.
- Wissenschaftliche Parallelen: Relativitätstheorie, Block-Universum, Neurowissenschaften (Default-Mode-Network) und Zeitpsychologie zeigen ähnliche Einsichten: Zeit ist mehrschichtig und subjektiv erlebbar.
- Praxisbezug: In Meditation und Alltag lässt sich die Aussage erfahrbar machen, indem man Vergangenheit und Zukunft als innere Formen erkennt, ohne sich in ihnen zu verfangen.
- Einstein-Parallele: Sowohl Einstein als auch Patanjali beschreiben die lineare Zeit als Illusion – der Physiker von außen, der Yogi aus innerer Erfahrung.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Atita, atīta = Vergangenheit; vergangen(e) (Situation); zurückliegend;
- Anagatam, anâgatam, anāgataṁ = Zukunft; noch nicht geschehen(e) (Situation); bevorstehend;
- Svarupatah, svarûpatah, svarūpataḥ, svarupato = in ihrer eigenen (wahren) Form; von der eigenen Natur her; entsprechend dem eigenen wahren Wesen;
- Asti = existiert; sein;
- Adhva = Weg; Pfad; in der Abfolge; zeitliche Abfolge; Entfernung; Vorhaben; Ausrichtung; Straße; Kurs; Fluss;
- Bhedat, bhedāt = wegen der Unterschiedlichkeit; Verschiedenheit; Unterscheidung; reduzieren; segmentieren; aufgrund des Unterschieds;
- Adhva-bhedat, adhva–bhedât = wegen unterschiedlichen Pfaden;
- Dharmanam, dharmânâm, dharma = Natur der Phänomene; von Eigenschaften; von Pflichterfüllung; von Dharma; Aufgabe; Religion; Ordnung; Lehre; Gesetze des Universums; innere Eigenschaften; das Wesen; innere Aufgabe; Tugenden;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Yogasutra 4.12 lautet nun sinngemäß: „Vergangenheit und Zukunft existieren in ihrer eigenen Form; die unterschiedlichen Eigenschaften der Formen resultieren aus dem unterschiedlichen zeitlichen Ablauf.“ Diese etwas rätselhafte Aussage will sagen, dass Vergangenheit und Zukunft real sind – allerdings nicht so, wie die Gegenwart es ist. Patanjali behauptet, dass Dinge nicht einfach aus dem Nichts entstehen oder spurlos verschwinden. Was vergangen ist, existiert weiterhin in einer subtilen Form, und was zukünftig ist, existiert bereits in Keimform, auch wenn es sich noch nicht manifestiert hat. Die Gegenwart hingegen ist die aktuell wahrnehmbare Manifestation eines Objekts oder Ereignisses. Die Unterschiede zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegen nur daran, wann die Eigenschaften eines Dings in Erscheinung treten.
Mit anderen Worten: Alles, was war oder sein wird, ist bereits der Natur nach vorhanden – lediglich der Zeitfaktor bestimmt, ob wir es schon sehen können oder (noch) nicht. Das Sutra suggeriert damit eine Art zeitliche Einheit hinter der offensichtlichen Veränderung. Auf den ersten Blick klingt das vielleicht paradox oder wie ein poetisches Gedankenspiel über Zeit. Doch in der Yogaphilosophie ist es eine ernst gemeinte, quasi axiomatische Feststellung: Nichts Reales geht je ganz verloren, nichts Zukünftiges entstammt dem völligen Nichts.
Die Sutras IV-9 bis IV-11 (oder auch bis zu dieser Sutra) behandeln Samskaras (unterbewusste Prägungen) und Smritis (Erinnerungen). Sie lassen sich am besten im Gesamtzusammenhang verstehen, auch mit den beiden Sutras IV-7 und IV-8 zuvor.

Schlüsselbegriffe des Sutra
Um diese Aussage besser zu verstehen, lohnt es sich, die zentralen Begriffe von Sutra 4.12 zu definieren und zu erläutern:
- Atīta (Vergangenheit) – meint hier das bereits Manifestierte, das seine sichtbare Phase durchlaufen hat und nicht mehr aktiv ist. Vergangenes hat sich gezeigt und wieder verabschiedet, es existiert aber weiterhin in Form von Spuren oder Eindrücken.
- Anāgata (Zukunft) – bezeichnet das noch Nicht-Manifestierte, das aber künftig in Erscheinung treten wird. Zukünftiges ist gewissermaßen im Werden begriffen, so wie im Tonklumpen bereits die Form eines zukünftigen Tongefäßes angelegt ist.
- Svarūpa (eigene Form/Natur) – bedeutet wörtlich das eigene Wesen oder die wahre Form einer Sache. Im Kontext dieses Sutra heißt svarūpataḥ asti, dass Vergangenheit und Zukunft in ihrer eigenen Wesensform wirklich existieren, auch wenn diese Form für uns nicht wahrnehmbar ist.
- Dharma – hier nicht im moralischen Sinn, sondern als Eigenschaft, Merkmal oder Zustand. Patanjali spricht von „dharmāṇām“, den Charakteristiken eines Dings, die je nach Zeitphase unterschiedlich ausgeprägt sind. Ein Objekt (dharmin) besitzt mehrere mögliche Eigenschaften (dharmas), von denen im jeweiligen Moment nur bestimmte manifest sind.
- Adhva-bheda (Unterschied des Pfades) – ein Ausdruck für die zeitliche Abfolge bzw. den Unterschied der Zeitphasen. Patanjali sagt, dass die Verschiedenheit der Eigenschaften eines Objekts durch die unterschiedliche Zeitstrecke (adhvan) bedingt ist, in der sie auftreten. Einfacher: Das Wann entscheidet, welche Eigenschaft gerade sichtbar ist.
Mit diesen Begriffen im Hinterkopf lässt sich das Sutra so lesen: Vergangenheit und Zukunft bestehen jeweils in ihrer eigenen Wesensform weiter, denn die Eigenschaften eines Dinges zeigen sich je nach Zeitphase unterschiedlich. Was wir als Entstehen oder Vergehen wahrnehmen, ist lediglich der Wechsel der Eigenschaften über die Zeit, nicht das plötzliche Auftauchen eines gänzlich neuen oder das völlige Auslöschen eines bestehenden Seins.

Der Schmetterling trägt seine Vergangenheit – Raupe, Kokon – in sich. Auch wenn wir im Moment nur das fertige Insekt sehen, sind die früheren Stadien nicht ausgelöscht. Sie existieren als Spur, als Bedingung. In Vyāsas Sprache: Die Raupe ist die „subtile Form“ des Schmetterlings, der Schmetterling die „manifeste Form“. Die Verwandlung zeigt, wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschiedene Zustände derselben Substanz sind.
Yogasutra 4.12 – Vergangenheit, Zukunft und ihre eigenen Formen
Was ist Zeit und wie verändert sich die Welt?
Bei Rainbowbody lesen wir eine Erläuterung, die man so übersetzen könnte: „Das, was in der Vergangenheit geschehen ist (atita) und das, was in der Zukunft kommen wird (anagatam), sind nicht getrennte, isolierte Zustände, sondern existieren (asti) immer so, wie sie wirklich in ihrer wahren Form (swarupa) sind, in Wirklichkeit eine sich wandelnde Kontinuität.” Nur unser menschlicher Geist neigt dazu, diese Form aufzuspalten und so Trennungen und klare Unterschiede zu sehen.
Skuban: “Zeit ist nur eine Abfolge von Augenblicken, eine Bewegung von Moment zu Moment.” Siehe Yogasutra 3.53 und 3.54:
Yoga Sutra III-53: Durch Samyama auf den Augenblick und die Abfolge von Augenblicken erlangt der Yogi jenes Wissen, das auf der so gewonnenen Unterscheidungskraft beruht
Yoga Sutra III-54: Diese gesteigerte Unterscheidungskraft befähigt den Yogi, Unterschiede zwischen zwei ähnlichen Dingen zu erkennen, auch wenn diese sich nicht durch Art, Merkmale oder Ort unterscheiden
Iyengar geht soweit zu sagen, dass das Verstehen der Zeit von allen Bindungen erlöse. Ein Yogi, der “nicht mehr der Bewegung der Augenblicke folgt”, also nicht mehr sklavisch auf äußere Anreize reagiert, sondern stattdessen einen klaren Kopf und ein reines Herz bei vollem Gewahrsein bewahre, der wird frei von den Fesseln der Zeit und denen unseres Bewusstseins (Wünsche und Co.).
Das ist etwas, unabhängig vom Bewusstsein
Wim van den Dungen schreibt, Patanjali sei Realist. In den Sutra IV-12 bis IV-14 zeigt sich folgende Einstellung Patanajalis: „Raum, Zeit, die „Gunas“ und das „Dasein“ von Entitäten [Objekten] sind nicht nur Projektionen des Geistes, sondern inhärent existierende Dinge „da draußen“.“ Diese Aussage ist nicht selbstverständlich und es gibt Gegenmeinungen in der indischen Philosophie. Dazu später mehr, siehe auch:
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
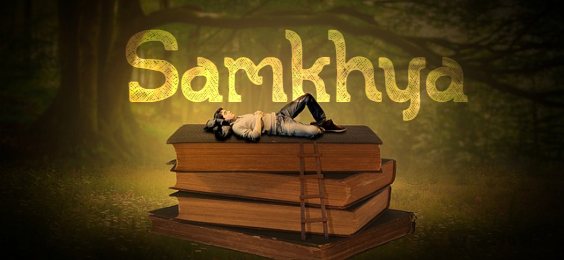
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
Das Samkhya ist eines der ältesten philosophischen Systeme indischer Herkunft. „Samkyha“ bedeutet wörtlich „Zahl“, „Aufzählung“ oder „das, was etwas in allen Einzelheiten beschreibt“. Hiermit ist die Aufzählung und Analyse jener Elemente gemeint, die gemäß Samkyha die Wirklichkeit bestimmen.
Allein das Wissen um diese Elemente soll bereits zur Erlösung vom Kreislauf der Wiedergeburten führen. Damit einher geht die Beendigung von drei Arten des Leidens (duhkha):
- adhyatmika (Leiden unter physischen oder psychischen Krankheiten),
- adhibhautika (von Außen zugefügtes Leid durch menschliche Gewalt oder Umwelteinflüsse),
- adhidaivika (Leid durch Naturgewalt, Umweltkatastrophen oder übernatürliche Phänomene).
Purusha, Prakriti, Guna
Das Universum und die Abläufe darin beruhen gemäß Samkyha auf zwei fundamentalen Prinzipien:
- Purusha: passiver aber bewusster Geist, auch Urseele, Weltgeist oder kosmisches Selbst genannt. Steht im Dualismus für Subjekt und das Wahre Selbst.
- Prakriti: aktive aber unbewusste „Urmaterie“, das Wahrnehmbare, das Benennbare oder „Natur“. Steht im Dualismus für Objekt und das Universum
Swami Satchidananda schreibt:
„Das Purusha ist das Wahre Selbst, das Purusha sieht. Prakriti ist alles andere.“
Es herrscht Uneinigkeit: Die Samkhya Philosophie sagt, dass es ein real existierendes Universum gibt. Die Vedanta-Lehre sieht alles als Maya, als Illusion an.
Prakriti und die Gunas
Der Urnatur Prakriti werden im Samkhya drei Gunas (Merkmale, Eigenschaften, von Hauer „Weltstoffenergien“ genannt) zugerechnet:
- Sattva (das Seiende, Reinheit, Klarheit). Gemäß Ayurveda-Lehre steht Sattva für Reinheit, Ausgeglichenheit, Balance und Neutralität. Charakterlich zeigt sich eine Sattva-Vorherschaft in Freigebigkeit, Gelassenheit, Zufriedenheit, Weisheit, Ausgeglichenheit und Toleranz. Menschen, die sich vorwiegend sattvisch ernähren sollen länger leben und gesünder alt werden. Als sattvische Nahrungsmittel gelten frische & reife Früchte, Honig, Milch, Reis, Weizen, Safran und Zimt.
- Rajas (Bewegung, Energie, Leidenschaft). Verantwortet Wandlung, Veränderung und Dynamik. Aber auch Zorn, Rastlosigkeit und Hektik.
- Tamas (Trägheit, Dumpfheit, Dunkelheit, Schwere). Eine Kraft, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit trübt und unsere Wirkkraft schwächt. Aber auch das Prinzip der Ruhe.
Sattva für den Yogi
Feuerstein (Buch bei Quellen ergänzen) schreibt: „Während aktive (rajas) und träge (tamas) Qualität dazu neigen, die Ich-Illusion aufrechtzuerhalten, erschafft die Qualität der Helligkeit (sattva), insoweit sie dominiert, die Vorbedingungen für das Befreiungsgeschehen. Daher erstrebt der yogin sattvische Konditionen und Zustände.“
Aber auch das Körper-Geist-System existiert auf Basis der drei Gunas. Als Yogi wisse man, dass alle drei Prinzipien miteinander wechselseitig verbunden sind. Jede Anhaftung an einen Zustand (Sattva ...) führt (ebenfalls) zu Leid.
Purusha
Purusha ist das Selbst, das allen fühlenden Wesen innewohnt. Durch Purusha erhalten Menschen, Tieren, Pflanzen und Götter ihre Empfindungsfähigkeit und Bewusstsein.
Des Menschen wahre und ursprüngliche Identität ist einzig und allein Purusha, die sich zum Zwecke des Erfahrens in Prakriti manifestiert hat, siehe Sutra II-18.
Nun verstrickt sich dieses Purusha in Prakriti, hält die zur Sphäre der Prakriti gehörigen Elemente und Bereiche irrtümlicherweise für Bestandteile seiner selbst. Daraus entsteht Leid.
Grundelement der Lehre des Samkhya für den nach Erlösung Strebenden ist deshalb, die beiden Substanzen Purusha und Prakriti und ihre Merkmale streng voneinander unterscheiden zu lernen.
Vedanta
Im nondualen Vedanta ist Prakriti nur eine Täuschung, Maya.
Physik und Quantentheorie
Betrachten wir den Bildschirm vor uns, so sehen wir gemäß der Physik ein Konstrukt aus Neutronen, Elektronen und Protonen, die alle auf einer eigenen Frequenz schwingen und um sich kreisen. Nahezu 100 Prozent des Bildschirmes besteht aus Vakuum! Nur unsere Sinne – die Sinne des Wahrnehmenden – machen daraus einen Monitor.
Die Quantenphysik macht alles noch verschwommener: Ob sich ein subatomares Partikel als Teilchen oder als Welle verhält, hängt vom Beobachter ab. Anders ausgedrückt: vom beobachtenden Bewusstsein. Vom Wahrnehmenden und dessen Wahrnehmung. Eigenschaften der Partikel wie dessen Lokalität können nicht vom Betrachter getrennt werden. Dies geht mehr in Vedanta (und Buddhismus)-Richtung als die Samkhya-Behauptung eines unabhängig von Purusha existierenden Universums Prakriti.
Klassische Kommentare und Interpretationen mit plastischen Beispielen
Klassische Gelehrte und Kommentatoren der Yoga-Sutra haben Sutra 4.12 ausführlich erläutert. Vyāsa, der wohl wichtigste antike Kommentator (Yoga-Bhāṣya), betont das Prinzip, dass nichts aus absolutem Nichtsein entspringt und nichts ins absolute Nichts verschwindet. Er schreibt, man könne niemals eine wirklich nicht-existente Sache hervorbringen, so wie auch kein Samen aufgehen kann, der gar nicht da ist.
Folglich müsse alles, was in Erscheinung tritt, schon irgendwie vorhanden gewesen sein – sei es als verborgene Anlage, Erinnerung oder Potenzial.
Vyāsa definiert daher klar:
„Die Zukunft ist das, was noch zur Manifestation kommen wird; die Vergangenheit ist das, was bereits erfahren wurde; und die Gegenwart ist das, was gerade in Wirksamkeit ist.“
Diese drei bilden zusammen eine Einheit als Gegenstand unserer Erkenntnis. Wir können ja über Vergangenes nachdenken oder Zukünftiges erwarten – das wäre unmöglich, wenn Vergangenheit und Zukunft überhaupt nicht existierten. Erkenntnis setzt einen realen Bezugspunkt voraus; wovon es gar kein Sein gibt, davon kann es auch kein Wissen geben. Patanjali’s Zeit-Trias ist also objektiv erfahrbar: Wir sagen „dieses Ereignis wird passieren“ oder „jenes ist schon passiert“, und wir beziehen uns damit auf real existierende Zustände – so real wie das, was gerade jetzt passiert.
Die klassischen Kommentare untermauern diese Idee oft mit Beispielen und Analogien.
- Ein beliebtes Gleichnis ist der Tonkrug: Die Form eines zukünftigen Kruges existiert schon im Tonklumpen, lange bevor der Töpfer ihn formt. Wird der Krug irgendwann zerschlagen, existiert er nicht mehr als Krug, aber die Materie und Form verbleiben als Scherben und als Idee – der Krug ist vergangen, nicht ins Nichts vernichtet.
- Genauso trägt ein Samenkorn die Essenz der Pflanze in sich: Ein Eichelsamen enthält unsichtbar bereits die ganze Eichenlinie der Vergangenheit und zugleich die Potenzialität einer zukünftigen Eiche samt aller kommenden Eicheln – im Jetzt erscheint er uns aber schlicht als gewöhnliche Eichel.
Diese Beispiele illustrieren Vyāsas Kernpunkt: Veränderung bedeutet nicht, dass etwas völlig Neues entsteht, sondern dass etwas Vorhandenes einen neuen Zustand annimmt. Die Eigenschaften wandeln sich, das Substrat (die Sache an sich) bleibt durch alle Zeiten bestehen.
Die Philosophie im Hintergrund ist das Sāṃkhya-Konzept des Satkārya-Vāda – die Lehre, dass die Wirkung bereits im Ursprung enthalten ist. Nichts Wirkliches kann völlig aus dem Nichts geschaffen werden, es wird nur aus einem latenten Zustand heraus entfaltet.
So erklärt Vyāsa weiter: Ursachen (Ursachenhandlungen, Hetu) können ein Ergebnis nur hervorbringen, wenn dieses Ergebnis prinzipiell schon existiert – eben noch unmanifest. Ein „effizienter Grund“ (nimitta) kann das bereits Angelegte ins Jetzt holen, aber er erschafft nichts völlig Neues.
Ein klassisches Beispiel im Kommentar:
- Der Butterhersteller erzeugt keine Butter aus dem Nichts; durch das richtige „Rühren“ bringt er bloß die Butter zum Vorschein, die im Milchprodukt schon als Möglichkeit enthalten war.
Entsprechend, argumentieren die Yogameister, wäre jede Bemühung um ein zukünftiges Ziel sinnlos, wenn dieses Ziel nicht irgendwie schon da wäre. Warum Yoga üben, um Befreiung (mokṣa) zu erlangen, wenn Erlösung an sich gar nicht existierte? Genau das fragt der Kommentator rhetorisch: Wieso sollten erfahrene Meister uns Praktiken empfehlen – „Tue dies, dann wird jenes geschehen“ –, wenn das Ergebnis in Wahrheit niemals eintreten könnte? Die Tatsache, dass spirituelle Übungen wirken, ist für die klassischen Interpreten ein Beleg dafür, dass das angestrebte Resultat (sei es höhere Erfahrung oder endgültige Befreiung) bereits real angelegt ist – sonst könnte es durch keine Handlung hervorgerufen werden.
Swami Vivekananda, ein moderner Kommentator (19. Jh.), fasste die Essenz dieses Sutras prägnant zusammen: „Die Idee ist, dass Existenz niemals aus Nicht-Existenz hervor geht. Die Vergangenheit und Zukunft existieren, wenn auch nicht in manifestierter Form, so doch in feiner Form.“ Damit übersetzt er die alte Lehre in knappe Worte, die auch heute noch einleuchten: Nichts, was ist, kann völlig aufhören zu sein – es ändert nur seine Form. Und nichts, was sein wird, kommt aus dem absoluten Off – es schlummert bereits im Verborgenen.
Interessant ist, dass einige klassische Kommentatoren auch diskutieren, wie Vergangenheit und Zukunft existieren. Sie betonen, dass Vergangenes und Zukünftiges nicht gleichzeitig mit der Gegenwart als greifbare Substanz auftreten – vergangenen oder zukünftigen Zuständen fehlt die gegenwärtige Manifestation. Nur die Gegenwart zeigt sich „voll entfaltet“ im Hier und Jetzt, während Vergangenheit und Zukunft in Abwesenheit der Gegenwart nicht sichtbar sind. Dennoch sind sie im Objekt begründet: „Zur Zeit einer Phase sind die anderen mit dem Substrat verbunden“, heißt es bei Vyāsa. Das heißt, in jedem jetzigen Ding stecken auch seine Vergangenheit (als Erinnerung, als Spur, als vorheriger Zustand) und seine Zukunft (als Anlage, als Möglichkeit).
- Ein weiteres Beispiel: Vergleichen könnte man es mit einem Stück Gold, das jetzt als Ring vorliegt: Im Gold schlummern zugleich die Möglichkeit eines künftigen Armreifs und die Realität früherer Formen (etwa eines unverarbeiteten Nuggets) – auch wenn man diese gerade nicht sieht.
Dieses Nebeneinander der Zeiten ist zwar für unsere Sinne verborgen, aber in der philosophischen Analyse klar voneinander unterscheidbar. Patanjali schiebt also einen Riegel vor wilde Spekulationen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sollen nicht vermengt werden, jeder Zeitzustand bleibt unterscheidbar (keine „Zeit-Suppe“, wie ein Kommentator warnend anmerkt). Aber es sind eben Zustände desselben Seins – nicht getrennte Existenzen ohne Verbindung.
Zusammengefasst liefern die klassischen Ausleger ein erstaunlich kohärentes Bild: Zeit ist eine Abfolge von Zuständen eines kontinuierlichen Seins. Das Sutra 4.12 untermauert die Vorstellung, dass das Universum im Grunde ein geordnetes Kontinuum ist, in dem alles zu seiner Zeit in Erscheinung tritt. Nichts real Existierendes geht je verloren, es wechselt lediglich von einer Zustandsform in eine andere. Diese Sichtweise steht in deutlichem Kontrast zu der Alltagsintuition, dass Vergangenes „weg“ und Zukünftiges „noch nicht da“ ist – laut Patanjali sind sie eben doch da, nur ... anders.
Moderne Auslegungen und wissenschaftliche Perspektiven
Spannend ist, dass Patanjalis Aussage heute aus verschiedenen Blickwinkeln neu beleuchtet wird – sei es durch moderne Yogalehrer, Psychologen oder sogar Naturwissenschaftler.
Moderne Kommentatoren tendieren dazu, Sutra 4.12 auch psychologisch zu deuten. So wird der Fokus weniger metaphysisch, dafür praxisnäher: Man interpretiert die „Vergangenheit“ und „Zukunft“ als innere Prozesse – als Erinnerung und Erwartung, die unseren jetzigen Moment beeinflussen.
Der Yogalehrer und Autor Ruben Vasquez etwa erläutert, viele unserer Eindrücke (Saṃskāras) aus vergangenen Handlungen seien im aktuellen Moment latent vorhanden und warten nur auf den geeigneten Auslöser, um zukünftig wieder aufzutauchen. Im Sinn von Yogasutra 4.12 könne man sagen: Jede Handlung hinterlässt Spuren im Gedächtnis oder Unterbewusstsein. Diese Spuren sind nicht aktiv sichtbar („nicht manifestiert“), aber sie verschwinden auch nicht einfach – sie lagern sich feinstofflich in uns ab, bis Bedingungen sie (wieder) hervorbringen.
Vergangenheit existiert also in Form solcher Prägungen fort. Gleichzeitig trägt jeder Moment die Keime der Zukunft in sich: Was wir jetzt säen (durch Taten, Gedanken, Reaktionen), kann in Zukunft zur vollen Pflanze wachsen.
Ein augenzwinkerndes Beispiel: Stell dir vor, du hast die Neigung, beim Packen deiner Arbeitstasche zerstreut zu sein – immer wieder passiert ein Missgeschick, etwa dass deine Wasserflasche nicht richtig zugeschraubt ist und alles durchweicht. Diese Tendenz ist ein Eindruck aus der Vergangenheit, der latent in dir existiert. Solange er unbewusst bleibt, wird er sich in Zukunft wohl wieder manifestieren (du wirst erneut etwas verschütten). Erst wenn du den Eindruck erkennst und durch neue Gewohnheiten überlagerst – etwa indem du dir angewöhnst, ganz präsent beim Flasche-Zuschrauben zu sein – änderst du den zukünftigen Ausgang.
In diesem sehr alltagsnahen Sinne lehrt Sutra 4.12, dass Vergangenheit und Zukunft im Jetzt angelegt sind und durch achtsame Praxis beeinflusst werden können. Für Yoga-Praktizierende ist das eine Einladung, bewusst im gegenwärtigen Moment zu handeln, um alte Muster aufzulösen und zukünftiges Leid gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Theorie wird so zu handfester Praxis:
Was jetzt in deinem Bewusstsein ist, entscheidet, welche deiner vielen eingebetteten Möglichkeiten tatsächlich Wirklichkeit wird.
Neben solchen psychologischen Deutungen gibt es auch faszinierende Anknüpfungspunkte in moderner Wissenschaft und Philosophie. In der Physik zum Beispiel existiert die sogenannte Block-Universum-Theorie. Sie besagt – laienhaft gesprochen – dass das Universum ein vierdimensionaler „Block“ aus Raum-Zeit ist, in dem alle Ereignisse ihren festen Platz haben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in diesem Modell gleichwertig real und bereits „vorhanden“, nur eben an unterschiedlichen Stellen des Zeitblocks. Der Ablauf der Zeit wird hier zur subjektiven Wahrnehmung – ähnlich wie Patanjali andeutet, dass die Zeitabfolge die Eigenschaften eines Objekts ändert, ohne dessen Existenz an sich auszulöschen.
Sogar Albert Einstein äußerte die Ansicht, dass die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur eine „hartnäckige Illusion“ sei. Für einen Physiker im Sinne der Relativitätstheorie ist es nicht abwegig zu sagen: Dein Geburtstagsfest vor 5 Jahren existiert irgendwo in der Raumzeit noch, genauso wie dein möglicherweise 5 Jahre vorausliegendes Jubiläum schon in der Raumzeit verankert ist – beides nur nicht hier und jetzt. Natürlich sind Yoga-Sutra und moderne Physik unterschiedliche Welten, doch die konzeptionelle Parallele – alle Zeiten existieren gleichzeitig auf ihre Weise – ist bemerkenswert. Der indische Weise und die moderne Wissenschaft treffen sich in der Idee, dass „Vergangenheit“ und „Zukunft“ irgendwie mehr als bloße Gedanken im Gehirn sind.
Apropos Hirn: Auch die Neurowissenschaften bieten einen interessanten Zugang. Psychologisch neigen wir nämlich stark dazu, entweder im Gewesenen zu schwelgen oder in Zukünftigem zu planen und zu sorgen. Unser Geist ist von Natur aus ein kleiner Zeitreisender – oft leider ein zerstreuter. Eine Harvard-Studie ergab, dass Menschen rund 47% ihrer wachen Zeit gedanklich nicht bei dem sind, was sie gerade tun, sondern bei Vergangenem oder Zukünftigem.
Noch bemerkenswerter: Diese mentale Wanderlust macht uns tendenziell unzufriedener. Ein Geist, der dauernd abschweift, ist statistisch gesehen ein unglücklicher Geist, stellten die Psychologen fest. „Unser mentales Leben ist in bemerkenswertem Ausmaß von Nicht-Gegenwärtigem durchdrungen“ schreiben die Autoren – das scheint tatsächlich der Default-Modus des menschlichen Gehirns zu sein. Interessanterweise bestätigen sie damit nur, was Yoga und Achtsamkeitslehren seit jeher sagen:
Glück lässt sich nur im gegenwärtigen Moment finden, nicht im ständigen Gedankenschweifen.
Die Harvard-Forscher formulierten es so: „Viele philosophische und religiöse Traditionen lehren, dass man Glück findet, indem man im Moment lebt… Diese Traditionen suggerieren, dass ein wandernder Geist ein unglücklicher Geist ist. Unsere Studie legt nahe, dass sie recht haben.“.
Neurowissenschaftlich korrespondiert dieses „Im Moment leben“ mit der Aktivität eines bestimmten Hirnnetzwerks. Das sogenannte Default-Mode-Netzwerk (Standardnetzwerk) im Gehirn wird immer dann aktiv, wenn unser Geist zur Ruhe kommt und nach innen wandert. Es ist jener Zustand, in dem wir vor uns hin denken – oft über uns selbst, Vergangenes oder Zukünftiges. Hirnforscher haben herausgefunden, dass Meditation und Achtsamkeitspraxis genau dieses Netzwerk beruhigen. Sobald wir unsere Aufmerksamkeit wirklich ins Jetzt bringen, fährt das Hintergrundrauschen des Default-Mode-Netzwerks herunter: Das ständige Grübeln, Pläne schmieden oder sich selbst beurteilen nimmt ab, und der Geist wird stiller.
Aus yogischer Sicht bedeutet das in gewissem Sinne: In tiefer Konzentration oder Meditation verschwimmen die Grenzen von Vergangenheit und Zukunft, weil der Geist nicht mehr unkontrolliert in diese Richtungen ausweicht. Man erfährt die Gegenwart intensiver und spürt vielleicht direkt, was Patanjali meinte – dass Vergangenheit und Zukunft letztlich im Hier und Jetzt verankert sind.
Natürlich könnte man einwenden, dass Patanjali ein metaphysisches Konzept beschreibt, während die Neurowissenschaft nur von subjektiver Wahrnehmung spricht. Doch für einen praktizierenden Yogi lösen sich solche theoretischen Unterschiede oft auf der Matte oder dem Meditationskissen. Im Erleben zeigt sich: Wenn der Geist zur Ruhe kommt, verliert die Zeit ihr übliches Gewicht. Alte Erinnerungen mögen aufsteigen, zukünftige Möglichkeiten mögen sich andeuten – aber alles erscheint als Teil des gegenwärtigen Bewusstseinsfeldes. Dieses Phänomen kann man durchaus als Bestätigung der Sutra-Aussage sehen, aber auf einer inneren Ebene: Vergangenheit und Zukunft existieren in ihrer eigenen Form innerhalb unseres Bewusstseins, und durch Yoga lernen wir, diese Formen wahrzunehmen, ohne von ihnen überwältigt zu werden.
Parallelen zwischen Einstein und Patanjali
Einsteins Perspektive
Das berühmte Zitat stammt aus einem Brief, den Albert Einstein 1955 an die Familie seines verstorbenen Freundes Michele Besso schrieb:
„Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion.“
Einstein bezieht sich auf die Relativitätstheorie: Zeit ist keine absolute Linie, die von einem „Jetzt“ zum nächsten springt, sondern Teil eines vierdimensionalen Kontinuums. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in diesem Raum-Zeit-Block gleichermaßen real, nur unser Bewusstsein erlebt sie nacheinander. Physikalisch betrachtet: Alles ist schon da, das Nacheinander ist eine Frage der Perspektive.
Patanjalis Perspektive (YS 4.12)
Patanjali formuliert fast poetisch:
„Vergangenheit und Zukunft existieren in ihrer eigenen Form. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Formen resultieren aus dem unterschiedlichen zeitlichen Ablauf.“
Das heißt: Vergangenheit und Zukunft verschwinden nicht ins Nichts, sondern bestehen in subtilen Formen fort. Die Unterschiede zwischen ihnen entstehen nur durch die Abfolge der Zeit, die bestimmt, wann ein bestimmter Zustand sichtbar wird.
Parallelen
- Gleichwertige Realität der Zeitphasen: Bei Einstein wie bei Patanjali sind Vergangenheit und Zukunft nicht bloße Illusionen, sondern real. Beide verneinen, dass die Gegenwart der einzige „wirkliche“ Zustand sei.
- Illusion der Abfolge: Einstein spricht von der Abfolge der Zeit als Illusion, Patanjali sagt: Die verschiedenen Eigenschaften treten durch den Ablauf der Zeit hervor. In beiden Sichtweisen ist die „Reihenfolge“ mehr eine Erscheinung als ein absolutes Faktum.
- Ganzheitliches Zeitverständnis: Beide laden uns ein, Zeit nicht linear und streng getrennt zu sehen, sondern als ein Ganzes, in dem alles irgendwo schon enthalten ist – ob als Raum-Zeit-Koordinate (Einstein) oder als Dharma in eigener Form (Patanjali).
Unterschiede
- Wissenschaft vs. Philosophie: Einstein argumentiert naturwissenschaftlich, gestützt auf mathematische Modelle und Relativitätstheorie. Patanjali spricht aus einer spirituellen Praxis- und Erfahrungstradition.
- Substanz vs. Bewusstsein: Bei Einstein existieren Vergangenheit und Zukunft objektiv im Raum-Zeit-Block, unabhängig vom Menschen. Bei Patanjali haben sie „eigene Formen“ in der Prakriti (der Natur) und im Bewusstsein – also immer im Zusammenhang mit Wahrnehmung und Befreiung.
- Zielsetzung: Für Einstein war es eine physikalische Erkenntnis, fast nüchtern, für Patanjali eine existentielle Weisheit: Wer die Gleichwertigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erkennt, durchschaut die Täuschung der Zeit und kann sich innerlich davon lösen.
Stell dir vor, du sitzt in einem riesigen Panorama-Kino. Auf der Leinwand liegt nicht nur die nächste Szene, sondern der ganze Film – Anfang, Mitte, Ende – gleichzeitig.
- Einstein würde sagen: Der Film ist schon vollständig da. Egal, ob du am Anfang oder am Ende schaust – die Bilder existieren alle gleichzeitig auf dem Zelluloid (oder heute: als Datei). Deine Wahrnehmung, Bild für Bild, erzeugt nur den Eindruck von „Jetzt“.
- Patanjali würde hinzufügen: Auch wenn du nur eine Szene gerade siehst, tragen die Figuren auf der Leinwand die Spuren ihrer Vergangenheit und die Keime ihrer Zukunft schon in sich. Die Handlung entfaltet sich nicht aus dem Nichts, sondern aus dem, was schon angelegt ist.
Das Panorama-Kino ist also die gemeinsame Metapher: Alles ist da – aber was wir erleben, hängt davon ab, wo der Projektor gerade steht und wohin wir unseren Blick richten.
So wird klar: Einstein beschreibt den Raum-Zeit-Film von außen, Patanjali den Erfahrungsfilm im Bewusstsein von innen.
Man könnte es vielleicht auch so ausdrücken: Einstein lieferte eine kosmische Landkarte, Patanjali eine innere Gebrauchsanweisung.
Beide betonen: Zeit ist nicht das, wofür wir sie im Alltag halten. Sie ist mehrschichtig, gleichzeitig, verwoben. Während Einstein uns zeigt, dass dies physikalisch so ist, erinnert Patanjali daran, dass wir es erfahren können – in der Meditation, im Beobachten von Eindrücken, im Bewusstsein, dass Vergangenheit und Zukunft auch jetzt in uns wirken.
Gerade der Brückenschlag zwischen beiden Stimmen macht das Sutra heute so faszinierend: Ein antiker indischer Yogi und ein moderner Physiker treffen sich darin, dass Zeit kein linearer Herrscher ist, sondern eine Illusion, die sich durchschauen lässt.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-12
In der Meditation
Setz dich hin, schließ die Augen, atme. Das Übliche. Doch statt den Atem zu beobachten, probier etwas anderes:
- Vergangenheit fühlen
Stell dir einen Moment aus deinem Leben vor, der noch eine Spur in dir trägt. Vielleicht eine Begegnung, vielleicht ein Fehler, vielleicht ein schöner Augenblick. Lass ihn nicht als Film laufen, sondern spüre nur: Da ist etwas in mir, das war. Beobachte, wie dieser Eindruck jetzt in deinem Körper auftaucht – vielleicht als Wärme, vielleicht als Knoten im Bauch. Plötzlich merkst du: Vergangenheit ist nicht weg, sie ist ein Abdruck, der sich hier und jetzt meldet. - Zukunft kosten
Danach dreh den Spieß um: Erinnere dich an etwas, das noch nicht geschehen ist, aber bevorsteht – ein Gespräch, ein Projekt, vielleicht einfach das Abendessen. Fühl, wie sich dieses „Noch-nicht“ jetzt bemerkbar macht. Nervosität? Vorfreude? Es ist erstaunlich: Zukunft hat bereits eine Farbe, einen Geschmack in deinem Inneren. - Alles zurück ins Jetzt holen
Schließlich geh wieder auf den Atem. Er ist die Brücke: Jeder Atemzug ist Gegenwart, genährt von Spuren der Vergangenheit und Samen der Zukunft. So merkst du unmittelbar, was Patanjali andeutet: Vergangenheit und Zukunft sind Formen, die im Jetzt mitschwingen.
Es fühlt sich ein bisschen so an, als würdest du einen Fluss sehen: Unten rauscht das Wasser, das schon vorbei ist, oben kommt das, was noch kommt – und du sitzt am Ufer und siehst, dass beides denselben Fluss bildet.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Im Alltag
Meditation ist schön und gut, aber die eigentliche Probe kommt zwischen E-Mails, Einkaufsliste und klemmender Badezimmertür. Wie kannst du dort mit 4.12 üben?
- Beispiel 1: Streit im Büro
Du hörst den Tonfall eines Kollegen, und sofort flammt in dir ein alter Ärger auf. Das ist Vergangenheit, die in dir weiterlebt. Normalerweise würdest du reflexartig reagieren. Doch wenn du dir sagst: „Aha, das ist nur die Form der Vergangenheit, die sich gerade meldet“ – dann atmest du einmal tief, und plötzlich hast du die Wahl. Vergangenheit ist da, aber sie bestimmt nicht deine Gegenwart. - Beispiel 2: Warten auf den Bus
Du schaust auf die Uhr, der Bus kommt nicht, und sofort entsteht Zukunfts-Kino: „Ich komme zu spät, mein Tag ist im Eimer.“ Das ist Zukunft, die dir schon jetzt die Laune verderben will. Wenn du erkennst: „Das ist nur die Form der Zukunft, die noch nicht da ist“ – dann kannst du dich zurücklehnen, die Sonne auf dem Gesicht fühlen und beschließen, dass du nicht auf eine noch-nicht-existierende Katastrophe reagierst. - Beispiel 3: Familienfoto
Du hältst ein altes Bild in den Händen. Vielleicht rührt es dich, vielleicht schmerzt es. Aber statt nur in Nostalgie zu versinken, kannst du wahrnehmen: „Dieses Bild zeigt nicht nur Vergangenheit. Es zeigt, dass Vergangenheit jetzt in mir lebendig ist.“ In diesem Moment erkennst du, wie Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht getrennte Inseln sind, sondern ein Kontinent.
Mögliche Überlegungen
Überlege dir einmal, was diese Sutra als Konsequenz wirklich bedeuten würde. Wenn alles schon immer da war und immer sein wird, sich (nur) in seiner Form wandelt. Was gäbe es dann noch zu erreichen im Leben? Wozu all das Streben nach höher, schneller, weiter? Nach Bedeutung?

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.12 (über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) im Detail
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Oben haben wir Vyasas Kommentar schon einmal kurz dargestellt, hier gehen wir noch einmal im Detail darauf ein.
Kern der Aussagev von Vyasas Kommentar
Vyāsa macht eine radikale Behauptung: Was existiert, kann nicht ins Nichts verschwinden. Und was nicht existiert, kann nicht plötzlich ins Sein treten.
Damit erklärt er: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben jeweils ihre eigene Realität – auch wenn sie sich unterschiedlich zeigen.
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
-
Vergangenheit: Das, was bereits erlebt wurde. Sie existiert weiterhin, wenn auch subtil, als Eindruck und als Spur.
-
Gegenwart: Das, was gerade aktiv ist, was sich im „Betrieb“ befindet. Nur hier treten Eigenschaften sichtbar hervor.
-
Zukunft: Das, was noch erscheinen wird. Sie ist schon als Möglichkeit da, aber noch nicht in voller Entfaltung.
Diese drei zusammen bilden die dreifache Substanz, die auch das Objekt unserer Erkenntnis ist. Vyāsa argumentiert: Wären Vergangenheit und Zukunft nicht real, könnten wir auch kein Wissen über sie haben. Man kann nicht von etwas sprechen oder es erfahren, wenn es überhaupt nicht existiert.
Ursachen und Früchte
Ein wichtiger Gedanke: Handlungen (karman) bringen Früchte hervor, doch diese Früchte müssen bereits „angelegt“ sein.
-
Das Mittel (z. B. eine Handlung, eine Übung, ein spirituelles Ritual) erschafft keine neue Realität aus dem Nichts.
-
Es bringt nur das hervor, was schon vorhanden, aber noch unmanifestiert ist – ähnlich wie ein Same, der keimt, sobald die Bedingungen stimmen.
Das bedeutet: Auch das höchste Ziel, die Befreiung (mokṣa), ist nicht etwas völlig Neues. Es ist bereits als Möglichkeit in uns angelegt, sonst wäre es sinnlos, dafür zu üben.
Substrat und Eigenschaften
Vyāsa führt weiter aus: Jedes Ding besitzt ein Substrat (dharmī), das durch verschiedene Eigenschaften (dharmas) charakterisiert ist. Diese Eigenschaften folgen einer bestimmten Ordnung der Existenz, je nachdem, in welcher Zeitphase sie erscheinen.
-
In der Gegenwart tritt die Eigenschaft offen zutage.
-
In der Vergangenheit oder Zukunft bleibt sie zwar vorhanden, zeigt sich aber auf andere, subtilere Weise.
Alle drei Zeitmodi – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – sind also immer mit dem Substrat verbunden. Sie verschwinden nicht einfach, sondern wechseln nur ihren Status.
Verständlicher Vergleich
Man könnte sagen: Die Zeitphasen sind wie Rollen in einem Theaterstück.
-
Eine Rolle tritt auf die Bühne (Gegenwart).
-
Eine andere ist gerade hinter den Kulissen (Zukunft).
-
Eine dritte hat die Bühne verlassen (Vergangenheit).
Aber alle gehören weiterhin zum Stück, sie sind Teil des Drehbuchs. Nur weil ein Schauspieler gerade nicht sichtbar ist, heißt das nicht, dass er nicht existiert.
Bedeutung für die Praxis
Für den Yoga-Weg bedeutet dies:
- Vergangenheit bleibt in Form von Eindrücken und Mustern wirksam.
- Zukunft ist nicht völlig offen, sondern bereits als Potenzial angelegt.
- Gegenwart ist der Moment, in dem diese Kräfte sichtbar werden – und auch der Punkt, an dem wir bewusst eingreifen können.
Die Botschaft ist klar: Alles, was wir tun, zählt. Nichts geht verloren, nichts kommt aus dem Nichts. Das kann beruhigend sein – und zugleich herausfordernd, weil wir Verantwortung tragen für das, was wir in die Zukunft pflanzen.
👉 Vyāsas Kommentar macht deutlich: Zeit ist nicht ein Strom, in dem die Vergangenheit verschwindet und die Zukunft noch nicht da ist. Sie ist ein Kontinuum von Formen, die je nach Moment anders erscheinen. Das zu begreifen könnte verändern, wie wir uns selbst und unsere Handlungen wahrnehmen – weniger als isolierte Punkte, mehr als Fäden in einem größeren Gewebe.

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra III-14: Frühere (śānta), momentane (udita) und zukünftige (avyapadeśya) Eigenheiten bzw. Beschaffenheiten (dharma) eines Objektes basieren auf einem grundlegenden Eigenschaftsträger (dharmin)
Yoga Sutra III-16: Mit Anwendung von Samyama auf die drei Arten der Veränderung (Form, Zeit und Zustand) wird Wissen um Vergangenheit und Zukunft erlangt
Yoga Sutra IV-33: Krama, das Kontinuum bzw. die Abfolge von Momenten und die damit verbundene Transformation, wird vom Yogi erkannt, wenn die Wandlungen der Gunas enden

Zusammenfassung
Warum ist dieser Vers 4.12 für Yoga-Praktizierende und Lehrende relevant? Zum einen liefert er philosophischen Halt – eine Sicht der Welt, in der nichts, was wir tun, verlorengeht, und nichts, was kommt, grundlos ist. Unsere Erfahrungen haben Bedeutung und Konsequenz über die Zeit hinaus. Das kann Verantwortungsbewusstsein fördern (jede Handlung zählt, da sie Spuren hinterlässt) und zugleich Gelassenheit geben (Vergangenes ist nicht „weg“, es ist verarbeitetes Leben und kann uns sogar Weisheit spenden, anstatt uns zu verfolgen).
Zum anderen erinnert Sutra 4.12 daran, im Jetzt verankert zu bleiben, da das Jetzt der Schnittpunkt von gestern und morgen ist. Wie ein Meister es formulierte: Die Vergangenheit und die Zukunft begegnen sich in jedem Atemzug der Gegenwart. Wenn wir diese Gegenwart voll bewusst erleben, erfüllen wir sowohl die Lehren der alten Yogis als auch die Empfehlungen moderner Psychologie.
Praxisnähe schlägt Theorie – Patanjali bietet uns hier beides an: eine tiefe Theorie der Zeit und einen praktischen Wink, achtsam zu leben. Denn letztlich sind solche Sutren keine trockenen Dogmen, sondern Einsichten in die Natur unseres Geistes und der Welt, die wir ganz real erfahren können.
Fazit: Yogasutra 4.12 verbindet auf beeindruckende Weise antike Philosophie mit zeitloser Erfahrung. Vergangenheit und Zukunft sind nicht bloß Illusionen, sondern Bestandteile eines größeren Ganzen – sei es in der metaphysischen Struktur der Natur oder im Innenleben unseres Geistes. Alte Meister wie Vyāsa erklärten uns, dass alles seine Zeit hat und hatte, moderne Stimmen nicken zustimmend, ob auf der Yogamatte oder im Labor. Für den Yogaweg bedeutet das: Wir ehren die Vergangenheit, ohne in ihr steckenzubleiben; wir begrüßen die Zukunft, ohne ihr blind hinterherzuhecheln – und wir üben uns darin, die Gegenwart als den Ort zu erkennen, an dem sich beide in ihrer „eigenen Form“ treffen. So wird Patanjalis Sutra zu mehr als einer philosophischen Fußnote – vielleicht zu einer lebendigen Erkenntnis über die Zeit, die im Alltag spürbar wird.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-12
Zeit und Existenz – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 12 bis 17
Länge: 12 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Essenz von Vergangenheit und Zukunft – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.12
Länge: 10 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Gott ist der Tätige: Asha Nayaswami (Class 65) zu Sutra 4.11 (Rest) bis 4.17
Länge: 70 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


