te vyakta-sūkṣmāḥ guṇa-atmānaḥ
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः
Wieder – wie so häufig im 4. Kapitel – eine rätselhafte Sutra, die viele Kommentare auf den Plan ruft.
Nach dem Samkhya (altes indisches Philosophiesystem) ist das Universum (die Urmaterie Prakriti) durch drei Gunas, meint wesentliche Eigenschaften oder Kennzeichen, charakterisiert: Tamas (steht für Trägheit, Dunkelheit, Chaos), Rajas (Rastlosigkeit, Bewegung, Energie) und Sattva (Klarheit, Güte, Harmonie).
Yogasūtra 4.13 erklärt, dass alles Wahrnehmbare und auch das noch Ungeborene aus diesen drei Guṇas besteht. Was trocken klingt, entpuppt sich als Einladung, den eigenen Alltag mit neuen Augen zu sehen – denn wer erlebt und bewusst wahrnimmt, dass selbst Gedanken, Erinnerungen und Gefühle nur Spielarten dieser drei Grundkräfte sind, genießt beispielsweise Gelassenheit an Stellen, wo zuvor Drama herrschte.
Dieser Artikel verbindet klassische Kommentare von Vyāsa und Śaṅkara mit modernen Deutungen, psychologischen Studien und praxisnahen Übungen – ein Versuch, Philosophie aus dem Elfenbeinturm auf die Yogamatte und mitten in den Alltag zu holen.
Kurz zusammengefasst
- Manifest und subtil: Alles, was existiert, ist entweder sichtbar (manifest) oder unsichtbar, aber angelegt (subtil). Beides ist Ausdruck der Guṇas.
- Drei Guṇas: Sattva (Klarheit), Rajas (Aktivität) und Tamas (Schwere) sind die Grundqualitäten der Natur. Jede Erscheinung ist ihre Mischung.
- Vyāsa: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden sich nur durch den Grad der Manifestation – ihre Essenz bleibt stets die der Guṇas.
- Śaṅkara: Was wir wahrnehmen, ist nur eine begrenzte Störung im Meer der Guṇas – die eigentliche Natur bleibt uns verborgen.
- Feuerstein: Er betont die Übung in Unterscheidungskraft: alles Erlebte als Gunas erkennen, nicht als das eigene Selbst.
- Eliade: Für ihn ist das Sutra Beweis für eine archaische, aber kohärente Kosmologie, die Befreiung ermöglicht, weil alles nur Spiel der Guṇas ist.
- Moderne Wissenschaft: Studien verbinden die Guṇas mit Persönlichkeitsmustern und Emotionen; Parallelen zur Polyvagal-Theorie sind erkennbar.
- Praxis: Durch Beobachtung im Alltag (z. B. Ärger = Rajas, Müdigkeit = Tamas, Klarheit = Sattva) lassen sich die Guṇas als lebendige Realität erfahren.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Te = sie; diese; der, die, das;
- Vyakta = manifestiert; offensichtlich; entfaltet; offenbar; wahrnehmbar; sichtbar; grobstofflich;
- Sukshma, sûkshma = subtil; unmanifestiert; fein; feinstofflich;
- Guna, guṇa = die drei Eigenschaften der Natur; physisch; Wirkkräfte;
- Atmana, atmānaḥ = das Absolute; spirituell; metaphysisch; Seele; das Selbst; Hauch; Bewusstsein; Essenz;
- Gunatmanah, gunâtmânah = von der Natur der Gunas; die drei Grundbausteine der Materie; grundlegende Kräfte, aus denen die Natur besteht;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
„Diese Eigenschaften sind manifest oder subtil und bestehen aus den drei Gunas.“ – So lautet eine mögliche Übersetzung von Yoga-Sūtra 4.13. Patanjali bringt hier in wenigen Worten einen zentralen Gedanken des Yoga auf den Punkt: Alles, was existiert – sei es grob manifestiert (sichtbar, spürbar) oder verborgen subtil (unsichtbar, nur als Möglichkeit vorhanden) – besteht aus den drei grundlegenden Gunas, den Ur-Eigenschaften der Natur. Im Klartext: Die gesamte erfahrbare Welt setzt sich aus drei „Qualitäten“ zusammen, die in immer neuer Mischung sämtliche Phänomene hervorbringen. Diese Idee klingt zunächst abstrakt, doch sie ist äußerst praxisnah: Sie lehrt uns Yogis, die Welt und auch unser eigenes Innenleben als Spiel dieser Grundkräfte zu verstehen – und uns nicht zu sehr damit zu identifizieren.

Definition der Schlüsselbegriffe: Manifest, Subtil, Gunas
Um die Aussage der Sutra voll zu durchdringen, lohnt zunächst ein genauer Blick auf die Schlüsselbegriffe:
- Manifest (vyakta) bedeutet im Yogasutra-Kontext „offen zutage getreten“. Es meint alles, was sich aktuell in konkreter Form zeigt – das Sichtbare, Greifbare, das zur Erscheinung gekommene. Ein manifestes Dharma (Eigenschaft/Form) ist z. B. ein gerade vorhandener Gegenstand oder ein fühlbarer Gedanke.
- Subtil (sūkṣma) dagegen ist das Feine, Verborgen-Vorhandene. Subtil können Dinge in zweierlei Hinsicht sein: Entweder so feinstofflich, dass sie unseren groben Sinnen entgehen (z. B. Energien, Tendenzen), oder noch latent, also als Möglichkeit angelegt, aber (noch) nicht manifestiert. Patanjali bezieht sich hier insbesondere auf die verborgenen Formen in Vergangenheit und Zukunft: Ein Same im Boden etwa ist die subtile Form des später manifesten Baumes; unsere unbewussten Eindrücke sind die subtilen Vorstufen künftiger Erfahrungen.
- Die drei Gunas schließlich sind die drei grundlegenden Eigenschaften oder „Stränge“ der Natur. Dazu gleich unten mehr.

Die drei Gunas als Bausteine der manifesten und subtilen Wirklichkeit
Letztlich, so sagt Patanjali in dieser Sutra, entspringt und manifestiert sich alles aus den drei Gunas, den Grundeigenschaften der Natur. All die vielen Dinge in dieser Welt entstehen aus den drei „Grundqualitäten“ der Schöpfung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mischen und verflechten sich mit den Gunas.
Yoga-Sutra 4.13 knüpft an vorherige Verse an, die von Zeit, Veränderung und latenten Eindrücken sprechen. Patanjali stellt klar: Egal ob eine Eigenschaft oder Form gerade sichtbar da ist (vyakta, manifest) oder nur angelegt und unsichtbar (sūkṣma, subtil) – ihre Essenz sind die drei Gunas. Nichts in der Natur entzieht sich diesen drei Grundkräften. Der klassische Kommentator Vyāsa erklärt dazu, dass selbst unsere mentalen Eindrücke (Saṁskāras) und Erinnerungen (Smṛtis) im Jetzt wahrnehmbar sind, während sie in Vergangenheit oder Zukunft lediglich unmanifestierte, subtile Anlagen bleiben – doch ob manifest oder nicht, sie bestehen immer aus den Gunas.
Mit anderen Worten: Alles, was war, ist oder sein wird, ist aus dem „gleichen Stoff“ gemacht. Patanjali betont hier die vollständige Durchdringung der Natur durch die drei Urqualitäten. Nur das reine Bewusstsein (Purusha) ist davon ausgenommen – ein wichtiger Hinweis: Purusha, unser wahres Selbst, ist von anderer Natur als alle materiellen oder mentalen Erscheinungen.
Was sind die Gunas?
Der Begriff Guna (Sanskrit ursprünglich Schnur, Faden; später: Eigenschaft, Qualität) steht im philosophischen System des indischen Samkhya (und später im hinduistischen Denken) für drei Qualitäten jener Kräfte, aus denen die Urmaterie Prakriti zusammengesetzt ist.
Klassische Texte vergleichen die Gunas mit den Fäden eines Seils: So wie ein Seil aus drei ineinander gewundenen Strängen besteht, ist auch jede Manifestation aus den drei Gunas in Kombination geformt. Die Samkhya-Philosophie, auf der Patanjali aufbaut, lehrt diese drei Urqualitäten als Konstituenten der Prakriti (Ur-Natur). Welche drei sind das genau?
- Sattva – oft übersetzt als Reinheit, Licht, Harmonie, Klarheit und Güte.
Sattva ist die Qualität der Klarheit, Leichtigkeit und Erkenntnis. Wenn Sattva vorherrscht, zeigen sich Eigenschaften wie Ruhe, Lichtheit, Weisheit, Glückseligkeit und Frieden. Sattva wird mit Licht oder auch der Farbe Weiß assoziiert. Im Menschen äußert es sich z.B. als klarer Geist, Ausgeglichenheit, Güte und Einfühlungsvermögen.
Sattva ist bei Yogis hoch im Kurs. In der Gita wird geraten, dass man sattvig leben solle. Darin sagt Krishna, dass Menschen, bei denen Sattva vorherrscht, die Götter verehren (im Gegensatz zu Dämonen, Geistern und Gespenstern, welche von denen verehrt werden, bei denen Tamas oder Rajas überwiegt). Satvige Nahrung gilt als gesund und soll den Geist beruhigen, ist bekömmlich, belebt und spendet Energie, Freude und Kraft. Dazu zählen milde, frische und geschmacksreiche Speisen, Speisen voller Saft. - Rajas – die Qualität der Aktivität, Bewegung, Leidenschaft, Rastlosigkeit, Energie.
Rajas steht für Energie und Tatendrang, aber auch Unruhe. Herrscht Rajas vor, bringen die Gunas Erscheinungen hervor, die von Dynamik, Antrieb, Verlangen, Rastlosigkeit, Machtstreben oder Kreativität geprägt sind. Rajas entspricht dem Impuls nach Veränderung, symbolisch manchmal der Farbe Rot. Im Menschen zeigt es sich als Triebkraft, Ehrgeiz, aber auch als Unbeständigkeit oder Aggression.
Steht u. a. auch für eine Zentrifugalkraft, etwas, das nach außen drängt. Rajaische Nahrung soll den Geist unruhig machen, Nervosität und Rastlosigkeit hervorrufen und die Gesundheit verschlechtern. Beispiele für rajasische Nahrung sind Kaffee, Zucker, Süßigkeiten, sehr scharfe, saure oder bittere Speisen. - Tamas – die Schwere, Trägheit, Dunkelheit, Chaos.
Tamas ist die verdichtende, stabilisierende, aber auch verdunkelnde Qualität. Wenn Tamas dominiert, erscheinen Schwere, Trägheit, Unwissenheit, Stagnation, Beharrung. Man verbindet Tamas mit Dunkelheit oder der Farbe Schwarz. In uns erleben wir Tamas als Müdigkeit, Widerstand gegen Veränderung, Abneigung, manchmal depressive Dumpfheit oder schlicht als die nötige Stabilität und Erholung (Schlaf ist z.B. tamasisch geprägt).
Steht u. a. auch für eine Zentripetalkraft, etwas, das nach innen zieht. Tamasische Nahrung wie Fleisch oder Verkochtes soll den Geist träge machen. Auch Speisen, die schal und geschmacklos, verdorben und unrein sind, werden von Menschen mit einer Disposition zu Tamas laut der Bhagavad Gita (17. 7-11) bevorzugt.
Jede erfahrbare Sache enthält alle drei Gunas, jedoch in unterschiedlicher Mischung.
Kein Guna kommt je isoliert vor; sie durchdringen und beeinflussen einander fortwährend. Die alten Texte beschreiben die Gunas bildhaft als miteinander verflochten, aneinander haftend und aufeinander einwirkend – sie dienen einander, nähren einander, limitieren einander. Gerade dieses dynamische Wechselspiel erzeugt die Vielfalt der Welt.
Man kann sich die drei Gunas wie die drei Grundfarben vorstellen, aus denen durch Mischung unendlich viele Farbtöne entstehen. Tatsächlich nutzt ein bekannter Yoga-Kommentator genau dieses Gleichnis: So wie in einem Fotoalbum jedes Bild – ob es einen Himmel, einen Baum oder ein Gesicht zeigt – letztlich nur aus drei Grundfarbpigmenten zusammengesetzt ist, so sind alle unsere geistigen Eindrücke aus den drei Gunas „gemalt“. Die scheinbar unterschiedlichen Bilder entstehen nur dadurch, dass die drei Basis-Energien in unterschiedlichen Formen und Anteilen angeordnet sind.
Doch nicht alle erfreuen sich an der Philosophie der Gunas, sehen sogar ein Problem darin. So lesen wir auf Rainbowbody: „Es ist ausreichend zu wissen, dass die drei Gunas (Sattva, Rajas und Tamas) einfach repräsentativ für die drei (triadischen) primären konstituierenden Kräfte in der Natur sind, die vom klassischen Samkhya verwendet werden, ähnlich wie das Yin und Yang im dualistischen chinesischen System. All diese von Menschen geschaffenen Klassifizierungs- und Kategorisierungssysteme sind willkürliche, begrenzte und ungefähre Substitute für die „wirkliche Sache“.”
Immer ein Mix
Es gibt kein Ding in der Welt und wohl auch keinen Menschen, wo nur Sattva zu finden ist. Alles ist immer eine Mischung aus den Gunas. Dabei kann eine der drei Gunas (Kräfte, Eigenschaften) in einem Menschen besonders vorherrschend sein, jedoch sind die beiden anderen immer vorhanden.
Zudem, so meint Aurobindo, könne das Ego diese drei Gunas in einem Menschen nicht beeinflussen, da das Ego selbst Teil der Prakriti und damit der Gunas sei. Er warnt auch davor, beispielsweise mit allzuviel Askese das Begehren und die Leidenschaft von erhöhtem Rajas zu unterdrücken, weil das in Trägheit umschlagen könne, da die dynamischen Kräfte im Menschen verloren gehen könnten.
Doch was tun?
Die Gunas im Alltag erfahren und dadurch yogisch leben
Diese Sichtweise hat Konsequenzen für den Übungsweg: Wenn du begreifst, dass alle Erfahrungen – von der gröbsten Materie bis zum feinsten Gedanken – letztlich Produkte der Gunas sind, kannst du dich eher davon distanziert beobachten. Die Dinge verlieren ihren absoluten Ernstcharakter. Neues, Altes, Zukünftiges – alles unterliegt dem Wandel der drei Kräfte. Heute formt sich etwas und morgen zerfällt es wieder, doch die Bausteine bleiben die gleichen.
Dieses Verständnis fördert im Yoga Vairagya, die nicht-anhaftende Haltung: Du erkennst, dass alle wahrnehmbaren Formen austauschbare Kombinationen der Grundqualitäten sind. Was gestern ein stabiler Körper war, kann morgen zur feinstofflichen Erinnerung werden – die Gunas fließen unaufhörlich zwischen manifest und subtil hin und her.
Damit hast du ein Instrument an der Hand, deine eigene Verfassung und die Qualität deiner Umgebung wahrzunehmen und bewusst zu beeinflussen.
Im Alltag fühlt sich das etwa so an: Stell dir vor, du wachst morgens auf und fühlst dich bleischwer, antriebslos – das ist Tamas in Aktion, die träge Energie dominiert gerade dein System. Oder du hetzt von Termin zu Termin, der Kopf rotiert, du bist gereizt und ungeduldig – eindeutig ein Überschuss an Rajas, der ungestümen Aktivitäts-Energie. In anderen Momenten dagegen erlebst du vielleicht beim Meditieren oder in der Natur eine tiefe Klarheit, Frieden und Wachheit – das ist Sattva, die lichte Qualität, die da durchscheint. Mit etwas Übung kannst du im Alltag immer öfter diese Guna-Wetterlage in dir erkennen: Bin ich gerade sattvig, rajasig oder tamasig gestimmt? Diese Achtsamkeit ist ungemein wertvoll, denn sie ermöglicht dir, gezielt gegenzusteuern oder förderliche Zustände auszubauen.
Yoga liefert praktisches Handwerkszeug dazu. Fühlst du dich z. B. von Tamas übermannt (träge, dumpf, melancholisch), kannst du bewusst Rajas und Sattva wecken – etwa durch Bewegung, eine aktivierende Atemübung oder anregende Umgebung. Bist du hingegen im Rajas-Overdrive (nervös, zerstreut, „überkoffeiniert“), wirst du Strategien wählen, um Sattva zu stärken und Rajas herunterzufahren: beruhigende Pranayama-Techniken, Meditation, in der Natur spazieren, vielleicht eine einfache Mahlzeit. So wie ein Musiker die drei Grundtöne immer neu kombiniert, kann der Yogi lernen, die Klaviatur der Gunas zu spielen – mal braucht es mehr von diesem, mal von jenem, um in die Balance zu finden.
Wichtig dabei: Balance heißt nicht, dass stets alle drei Gunas gleich stark sein sollen. In der materiellen Welt ist völlige Gleichgewichtigkeit – das perfekte Gleichmaß – nicht der Normalzustand (das wäre vielmehr der beschriebenen Auflösung gleichzusetzen, in der nichts mehr geschieht). Leben ist Bewegung, und Bewegung entsteht durch Ungleichgewichte. Yoga strebt also keinen starren Dauergleichgewichtszustand an, sondern vielmehr die Fähigkeit, dynamisch ins Gleichgewicht zurückzufinden. Sattva hat dabei eine Sonderstellung: Es wird als „reine“ Qualität gesehen, die am nächsten an das Licht des Bewusstseins reicht. Mehr Sattva bedeutet mehr Klarheit und damit (wie oben erläutert) die Chance, überhaupt erst aus dem Gunaspiel auszusteigen. In einem sattvischen Geist spiegelt sich Purusha am ehesten unverzerrt wider. Deshalb betonen Yogis seit jeher: Kultiviere Sattva – pflege das Sattva in dir. Es ist der goldene Schlüssel, um die anderen beiden Kräfte in Schach zu halten. Traditionell erreicht man das durch eine Lebensweise, die Reinheit, Frieden und Achtsamkeit fördert (Stichwort sattvige Ernährung, sattvige Gesellschaft, sattviger Geist).
Schließlich führt all das zu Patanjalis eigentlichem Ziel: Unterscheidungsvermögen und Freiheit. Wenn du gelernt hast, die Gunas als das zu sehen, was sie sind – nämlich Naturprozesse, die kommen und gehen –, dann wirst du dich immer weniger davon mitreißen lassen. Du erkennst: Der Zorn, der gerade in mir aufwallt, ist eine Welle von Rajas und Tamas; die tiefe Freude, die ich empfinde, ist eine Sattva-Schwingung. Dieses Erkennen schafft automatisch innere Distanz. Du nimmst die Rolle des Beobachters ein, des Purusha, der von den Qualitäten unberührt bleibt. Patanjali würde sagen: Viveka-khyāti, die “durchdringende Erkenntnis der Unterscheidung” zwischen dem Selbst und den Gunas, dämmert auf. Genau diese Erfahrung – das Selbst als unberührter Zeuge des Guna-Spiels zu erfahren – ist der Beginn der wahren Freiheit, die im Yoga angestrebt wird.
In der Bhagavad Gita (Kapitel 14) beschreibt Krishna ausführlich, wie die Guṇas den Menschen binden – und wie Befreiung darin besteht, „über die Guṇas hinauszugehen“ (gunātīta). Ein Zitat aus der Gita lautet:
"Wer nicht nach Lohn fragt und die Riten nach Vorschrift ausführt, hat eine von Sattva erfüllte Haltung. Wer Askese und Opfergabe hingebungsvoll und mit erleuchtetem Geist ausübt, ohne den Blick auf die Belohnung, von Herzen gibt, um seiner selbst willen."
Ebenfalls aus der Gita:
"Wer, wo ein ‚Guna‘ ihm erscheint,
Er darum diesen doch nicht hasst,
Nach andern, ‚Gunas‘ nicht begehrt,
im Geiste ruhig und gefasst;Wer gleichsam unbeteiligt bleibt,
Bei eines ‚Guna‘ Gegenwart,
Wer denkt, ‚ein Guna treibt sein Spiel‘,
Und deshalb stets den Gleichmut wahrt;Wer standhaft ist in Freud und Leid,
Wem gleich ist Scholle, Stein und Gold,
Wer gleich sich bleibt, wenn man ihn schmäht
Und wenn man ihm Bewund’rung zollt;Wem gleich ist Ehre oder Schmach,
Ob Freund, ob Gegner unterliegt,
Wer jeder Tat entsagt, der hat
Der ‚Eigenschaften‘ Macht besiegt.“
Erinnere dich an eine Situation, in der du deutlich Sattva, Rajas oder Tamas gespürt hast.
Wie würdest du dieses Erlebnis in einem Satz beschreiben?

Klassische Kommentare: Auslegungen der alten Meister
Die klassischen indischen Kommentatoren der Yogasutra – allen voran Vyāsa mit seinem Yoga-Bhāṣya (ca. 5. Jh.) – haben Sutra 4.13 ausführlich erläutert. Ihre Kernbotschaft bestätigt Patanjalis Aussage und bettet sie in das Weltbild der Samkhya-Philosophie ein.
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
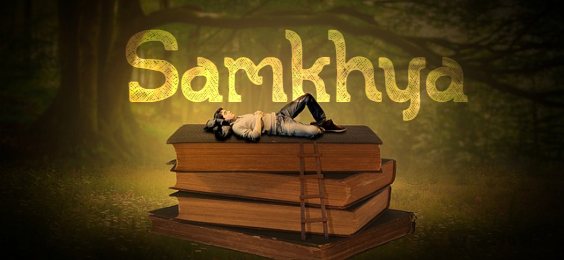
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
Das Samkhya ist eines der ältesten philosophischen Systeme indischer Herkunft. „Samkyha“ bedeutet wörtlich „Zahl“, „Aufzählung“ oder „das, was etwas in allen Einzelheiten beschreibt“. Hiermit ist die Aufzählung und Analyse jener Elemente gemeint, die gemäß Samkyha die Wirklichkeit bestimmen.
Allein das Wissen um diese Elemente soll bereits zur Erlösung vom Kreislauf der Wiedergeburten führen. Damit einher geht die Beendigung von drei Arten des Leidens (duhkha):
- adhyatmika (Leiden unter physischen oder psychischen Krankheiten),
- adhibhautika (von Außen zugefügtes Leid durch menschliche Gewalt oder Umwelteinflüsse),
- adhidaivika (Leid durch Naturgewalt, Umweltkatastrophen oder übernatürliche Phänomene).
Purusha, Prakriti, Guna
Das Universum und die Abläufe darin beruhen gemäß Samkyha auf zwei fundamentalen Prinzipien:
- Purusha: passiver aber bewusster Geist, auch Urseele, Weltgeist oder kosmisches Selbst genannt. Steht im Dualismus für Subjekt und das Wahre Selbst.
- Prakriti: aktive aber unbewusste „Urmaterie“, das Wahrnehmbare, das Benennbare oder „Natur“. Steht im Dualismus für Objekt und das Universum
Swami Satchidananda schreibt:
„Das Purusha ist das Wahre Selbst, das Purusha sieht. Prakriti ist alles andere.“
Es herrscht Uneinigkeit: Die Samkhya Philosophie sagt, dass es ein real existierendes Universum gibt. Die Vedanta-Lehre sieht alles als Maya, als Illusion an.
Prakriti und die Gunas
Der Urnatur Prakriti werden im Samkhya drei Gunas (Merkmale, Eigenschaften, von Hauer „Weltstoffenergien“ genannt) zugerechnet:
- Sattva (das Seiende, Reinheit, Klarheit). Gemäß Ayurveda-Lehre steht Sattva für Reinheit, Ausgeglichenheit, Balance und Neutralität. Charakterlich zeigt sich eine Sattva-Vorherschaft in Freigebigkeit, Gelassenheit, Zufriedenheit, Weisheit, Ausgeglichenheit und Toleranz. Menschen, die sich vorwiegend sattvisch ernähren sollen länger leben und gesünder alt werden. Als sattvische Nahrungsmittel gelten frische & reife Früchte, Honig, Milch, Reis, Weizen, Safran und Zimt.
- Rajas (Bewegung, Energie, Leidenschaft). Verantwortet Wandlung, Veränderung und Dynamik. Aber auch Zorn, Rastlosigkeit und Hektik.
- Tamas (Trägheit, Dumpfheit, Dunkelheit, Schwere). Eine Kraft, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit trübt und unsere Wirkkraft schwächt. Aber auch das Prinzip der Ruhe.
Sattva für den Yogi
Feuerstein (Buch bei Quellen ergänzen) schreibt: „Während aktive (rajas) und träge (tamas) Qualität dazu neigen, die Ich-Illusion aufrechtzuerhalten, erschafft die Qualität der Helligkeit (sattva), insoweit sie dominiert, die Vorbedingungen für das Befreiungsgeschehen. Daher erstrebt der yogin sattvische Konditionen und Zustände.“
Aber auch das Körper-Geist-System existiert auf Basis der drei Gunas. Als Yogi wisse man, dass alle drei Prinzipien miteinander wechselseitig verbunden sind. Jede Anhaftung an einen Zustand (Sattva ...) führt (ebenfalls) zu Leid.
Purusha
Purusha ist das Selbst, das allen fühlenden Wesen innewohnt. Durch Purusha erhalten Menschen, Tieren, Pflanzen und Götter ihre Empfindungsfähigkeit und Bewusstsein.
Des Menschen wahre und ursprüngliche Identität ist einzig und allein Purusha, die sich zum Zwecke des Erfahrens in Prakriti manifestiert hat, siehe Sutra II-18.
Nun verstrickt sich dieses Purusha in Prakriti, hält die zur Sphäre der Prakriti gehörigen Elemente und Bereiche irrtümlicherweise für Bestandteile seiner selbst. Daraus entsteht Leid.
Grundelement der Lehre des Samkhya für den nach Erlösung Strebenden ist deshalb, die beiden Substanzen Purusha und Prakriti und ihre Merkmale streng voneinander unterscheiden zu lernen.
Vedanta
Im nondualen Vedanta ist Prakriti nur eine Täuschung, Maya.
Physik und Quantentheorie
Betrachten wir den Bildschirm vor uns, so sehen wir gemäß der Physik ein Konstrukt aus Neutronen, Elektronen und Protonen, die alle auf einer eigenen Frequenz schwingen und um sich kreisen. Nahezu 100 Prozent des Bildschirmes besteht aus Vakuum! Nur unsere Sinne – die Sinne des Wahrnehmenden – machen daraus einen Monitor.
Die Quantenphysik macht alles noch verschwommener: Ob sich ein subatomares Partikel als Teilchen oder als Welle verhält, hängt vom Beobachter ab. Anders ausgedrückt: vom beobachtenden Bewusstsein. Vom Wahrnehmenden und dessen Wahrnehmung. Eigenschaften der Partikel wie dessen Lokalität können nicht vom Betrachter getrennt werden. Dies geht mehr in Vedanta (und Buddhismus)-Richtung als die Samkhya-Behauptung eines unabhängig von Purusha existierenden Universums Prakriti.
Vyāsa betont ebenfalls, dass alles Wandelbare den Gunas unterliegt. Er erklärt, die „Eigenschaften“ (dharmāḥ), von denen hier die Rede ist, seien die bestimmten Formen bzw. Zustände aller Dinge in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In jeder Zeit seien die Grundzüge einer Sache vorhanden – im Jetzt treten sie sichtbar hervor, während sie in Vergangenheit oder Zukunft lediglich verborgen existieren.
Warum aber können wir dann Vergangenes oder Zukünftiges nicht sehen? Weil diese Formen dort subtil bleiben: als latente Samen sozusagen, nicht als aufgeblühte Pflanze. Dennoch sind sie real vorhanden, in ihrem eigenen feinstofflichen „So-Sein“. Und diese verborgenen Formen unterscheiden sich nur durch verschiedene Zustände der Gunas (abhängig von den „Pfaden“, die sie durchlaufen haben) – so hatte es Patanjali schon im Sutra 4.12 angedeutet.
Mit Sutra 4.13 liefert Vyāsa nun die ontologische Begründung: Alles im Universum ist durchdrungen von den Gunas, selbst die unsichtbaren Eindrücke in der Tiefe unseres Geistes. Nur das Purusha, das reine Bewusstsein, bleibt als beobachtender Pol unberührt von diesen Naturkräften. Dieses Purusha-Guna-Verhältnis ist fundamental: Prakriti, die Natur mit all ihren Erscheinungen, besteht zu 100 % aus Gunas – Purusha zu 0 %. Yoga heißt, diese beiden auseinanderzuhalten (viveka) und sich vom Identifizieren mit den Gunas zu lösen.
Spätere Kommentatoren wie Vācaspati Miśra (Tattva-Vaiśāradī, 9. Jh.) und Vijñāna Bhikṣu (Yoga-Vārttika, 16. Jh.) folgten Vyāsas Interpretation. Sie unterstreichen, dass manifest vs. subtil kein Dualismus zweier verschiedener Arten von Substanz ist, sondern zwei Zustandsformen derselben Prakriti-Matrix. Vācaspati erläutert z. B., „manifest“ bedeute sinnlich wahrnehmbar (sthūla), während „subtil“ dasjenige sei, was nur in Ursache/Keimform existiere und (noch) nicht sinnlich erfahrbar ist – etwa vergangene und zukünftige Formen, oder feinstoffliche Entitäten wie die Tanmātras (feine Sinnesobjekte). Aber ob grob oder fein, die Zusammensetzung bleibt identisch: drei Gunas im Spiel.
Ein klassisches Gleichnis findet sich auch in der Samkhya-Kārika: Dort werden die Gunas mit einer Lampe verglichen, die drei Eigenschaften hat – Leuchtkraft (Sattva) entspricht dem Lichtschein, Bewegung (Rajas) dem flackernden Docht, Trägheit (Tamas) dem festen Öl und Dochtmaterial. Nur zusammen ergeben sie eine brennende Flamme. Entfernt man eine Komponente, erlischt das Licht. Ebenso kooperieren und konkurrieren die drei Gunas ständig, um die „Flamme“ des Universums zu unterhalten.
Dieser Gedanke spiegelt sich in Patanjalis Sutra: Ohne Gunas gäbe es keine wahrnehmbare Welt – und im vollkommenen Gleichgewicht der Gunas ruht die Schöpfung (Prakriti im Urzustand). Yoga strebt letztlich genau diesen Zustand völliger Ausgewogenheit an, in dem die Gunas zur Ruhe kommen und das Purusha frei ist. Das nennt sich in der Terminologie des Yoga Kaivalya (Alleinsein des Bewusstseins) – analog zum Samkhya-Konzept der Auflösung aller Dinge zurück in den Urgrund, wenn die Gunas im Gleichgewicht sind.
Vyāsa beschreibt zudem die praktische Implikation: Unsere Saṃskāras (Prägungen) und Vāsanās (Neigungen) sind nichts als Gunas-Konfigurationen, die durch vergangenes Handeln „geprägt“ wurden. Sie ziehen als unsichtbare Rillen (subtile Pfade im Chitta) die Energie der Gunas hindurch und formen so unsere Persönlichkeit und Erfahrungen.
Mit anderen Worten: Die Dynamik der Gunas fließt buchstäblich durch die von uns (mit-)geschaffenen Bahnen in unserem Geist und Körper. Deshalb fühlt sich z. B. eine alte Gewohnheit so „automatisch“ an – es sind die Gunas, die immer wieder dieselbe Spur nehmen. Für den Yogi ergibt sich daraus eine Chance: Ändere die Prägungen, und du veränderst das Fließen der Gunas. Genau das ist der Kern vieler Yoga-Praktiken, von Ethik und Ernährung bis Meditation.

Moderne Auslegungen und Erkenntnisse
Moderne Kommentatoren und Wissenschaftler betrachten Patanjalis Sutra 4.13 mit großem Interesse, denn es schlägt eine Brücke zwischen uralter Weisheit und heutigen Erkenntnissen. Gelehrte wie Mircea Eliade und Georg Feuerstein heben hervor, dass Patanjali hier das Samkhya-Weltbild voll und ganz übernimmt.
Die Vorstellung, dass alle Phänomene aus drei Grundkräften bestehen, hat durchaus Parallelen in der modernen Wissenschaft: Physiker suchen nach fundamentalsten Bausteinen der Materie – und fanden z. B. heraus, dass ein paar elementare Teilchen oder Kräfte reichen, um die Vielfalt des Universums aufzubauen. Patanjalis Drei-Kräfte-Modell ist eine proto-wissenschaftliche Behauptung: Vielfalt aus Einfachheit.
Einige Yoga-Autoren wagen kühne Überlegungen – so vergleichen sie z. B. die Gunas mit den Bausteinen eines Atoms:
- Rajas entspräche dem positiv geladenen Proton (aktive Energie),
- Tamas dem schweren Elektron (träges Potential),
- Sattva dem neutralen Neutron (ausgleichende Mitte).
Natürlich hinkt der Vergleich wissenschaftlich, doch er veranschaulicht: die Idee eines zugrundeliegenden Dreier-Prinzips fasziniert auch heute.
In der Psychologie wiederum erinnert die Lehre der drei Gunas an Modelle grundlegender Temperamente oder Stimmungen.
- So ließe sich Sattva vergleichen mit einem klaren, gelassenen Bewusstseinszustand,
- Rajas mit einem erregten, reizbaren Zustand voller Antrieb, und
- Tamas mit einer apathisch-depressiven oder erschöpften Verfassung.
Interessanterweise beschreibt sogar die moderne Neurophysiologie in der Polyvagal-Theorie drei Hauptzustände des Nervensystems (soziale Verbundenheit/Ruhe, Kampf-Flucht-Aktivierung, Totstell- bzw. Erstarrungsmodus), die den sattvischen, rajasischen und tamasischen Zuständen bemerkenswert ähneln. Es wirkt beinahe so, als hätten die Yogis intuitiv eine ur-menschliche Dreiteilung von Verhaltensmustern und Bewusstseinslagen erkannt. Kein Wunder, dass zeitgenössische Yogatherapeuten die Gunas gern heranziehen, um mentale und körperliche Befindlichkeiten zu erklären.
Jeremy, Autor der Rudra Meditation, schreibt: “Die unablässige Schwankung der Gunas beeinflusst unsere Gedanken, Gefühle, Stimmungen und Bewusstseinszustände. Diese urtümlichen Kräfte betreffen jeden Aspekt unseres Wesens, vom grobstofflichen Körper bis zur feinsten Glückseligkeitsschicht.”. Wenn wir also heute von Bio-Chemie der Gefühle sprechen oder davon, dass Hormone unsere Stimmung färben, können wir das durchaus im Geiste Patanjalis formulieren: Die Gunas sind am Werk.
Mit Satttva zur Erleuchtung?
Aktuelle Yoga-Kommentare betonen auch die praktische Seite der Guna-Lehre. Swami Sivananda und Sri Aurobindo (beide moderne Yoga-Meister) schrieben, das Ziel des Yoga sei, sich von der Tyrannei der Gunas zu befreien – ein Zustand, den die Bhagavad Gita “gunātīta” nennt, das Überwinden der drei Gunas. Georg Feuerstein erläutert in seinem Kommentar, dass der Weg des Yoga im Grunde darin besteht, den Anteil von Sattva immer weiter zu erhöhen, denn Sattva bringt Klarheit und Ruhe, was Voraussetzung für die Befreiung ist.
Yoga als “Sattva-Katalysator” sozusagen: Durch ethisches Verhalten, Meditation, richtige Ernährung etc. kultivieren wir mehr Sattva im Geist. Patanjali selbst erwähnt an späterer Stelle (Yoga-Sutra 4.34) sinngemäß: Wenn die Gunas ihren Zweck erfüllt haben – nämlich Purusha zur Erkenntnis seiner selbst zu führen – ziehen sie sich zurück. Moderne Kommentatoren sehen darin die endgültige Loslösung des Bewusstseins von den Naturkräften. Mircea Eliade interpretiert das so, dass in der höchsten Meditation der Yogi alle Vorgänge der Prakriti (also der Gunas) als fremd erkennt und sich vollkommen damit dis-identifiziert. Was übrig bleibt, ist das “Bewusstsein an sich”, reines Sein ohne Eigenschaften. Damit hat der Yogi das Spielfeld der drei Gunas verlassen.
Neben philosophischen Parallelen sucht man auch wissenschaftliche Bestätigungen dieser alten Lehre. Natürlich sind Patanjalis Gunas kein naturwissenschaftliches Modell – aber die Idee, dass verschiedene Erscheinungen auf gleiche Grundbausteine zurückführbar sind, zieht sich wie schon gezeigt durch viele moderne Theorien. Einige Neurowissenschaftler weisen darauf hin, dass selbst komplexe Gehirnzustände (Emotionen, Kognitionen) auf eine Art Trio von Grundstimmungen zurückzuführen sind – eine Hypoaktivierung (ähnlich Tamas), eine Hyperaktivierung (ähnlich Rajas) und ein optimal integrierter Zustand (ähnlich Sattva).
Studien zu den 3 Gunas und modernen psychologischen Klassifizierungen
1) Big Five & Wohlbefinden (offen zugänglich)
Khanna, Singh, Singla & Verma (2013) untersuchten in zwei Stichproben (N=80 Berufstätige; N=110 Studierende) den Zusammenhang der drei Guṇas (gemessen mit dem Vedic Personality Inventory) mit Big Five, psychologischem Kapital, Lebenszufriedenheit, subjektivem Glück und mentaler Gesundheit. Zentrale Resultate:
- Sattva korrelierte positiv mit Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und negativ mit Neurotizismus.
Rajas und Tamas zeigten das Gegenmuster: negativ mit Agreeableness/Conscientiousness/Openness und positiv mit Neurotizismus; Extraversion war bei beiden nicht signifikant. Zudem hing Sattva konsistent positiv mit emotionalem, sozialem und psychologischem Wohlbefinden zusammen, Rajas/Tamas negativ. Ältere Teilnehmende wiesen mehr Sattva und mehr Wohlbefinden auf; Männer erzielten höhere Rajas-Werte. Zur Studie bei Lippincott
2) Emotionale Stile (Aufmerksamkeit, Resilienz, Ausblick etc.)
Ravindra & Babu (2021) befragten N=121 junge Erwachsene mit dem VPI sowie dem Emotional Style Questionnaire (Davidson/Begley: Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung, Ausblick, Resilienz, soziale Intuition, Kontextsensitivität). Ergebnisse:
- Sattva: positiv mit Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung, positivem Ausblick, sozialer Intuition und Kontextsensitivität; negativ mit der Skala Resilienz, weil höhere Resilienz in diesem Instrument niedrigere Punktwerte bedeutet (inverse Kodierung) – faktisch also bessere Resilienz bei höherem Sattva.
- Rajas/Tamas: überwiegend negative Zusammenhänge mit den emotionalen Stilen; wo Unterschiede auftraten, waren die negativen Korrelationen bei Tamas stärker als bei Rajas. Zur Studie bei PMC
Kurzfazit: Über unterschiedliche Messansätze hinweg stützt die Evidenz die klassische Deutung: Sattva geht mit günstigen Persönlichkeits- und Emotionsprofilen einher, Rajas/Tamas eher mit ungünstigen (z. B. höherer Neurotizismus, schwächere Aufmerksamkeits-/Regulationsmuster). Diese Befunde lassen sich praxisnah in den Yoga-Alltag übersetzen: Sattva kultivieren (Routinen, Ernährung, Praxis) und Rajas/Tamas regulieren.
Hinweis: Diese Zusammenfassung der Studienergebnisse wurden von einer KI erstellt.
Auch in der Ernährungs- und Gesundheitslehre des Yoga (Ayurveda) spielen die Gunas eine Rolle: Nahrung wird in sattvisch, rajasisch, tamasisch eingeteilt, je nachdem, welche Qualität sie im Geist fördert. Moderne Ernährungswissenschaft mag andere Begriffe nutzen, aber die Wirkung ist vergleichbar beschrieben – etwa dass frische, leichte Kost zu Klarheit und Wohlbefinden beiträgt (Sattva-Effekt), während zucker- oder toxinreiche Nahrung träge oder reizbar macht (Tamas- oder Rajas-Effekt). So gesehen liefern auch heutige wissenschaftliche Erkenntnisse Rückendeckung für Patanjalis uralte Aussage: Unsere erlebte Wirklichkeit hat Qualitäten, und diese Qualitäten sind letztlich variierende Mischungen einiger weniger grundlegender Faktoren.
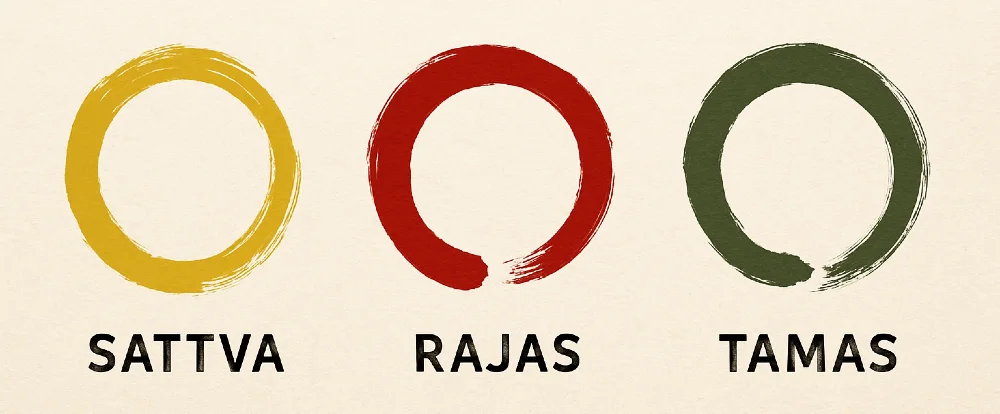
Ein schönes Bild bietet der Lehrer Swami Jnaneshvara: Er vergleicht die Gunas mit den Grundfarben des Lebens. Wir können zwar Millionen Farben wahrnehmen, doch alle entspringen aus Rot, Gelb, Blau. Genauso erleben wir unzählige Dinge – vom Ärger im Stau über die Freude in der Meditation bis zum Anblick eines Sonnenuntergangs – aber all das sind nur unterschiedliche „Farbtöne“, gemischt aus drei Grundenergien: Sattva, Rajas, Tamas.
Noch 2 "moderne" Stimmen zu Yogasūtra 4.13
Der Indologe Georg Feuerstein hebt in seiner Übersetzung und Kommentierung (The Yoga-Sūtra of Patañjali, 1996) hervor, dass Patanjali mit diesem Sutra das samkhya-philosophische Weltbild in seiner ganzen Konsequenz übernimmt: Alles, ob manifest oder subtil, ist durch und durch von den drei Guṇas geprägt. Feuerstein betont, dass diese Sichtweise keine bloße Metaphysik ist, sondern eine Übung in Unterscheidungskraft (viveka): Wer erkennt, dass selbst die feinsten Gedanken und Erinnerungen nichts anderes sind als Spielarten der Guṇas, gewinnt Abstand – und damit die Möglichkeit, das unveränderliche Bewusstsein (Purusha) klarer zu erkennen. Für ihn ist diese Passage ein Schlüssel, um den praktischen Kern des Yoga zu verstehen: Nicht alles, was erscheint, ist wirklich „ich“ – es ist schlicht eine Formation der Guṇas.
Der Religionswissenschaftler Mircea Eliade (in Yoga: Unsterblichkeit und Freiheit, 1954) legt die Betonung stärker auf die kosmologische und existenzielle Dimension. Für Eliade zeigt dieses Sutra exemplarisch, wie der Yoga die Vielfalt des Universums auf einen einfachen Grundsatz zurückführt: alles ist Variation von drei Kräften. Er sieht darin eine archaische, aber erstaunlich kohärente Kosmologie, die nicht nur erklärt, warum die Welt wandelbar und vergänglich ist, sondern auch, warum Befreiung möglich wird. Denn wenn alles, was uns bindet – Körper, Geist, Zeit, Erinnerung – nur Guṇas sind, dann eröffnet sich die Möglichkeit, über dieses Spiel hinauszugehen. Eliade liest diesen Vers also nicht nur als philosophische Behauptung, sondern als Verheißung: Wer die Welt als Guṇa-Kombination durchschaut, hat den ersten Schritt zur „Unsterblichkeit“ getan – also zur Erfahrung des zeitlosen Bewusstseins.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-13
In der Meditation: Die Gunas im eigenen Kopf beobachten
Setz dich hin, wie immer. Atme. Und dann spiel Forscher: Beobachte deine Gedanken und Gefühle nicht als deine, sondern als Bewegungen der drei Gunas.
- Plötzlich taucht Unruhe auf, die To-do-Liste springt wie ein aufgescheuchtes Huhn durch dein Hirn: Rajas klopft an.
- Dann merkst du vielleicht, wie dich eine schwere Müdigkeit nach unten zieht, der Atem wird träge: Hallo Tamas.
- Und manchmal blitzt für ein paar Sekunden diese helle, klare Ruhe auf, so ein stiller innerer Sonnenstrahl: Sattva zeigt sein Gesicht.
Der Trick: Versuch nicht, das alles wegzudrücken. Erlaube dir, es als Farben im inneren Kaleidoskop zu sehen. Dann stell dir die Frage: Wer schaut da eigentlich zu? – Der Weg des Yoga: Du erkennst, dass du nicht der Wechsel der Gunas bist, sondern der stille Zeuge.
Eine einfache Technik: Mach dir während der Meditation kleine „Notizen im Kopf“. Wenn du bemerkst: „Ah, da ist Rajas“, sag es dir still. Oder: „Sattva da, aber nur kurz.“ Dieses stille Benennen entkoppelt dich und schärft dein Erkennen. Es ist, als würdest du die Schauspieler auf der Bühne beim Namen nennen, statt dich in die Handlung hineinziehen zu lassen.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Im Alltag: Mit den Gunas spielen lernen
Die eigentliche Übung beginnt nicht im Lotussitz, sondern im Supermarkt, im Büro oder wenn du nachts hellwach im Bett liegst. Yogasutra 4.13 kannst du überall üben, wenn du dir die Frage stellst: Welches Guna hat hier gerade die Oberhand?
- Beispiel 1: Die Kaffeeschlange. Du stehst morgens im Café, vor dir zehn Leute, dein Zug fährt gleich. Nervosität, Ärger, Ungeduld – alles sprüht. Klassischer Rajas-Zustand. Statt dich blind hineinzusteigern, erkenne: „Ah, Rajas.“ Dann atme bewusst, vielleicht lächle über dich selbst. Das macht die Situation nicht kürzer, aber leichter.
- Beispiel 2: Netflix-Endlosschleife. Du bist auf der Couch, die nächste Serie startet automatisch, du bist sattgegessen und bewegst dich seit einer Stunde keinen Zentimeter mehr. Das ist Tamas, in seiner vollen Pracht. Anstatt dich dafür fertig zu machen, sieh es als Diagnose: „Okay, Tamas. Vielleicht gehe ich jetzt zehn Minuten spazieren, um Rajas und Sattva wieder einzuladen.“
- Beispiel 3: Das Klarheitsfenster. Nach einer Yoga-Stunde oder einem Spaziergang im Wald kennst du vielleicht diesen Moment: Der Kopf ist still, der Atem ruhig, du bist hellwach, ohne Grund glücklich. Das ist Sattva. Erkenne es, koste es bewusst aus – und merke dir: So fühlt es sich an, wenn der Geist sattvig ist.
Wie könnten die Inder zu der Meinungen gekommen sein, dass es gerade diese drei Kräfte sind, denen die gesamte Natur zugrunde liegt?
Kleine Praxis-Experimente für den Alltag
- Check-In-Methode: Frag dich ein paar Mal am Tag: Bin ich gerade sattvig, rajasig oder tamasig? Schreib’s kurz ins Handy oder in ein Notizbuch. Nach einer Woche erkennst du Muster.
- Gegensteuern lernen: Wenn du merkst, Rajas dreht dich hoch, geh bewusst in eine ruhige Praxis: Atem verlängern, Musik leiser, Handy weg. Wenn Tamas dich verschluckt, beweg dich, iss etwas Frisches, trink Wasser.
- Sattva tanken: Suche Orte, Menschen, Tätigkeiten, die dir innere Klarheit geben. Ein stiller Morgen, ein gutes Buch, bewusstes Atmen. Mach dir klar: Sattva wächst nicht von allein, du musst es füttern.
Der eigentliche Clou
Was Patanjali meint, wirst du wirklich erfahren, wenn du irgendwann mitten in deinem Alltag innehältst – sei es im Stress, in der Trägheit oder in einem lichten Moment – und dir denkst: Ah, das sind nur die Gunas, die gerade tanzen. Dieses „Ah“ verändert alles. Plötzlich bist du nicht mehr komplett verstrickt, sondern Zuschauer des Spiels. Genau da blitzt vielleicht das auf, was die Yogis Purusha nennen: dein stilles, unveränderliches Selbst.

Vyāsa und Śaṅkara zu Yogasūtra 4.13
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – und das geheimnisvolle Spiel der guṇa-s
Vyāsa, der wichtigste Kommentator des Yogasūtra, erklärt in Bezug auf 4.13, dass die „Eigenschaften“ (dharmas), also die Erscheinungsweisen der Dinge, drei Formen von Sein haben: Sie können gegenwärtig, vergangen oder zukünftig sein.
- In der Gegenwart sind sie manifest – wir nehmen sie mit unseren Sinnen oder mit dem Geist wahr.
- In der Vergangenheit oder Zukunft sind sie subtil – unsichtbar, nicht greifbar, nur als Anlage oder Möglichkeit vorhanden.
Vyāsa spricht von „sechs unspezialisierten Erscheinungen“ (ein Verweis auf Yogasūtra II.19). Gemeint sind die grundlegenden Stufen der Entwicklung der Natur (Prakṛti), aus denen alle späteren Formen hervorgehen. Seine Botschaft ist klar: Alles Sichtbare wie Unsichtbare ist nichts anderes als eine bestimmte Anordnung der drei Guṇas. Und er fügt hinzu, dass das, was wir als „wirkliche Erscheinung“ wahrnehmen, eigentlich nur ein schwacher Abglanz der eigentlichen Guṇa-Wirklichkeit ist. Was wir sehen, ist – in seinen Worten – fast eine Täuschung, eine Art Spiegelung, nicht die ganze Wahrheit.
Śaṅkara (8.–9. Jahrhundert), einer der großen Philosophen Indiens, kommentierte Jahrhunderte später diesen Text und präzisierte ihn. Er erklärt:
- Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft haben alle ihre „Formen“.
- Nur das Gegenwärtige ist für uns öffentlich zugänglich, also Gegenstand gemeinsamer Wahrnehmung.
- Vergangenheit und Zukunft bleiben subtil, verborgen, weil sie der Sphäre der „ungegliederten Prinzipien“ angehören: das „Ich-bin-Bewusstsein“ (Asmitā) und die weiteren fünf Ur-Ebenen, die Patanjali im zweiten Kapitel erwähnt (II.19).
Yoga Sutra II-19: Die Stufen der Eigenschaftszustände von den Grundbausteinen der Natur (den Gunas) sind spezifisch, unspezifisch, subtil-differenziert und undefinierbar.
Aus diesen subtilen Ebenen entfalten sich dann die sechzehn vikāras – Veränderungen wie die Elemente, Sinne und Organe. In dieser Entfaltung erscheinen manche Dinge manifest (etwa Körper und Sinne), andere bleiben subtil (etwa das bloße „Ich-bin-Gefühl“). Aber egal ob grob oder fein: Alles ist ein Gewebe aus Sattva, Rajas und Tamas.
Śaṅkara betont besonders: Die wahre Form der Guṇas entzieht sich der Wahrnehmung. Was wir tatsächlich sehen, hören oder berühren, ist nur ein kleiner, begrenzter Ausschnitt – eine lokale Störung im endlosen Meer der Guṇas. Er vergleicht das mit Māyā: einer Erscheinung, die real wirkt, aber das Ganze nicht abbildet. Wir erleben nur die Oberflächenbewegungen, die Kollisionen und Vermischungen der Guṇas, während ihre tiefe, ursprüngliche Natur verborgen bleibt.
Was bedeutet das praktisch?
Klingt alles sehr philosophisch – ist es auch. Aber es lässt sich auf den Alltag herunterbrechen.
- Wenn du ärgerlich wirst, siehst du nur die sichtbare Manifestation von Rajas und Tamas. Die tieferen Schichten dieser Kräfte, die zu dieser Reaktion geführt haben, bleiben unsichtbar.
- Wenn du dich an etwas erinnerst, erlebst du gerade die subtile Form der Vergangenheit: Ein Eindruck, der nicht manifest ist, aber als Spur weiterlebt.
- Und wenn du in die Zukunft planst, projizierst du subtile Möglichkeiten in ein Bild, das noch nicht existiert.
Vyāsa und Śaṅkara wollen dir sagen: Alles, was du erlebst, ist nur das Spiel der Guṇas – sichtbar oder unsichtbar. Was du siehst, ist nicht die volle Wahrheit, sondern eine Art Ausschnitt, eine lokale Welle auf einem Ozean von Bewegungen.
Ein Bild zum Mitnehmen
Stell dir die Guṇas wie drei Grundfarben vor, die ständig im Hintergrund gemischt werden. Mal siehst du ein klares Bild (manifest), mal liegt die Farbe noch unsichtbar auf der Palette (subtil). Śaṅkara würde hinzufügen: Was du siehst, ist immer nur ein kleiner Pinselstrich. Das eigentliche Gemälde der Natur, die unendliche Bewegung der Guṇas, bleibt hinter dem Vorhang.

Siehe auch folgende Sutras zu den Gunas
Yoga Sutra I-16: Das Nichtbegehren nach den Elementen der Erscheinungswelt führt zur Wahrnehmung des wahren Selbstes, des Purushas – die höchste Form der Verhaftungslosigkeit
Yoga Sutra II-3: Unwissenheit, Identifikation mit dem Ego, Begierde, Abneigung und (Todes-)Furcht sind die fünf leidbringenden Zustände (Kleshas)
Yoga Sutra II-15: Für jemanden mit Unterscheidungsfähigkeit ist alles in dieser Welt leidvoll; das liegt an der Vergänglichkeit, unserem Verlangen, den unbewussten Prägungen (Samskaras) und an der Wechselhaftigkeit der Grundeigenschaften der Natur (Gunas)
Yoga Sutra II-18: Die wahrgenommenen Objekte sind aus den 3 Gunas mit den Eigenschaften Klarheit, Aktivität und Trägheit zusammengesetzt, bestehen aus Elementen und Wahrnehmungskräften – alles Wahrgenommene dient der sinnlichen Erfahrung und der Befreiung
Yoga Sutra II-19: Die Stufen der Eigenschaftszustände von den Grundbausteinen der Natur (den Gunas) sind spezifisch, unspezifisch, subtil-differenziert und undefinierbar.
Yoga Sutra IV-14: Die Verwirklichung und Essenz eines Objektes beruht auf dem einzigartigen Wandel der Gunas
Yoga Sutra IV-32: Dann (wenn Dharma-Megha-Samadhi erreicht wurde) enden für den Yogi die Veränderungen in der Natur durch die drei Gunas, weil diese ihren Zweck erfüllt haben
Yoga Sutra IV-33: Krama, das Kontinuum bzw. die Abfolge von Momenten und die damit verbundene Transformation, wird vom Yogi erkannt, wenn die Wandlungen der Gunas enden
Yoga Sutra IV-34: Das Ziel des Purushas, unseres wahren Selbstes, ist das Aufgehen der Gunas in die Prakriti, der Urnatur, und seine Rückkehr zu Kaivalya, der absoluten Freiheit. Purusha, ruht dann in seiner wahren Natur. Hier endet die Yogalehre – iti.

Zusammengefasst
Yoga-Sutra 4.13 mag kurz sein, doch es enthält eine mächtige Botschaft. Es definiert die Welt als Schwingungsteppich aus drei Fäden und lädt dich ein, dieses Teppichmuster in deinem eigenen Leben zu erkennen. Alte Meister haben diese Lehre mit zahlreichen Kommentaren lebendig werden lassen, moderne Lehrer und sogar Wissenschaftler finden faszinierende Parallelen dazu. Für dich als Yoga-Übenden kann die Sicht durch die „Guna-Brille“ zu einem Aha-Erlebnis werden: Plötzlich verstehst du, warum dein Geist mal klar und himmlisch, mal wild und teuflisch, mal stumpf und lethargisch erscheint – es sind die ewig tanzenden drei Gunas, die kosmischen “Strippenzieher” der Natur. Yoga lehrt dich, diesen Tanz bewusst zu beobachten und zu beeinflussen, bis du erkennst, dass du selbst der Zuschauer bist – der unveränderliche Geist jenseits des Tanzes.
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-13
Zeit und Existenz – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 12 bis 17
Länge: 12 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Unmanifestes und manifestiertes Dharma – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.13
Länge: 6 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Gott ist der Tätige: Asha Nayaswami (Class 65) zu Sutra 4.11 (Rest) bis 4.17
Länge: 70 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


