pariñâmaikatvâd vastu-tattvam
परिणामैकत्वाद्व्स्तुतत्त्वम्
Hochphilosophisch geht es weiter. Yogasutra 4.14 klingt wie ein feines Stück Philosophie – „alles ist im Wandel“ liest sich schnell, doch die Tiefe erschließt sich erst, wenn man sie spürt. Der Artikel nimmt dich mit in alte Kommentare, moderne Auslegungen und wissenschaftliche Parallelen. Er zeigt, wie diese knappe Formel von Patanjali nicht nur ein Gedankenspiel bleibt, sondern zur Haltung wird: in der Yogapraxis, in der Meditation, im Alltag – und manchmal auch im banalen Zähneputzen.
Kurz zusammengefasst
- Wandel: Alles befindet sich in ständiger Veränderung, kein Moment gleicht dem anderen. Diese Dynamik ist die Essenz von Yogasutra 4.14.
- Einzigartigkeit: Jedes Ding ist durch seinen individuellen Veränderungsprozess unverwechselbar. Selbst scheinbar gleiche Objekte unterscheiden sich im Detail.
- Klassische Kommentare: Vyasa und andere Gelehrte erklären, dass die drei Gunas durch unterschiedliche Modifikationen sowohl Sinnesorgane als auch ihre Objekte hervorbringen.
- Realität der Dinge: Die Welt ist wirklich und nicht bloße Illusion, auch wenn der Geist sie interpretiert. Vorstellungen ohne Objekte existieren nur in Träumen.
- Moderne Deutung: Lehrer wie Iyengar, Desikachar oder Feuerstein betonen die Praxisnähe – Veränderung zeigt sich im Atem, in der Yogapraxis, in jedem Alltagserlebnis.
- Wissenschaftliche Parallelen: Quantenphysik und Neurowissenschaften belegen: Atome sind ständig in Bewegung, das Gehirn formt sich durch Neuroplastizität unablässig neu.
- Praxis: Meditation auf Atem und Gedanken, Alltagsbeobachtungen beim Zähneputzen oder Gespräch führen zu einem unmittelbaren Erleben des Sutras.
- Gelassenheit: Wer Veränderung als Naturgesetz akzeptiert, entwickelt Nicht-Anhaftung und erkennt die Einzigartigkeit jedes Augenblicks.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Parinama, Parinâma, pariṇāma = Wandlung; Veränderung; Transformation; eine vorübergehende Erscheinung (der drei Gunas);
- Ekatvat, ekatvât = Einheit; Kontinuität; Ganzheit; aufgrund der Einheit; auch übersetzt als: einzigartig; infolge der Einzigartigkeit;
- Vastu = Objekt; Situation; Person; Fokus; Sache;
- Tattvam, tattva = die Essenz; Wirklichkeit; Besonderheit; die wahre Natur einer Sache; die Elemente; Wahrheit; Besonderheit; das So-Sein;

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras
- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung
Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis
Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte
Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung
Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.
Yogasutra 4.14 wird häufig sinngemäß übersetzt mit „Alle Dinge befinden sich im Wandel und sind in der Veränderung einzigartig.“ Dieser kurze Aphorismus von Patanjali enthält eine tiefgreifende Aussage über die Natur der Wirklichkeit. Es besagt, dass jedes Objekt oder Phänomen in der Welt real ist, weil es einen einzigartigen Wandel oder eine spezifische Veränderung durchläuft. Mit anderen Worten: Obwohl alles ständigem Wandel unterliegt, hat jedes Ding durch die Einzigartigkeit seines Veränderungsprozesses eine eigene Wesensrealität. Diese Sichtweise wirft ein Licht auf die dynamische Struktur der Natur und unser Verständnis von Wirklichkeit, das sowohl in der alten Yogaphilosophie als auch – überraschenderweise – in der modernen Wissenschaft Anklang findet.

Übersetzung und Schlüsselbegriffe von Sutra 4.14
In Sanskrit lautet der Originaltext von Yogasutra 4.14: „pariṇāmaikatvāt vastutattvam“ Eine direkte Übersetzung liefert zunächst einzelne Begriffe, die zusammengefügt die Bedeutung des Sutras ergeben:
- pariṇāma – Veränderung, Wandel, Umwandlung
Patanjali spricht hier vom kontinuierlichen Wandel oder Transformationsprozess, dem alle Dinge unterliegen. - ekatva – Einheit, Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit
Dieser Begriff betont, dass der Wandel eines Dinges einzigartig und zusammenhängend ist – ein einheitlicher Prozess, der das Ding zu dem macht, was es ist. - vastu – Gegenstand, Ding, Objekt
Gemeint ist jegliches Phänomen oder Objekt in der wahrnehmbaren Welt. Patanjali zufolge hat jedes Objekt eine eigene Identität oder Realität (Sanskrit tattva). - tattva – Wesen, Prinzip, Wirklichkeit
Hier im Kontext bedeutet es die Wesenswirklichkeit oder das, was etwas wirklich ist. Das Sutra sagt aus, dass diese Wesenswirklichkeit eines Objekts aus der Einheitlichkeit seines Veränderungsprozesses hervorgeht. Wie ist das genau zu verstehen? Dem versuchen wir im weiteren Artikel auf den Grund zu gehen.
Zusammengefasst könnte man Yogasutra 4.14 also folgendermaßen ausdrücken:
„Die Realität (das Wesen) eines Objekts (vastu) entsteht durch die Einheitlichkeit bzw. (in anderen Übersetzungen: oder) Einzigartigkeit seines Wandelprozesses (pariṇāma).“
Eine freie deutsche Übersetzung lautet entsprechend: „Alle Dinge befinden sich im Wandel, und jedes Ding ist durch seinen einzigartigen Wandel das, was es ist.“ Diese Aussage legt nahe, dass nichts in der Welt statisch oder vollkommen identisch mit etwas anderem ist – jeder Gegenstand, jeder Mensch, jedes Phänomen hat einen eigenen Entwicklungsweg und bleibt durch diesen Wandel einzigartig.

Alles im Wandel: Objekte der Wirklichkeit
Diese Idee der einzigartigen Transformation jedes Dinges wurde bereits in der klassischen Yogaphilosophie ausführlich kommentiert. Die alten Gelehrten haben Yogasutra 4.14 genutzt, um die metaphysische Grundlage der Wirklichkeit zu erläutern. Zentral ist dabei der Rückgriff auf die Sāṃkhya-Philosophie, die Patanjalis Yoga Sutras zugrunde liegt.
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
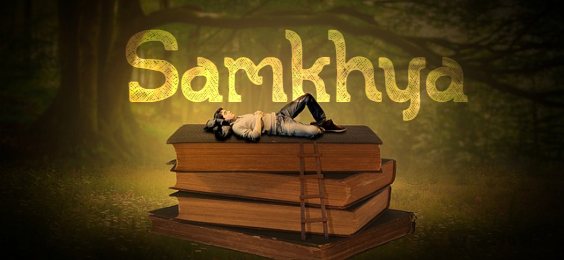
Wahrgenommenes und Wahrnehmendes – Auszug aus der Samkhya-Lehre
Das Samkhya ist eines der ältesten philosophischen Systeme indischer Herkunft. „Samkyha“ bedeutet wörtlich „Zahl“, „Aufzählung“ oder „das, was etwas in allen Einzelheiten beschreibt“. Hiermit ist die Aufzählung und Analyse jener Elemente gemeint, die gemäß Samkyha die Wirklichkeit bestimmen.
Allein das Wissen um diese Elemente soll bereits zur Erlösung vom Kreislauf der Wiedergeburten führen. Damit einher geht die Beendigung von drei Arten des Leidens (duhkha):
- adhyatmika (Leiden unter physischen oder psychischen Krankheiten),
- adhibhautika (von Außen zugefügtes Leid durch menschliche Gewalt oder Umwelteinflüsse),
- adhidaivika (Leid durch Naturgewalt, Umweltkatastrophen oder übernatürliche Phänomene).
Purusha, Prakriti, Guna
Das Universum und die Abläufe darin beruhen gemäß Samkyha auf zwei fundamentalen Prinzipien:
- Purusha: passiver aber bewusster Geist, auch Urseele, Weltgeist oder kosmisches Selbst genannt. Steht im Dualismus für Subjekt und das Wahre Selbst.
- Prakriti: aktive aber unbewusste „Urmaterie“, das Wahrnehmbare, das Benennbare oder „Natur“. Steht im Dualismus für Objekt und das Universum
Swami Satchidananda schreibt:
„Das Purusha ist das Wahre Selbst, das Purusha sieht. Prakriti ist alles andere.“
Es herrscht Uneinigkeit: Die Samkhya Philosophie sagt, dass es ein real existierendes Universum gibt. Die Vedanta-Lehre sieht alles als Maya, als Illusion an.
Prakriti und die Gunas
Der Urnatur Prakriti werden im Samkhya drei Gunas (Merkmale, Eigenschaften, von Hauer „Weltstoffenergien“ genannt) zugerechnet:
- Sattva (das Seiende, Reinheit, Klarheit). Gemäß Ayurveda-Lehre steht Sattva für Reinheit, Ausgeglichenheit, Balance und Neutralität. Charakterlich zeigt sich eine Sattva-Vorherschaft in Freigebigkeit, Gelassenheit, Zufriedenheit, Weisheit, Ausgeglichenheit und Toleranz. Menschen, die sich vorwiegend sattvisch ernähren sollen länger leben und gesünder alt werden. Als sattvische Nahrungsmittel gelten frische & reife Früchte, Honig, Milch, Reis, Weizen, Safran und Zimt.
- Rajas (Bewegung, Energie, Leidenschaft). Verantwortet Wandlung, Veränderung und Dynamik. Aber auch Zorn, Rastlosigkeit und Hektik.
- Tamas (Trägheit, Dumpfheit, Dunkelheit, Schwere). Eine Kraft, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit trübt und unsere Wirkkraft schwächt. Aber auch das Prinzip der Ruhe.
Sattva für den Yogi
Feuerstein (Buch bei Quellen ergänzen) schreibt: „Während aktive (rajas) und träge (tamas) Qualität dazu neigen, die Ich-Illusion aufrechtzuerhalten, erschafft die Qualität der Helligkeit (sattva), insoweit sie dominiert, die Vorbedingungen für das Befreiungsgeschehen. Daher erstrebt der yogin sattvische Konditionen und Zustände.“
Aber auch das Körper-Geist-System existiert auf Basis der drei Gunas. Als Yogi wisse man, dass alle drei Prinzipien miteinander wechselseitig verbunden sind. Jede Anhaftung an einen Zustand (Sattva ...) führt (ebenfalls) zu Leid.
Purusha
Purusha ist das Selbst, das allen fühlenden Wesen innewohnt. Durch Purusha erhalten Menschen, Tieren, Pflanzen und Götter ihre Empfindungsfähigkeit und Bewusstsein.
Des Menschen wahre und ursprüngliche Identität ist einzig und allein Purusha, die sich zum Zwecke des Erfahrens in Prakriti manifestiert hat, siehe Sutra II-18.
Nun verstrickt sich dieses Purusha in Prakriti, hält die zur Sphäre der Prakriti gehörigen Elemente und Bereiche irrtümlicherweise für Bestandteile seiner selbst. Daraus entsteht Leid.
Grundelement der Lehre des Samkhya für den nach Erlösung Strebenden ist deshalb, die beiden Substanzen Purusha und Prakriti und ihre Merkmale streng voneinander unterscheiden zu lernen.
Vedanta
Im nondualen Vedanta ist Prakriti nur eine Täuschung, Maya.
Physik und Quantentheorie
Betrachten wir den Bildschirm vor uns, so sehen wir gemäß der Physik ein Konstrukt aus Neutronen, Elektronen und Protonen, die alle auf einer eigenen Frequenz schwingen und um sich kreisen. Nahezu 100 Prozent des Bildschirmes besteht aus Vakuum! Nur unsere Sinne – die Sinne des Wahrnehmenden – machen daraus einen Monitor.
Die Quantenphysik macht alles noch verschwommener: Ob sich ein subatomares Partikel als Teilchen oder als Welle verhält, hängt vom Beobachter ab. Anders ausgedrückt: vom beobachtenden Bewusstsein. Vom Wahrnehmenden und dessen Wahrnehmung. Eigenschaften der Partikel wie dessen Lokalität können nicht vom Betrachter getrennt werden. Dies geht mehr in Vedanta (und Buddhismus)-Richtung als die Samkhya-Behauptung eines unabhängig von Purusha existierenden Universums Prakriti.
Sāṃkhya erklärt die Welt als Zusammenspiel der drei Gunas – der Urqualitäten
- Sattva (Leichtigkeit, Licht, Harmonie),
- Rajas (Aktivität, Bewegung) und
- Tamas (Schwere, Trägheit).
Nach klassischer Auffassung bestehen alle materiellen Dinge aus diesen drei Gunas, nur in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Siehe dazu auch die ausführlichen Erläuterungen zur Sutra zuvor.
Patanali schreibt, dass alle Objekte aus einer Mischung der drei Gunas bestehen und so real werden. Desikachar erläutert, darunter seien alle möglichen Objekte zu verstehen, “auch die Sinne, unser Geist, gedankliche Inhalte oder Emotionen”.
Wim van den Dungen kommentiert: „Die Bewegungen der Natur sind nicht zufällig, sondern die Formen, sichtbar und unsichtbar, sind guna-basiert und folgen einem Muster, wobei sich die Transformationen schnell wiederholen und eine homogene Bewegung erzeugen, die als ein eindeutiges Objekt erfahren wird.”
Feuerstein sieht Parallelen zu Heraklits Ausspruch “Alles fließt”. Die “Soheit” der Dinge erweckt nur den Anschein, als hätten wir es mit soliden Objekten zu tun.
Sukadev zieht in seinem Kommentar zu dieser Sutra Parallelen zu den drei Bestandteilen der Atomphyshik.
- Elektronen stehen für Rajas, sind in ständiger Bewegung.
- Protonen sind das Äquivalent zu Tamas, der Trägheit.
- Und Neutronen symbolisieren Ausgleich, Sattva.
Alle Elemente bestehen aus verschiedenen Mischungen dieser drei Grundbausteine der Materie. Diese könne analog auf Gemütszustände, Gedanken und Wünsche – die ja auch Bestandteil der Prakriti, der Urmaterie sind – angewendet werden.

Drei Blätter, scheinbar gleich, unterscheiden sich in Nuancen
Alle sind gleich und doch anders
Gemäß dieser Lehre, sind wir, unsere Persönlichkeit, unsere Eigenschaften und unser Körper auf die drei Gunas zurückzuführen – nur in unterschiedlicher Zusammensetzung. Auch unsere Erfahrungen. Und unsere Probleme. Sukadev verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass darum unser Leben nicht wirklich einzigartig ist, sondern stets nur eine andere Zusammensetzung der drei Gunas sei, die wir mit allen anderen Wesen teilen.

Alles fließt – der ständige Wandel
So wie alles aus diesen drei Gunas aufgebaut ist, so wandelt sich auch alles ständig. Tröstlich: Auch wenn du momentan vielleicht schlechte Erfahrungen machst, so wird sich auch dies wandeln. In der Yogalehre finden wir sogar die Ansicht, dass ein Mensch jede mögliche Erfahrung einmal machen müsse, bevor er Erleuchtung/Kaivalya erreichen könne.
Betrachte darum deine Erlebnisse und Gefühle mit Gleichmut, identifiziere dich nicht mit deinen Erfahrungen, verlange nach nichts und lehne nichts ab, lasse los. In diesem Zusammenhang sei abermals auf den Vers zum Umgang mit den Gunas aus der Gita verwiesen:
Die Gita und die Gunas
In der Bhagavad Gita (Kapitel 14) beschreibt Krishna ausführlich, wie die Guṇas den Menschen binden – und wie Befreiung darin besteht, „über die Guṇas hinauszugehen“ (gunātīta). Ein Zitat aus der Gita lautet:
"Wer nicht nach Lohn fragt und die Riten nach Vorschrift ausführt, hat eine von Sattva erfüllte Haltung. Wer Askese und Opfergabe hingebungsvoll und mit erleuchtetem Geist ausübt, ohne den Blick auf die Belohnung, von Herzen gibt, um seiner selbst willen."
Ebenfalls aus der Gita:
"Wer, wo ein ‚Guna‘ ihm erscheint,
Er darum diesen doch nicht hasst,
Nach andern, ‚Gunas‘ nicht begehrt,
im Geiste ruhig und gefasst;Wer gleichsam unbeteiligt bleibt,
Bei eines ‚Guna‘ Gegenwart,
Wer denkt, ‚ein Guna treibt sein Spiel‘,
Und deshalb stets den Gleichmut wahrt;Wer standhaft ist in Freud und Leid,
Wem gleich ist Scholle, Stein und Gold,
Wer gleich sich bleibt, wenn man ihn schmäht
Und wenn man ihm Bewund’rung zollt;Wem gleich ist Ehre oder Schmach,
Ob Freund, ob Gegner unterliegt,
Wer jeder Tat entsagt, der hat
Der ‚Eigenschaften‘ Macht besiegt.“
Und, wir greifen vorweg, wie du etwas erlebst, hängt vom Zustand deines Geistes ab. Siehe Sutra IV-15 und IV-17:
Yoga Sutra IV-15: Das gleiche Objekt kann von zwei Menschen unterschiedlich wahrgenommen werden, abhängig von ihrem Bewusstseinszustand
Yoga Sutra IV-17: Je nachdem, ob es unser Bewusstsein anregt (bzw. beeinflusst oder einfärbt) oder nicht, wird ein Objekt erkannt oder nicht wahrgenommen

Und was ist das Ziel?
Alles wird als Einheit wahrgenommen / erkannt. Siehe Sutra IV-34:
Yoga Sutra IV-34: Das Ziel des Purushas, unseres wahren Selbstes, ist das Aufgehen der Gunas in die Prakriti, der Urnatur, und seine Rückkehr zu Kaivalya, der absoluten Freiheit. Purusha, ruht dann in seiner wahren Natur. Hier endet die Yogalehre – iti.

Klassische Kommentare: Alte Auslegungen des Sutras
Der Yogabhashya, der ursprüngliche Kommentar zum Yogasutra (traditionell Vyasa zugeschrieben, ca. 4.–5. Jh.), erläutert Sutra 4.14 folgendermaßen: Obwohl alle Objekte letztlich aus den gleichen Gunas aufgebaut sind, manifestieren sie sich als einzelne Dinge, weil die Gunas sich in jedem Objekt auf besondere Weise verbinden. Alle Eigenschaften eines Gegenstands erscheinen uns als eine Einheit, weil sie einheitlich aus den zugrundeliegenden Elementen hervorgegangen sind.
Vyasa veranschaulicht dies mit konkreten Beispielen: Eine Ausprägung der Gunas mit überwiegendem Sattva-Anteil bildet etwa ein Instrument der Wahrnehmung, z. B. das Gehörorgan; wohingegen eine andere Ausprägung (mit mehr Tamas) das Objekt des Hörsinns hervorbringt, z. B. den Klang. Beide – Sinnesorgan und Klang – sind verschiedene Veränderungsformen derselben drei Gunas. Trotzdem nehmen wir sie als getrennte Dinge wahr, weil in jedem eine andere einheitliche Verwandlung der Gunas dominiert: Das Ohr ist ein zusammenhängendes Sinnesorgan, der Klang ein in sich zusammenhängendes Schallphänomen. Aus den feinsten Gunas bilden sich so zunächst unsichtbare Urstoffe (tanmātras, z. B. der subtile Klangstoff śabda tanmātra), daraus die fünf Elemente (Raum, Luft, Feuer, Wasser, Erde) und schließlich die vielgestaltigen konkreten Objekte – vom einzelnen Kuh bis zum Berg. Jedes dieser Dinge stellt eine „einheitliche Veränderung“ dar, eine einzigartige Kombination der Urqualitäten, die ihm seine spezifische Gestalt und Realität verleiht.
Die alten Kommentatoren betonen damit: Kein Objekt in der Natur ist bloß eine zufällige Ansammlung von Teilen, sondern ein kohärentes Ganzes, entstanden aus dem Wechselspiel der Gunas. Dabei schwingt auch ein philosophischer Realismus mit. Patanjali vertritt die Ansicht, dass die Welt der Dinge real ist – auch wenn sie vergänglich und „illusorisch“ im Vergleich zur ewigen Seele ist, besitzt sie doch tatsächliche Existenz (sie ist „täuschend, aber keine Täuschung“, wie manche sagen).
In der klassischen Debatte wendet sich Vyasa deshalb ausdrücklich gegen Auffassungen, die alle Objekte lediglich für Gedankengebilde oder Illusionen halten. Er kritisiert Denker, welche behaupten, die wahrnehmbare Welt sei nichts weiter als eine Projektion des Geistes, vergleichbar einem Traum. Solche Ideen wurden etwa von buddhistischen Yogacara-Philosophen vertreten, die nur das Bewusstsein als wirklich ansahen. Vyasa begegnet dem mit einer gewissen Ironie: Wenn jemand behauptet, die Außenwelt existiere gar nicht, sondern sei vom Geist erdichtet – warum vertraut diese Person dann auf die Kraft ihres eigenen Geistes, um die Welt wegzuerklären, und redet dennoch darüber? Die objektive Welt hat ihre eigene Macht und Realität, unabhängig davon, ob wir sie wahrnehmen oder anerkennen.
Anders gefragt: Fällt ein Baum im Wald, auch wenn niemand da ist, der ihn hört? Patanjali würde sagen: Ja, denn die Dinge haben Bestand aus eigener Natur heraus – ihre Realität gründet in der kontinuierlichen Transformation der Gunas, nicht bloß in der Wahrnehmung durch ein Bewusstsein.
Ein späterer Kommentator, Vachaspati Mishra (9. Jh.), liefert anschauliche Beispiele, um die Einheitlichkeit einer Veränderung trotz mehrerer Ausgangsstoffe zu verdeutlichen. Er schreibt, dass verschiedene Substanzen gemeinsam eine einzige neue Einheit formen können:
„Die Kuh, das Pferd, der Büffel, der Elefant – all diese verwandeln sich in ein einziges Material, nämlich Salz, wenn man ihre Körper in eine Saline legt.“
Ebenso vereinigen sich Docht, Öl und Flamme zu einer einzigen Lampe. Diese Analogien mögen etwas vereinfacht klingen, doch sie illustrieren den Kernpunkt: Aus Vielfalt kann Einheit werden. Genauso bringen die drei Gunas trotz ihrer Unterschiedlichkeit immer wieder einzelne konkrete Dinge hervor. Für Vachaspati beweist dies, dass jedes tanmātra (feinstoffliches Element), jedes physische Element und jeder aus ihnen gebildete Gegenstand eine wirkliche Einheit besitzt. Das Salz aus verschiedenen Tieren ist letztlich dasselbe Salz; die Lampe brennt als ein einzelnes Licht, obwohl mehrere Komponenten nötig waren. Entsprechend ist beispielsweise ein Baum eine zusammenhängende Entität, auch wenn er aus Erde, Wasser, Wärme, Luft und Raum zusammengesetzt ist – sein Wesen (tattva) ist die spezifische Art, wie sich diese Bestandteile in ihm wandeln und vereinen.
Diese klassischen Auslegungen unterstreichen Patanjalis Sicht: Die Natur ist ein kontinuierlicher Prozess von Veränderungen, jedoch strukturieren sich diese Veränderungen zu erkennbaren, realen Einheiten. Nichts in der Natur ist absolut identisch mit etwas anderem, weil die Geschichte seiner Transformationen immer eine andere ist – selbst zwei äußerlich gleiche Objekte (sagen wir zwei identische Schneeflocken oder zwei „gleiche“ Stühle vom Fließband) unterscheiden sich spätestens im Detail ihres Werdegangs.

Aktuelle Kommentare und wissenschaftliche Parallelen
Spannend ist, dass moderne Yogakommentatoren und sogar die Wissenschaft diese alte Einsicht (bei bestimmter Betrachtung) bestätigen und erweitern.
Zeitgenössische Yogalehrer betonen oft die Ähnlichkeit von Patanjalis Aussage mit dem Prinzip der Vergänglichkeit (Impermanenz), das auch in anderen Traditionen wie dem Buddhismus oder bereits bei Heraklit in der Antike auftaucht. Heraklits berühmtes Motto „panta rhei“ – alles fließt – spiegelt genau wider, was Yogasutra 4.14 sagt: Alles ist unaufhörlich im Fluss der Veränderung begriffen. Kein Moment gleicht exakt dem anderen, kein Objekt behält ewig die gleiche Form. „Nichts entgeht irgendeiner Form von Veränderung“, hielt Heraklit schon vor 2500 Jahren fest. Die Yogaphilosophie stimmt darin überein und liefert mit dem Konzept der Gunas eine Erklärung, warum die Dinge sich wandeln und dennoch eine erkennbare Identität haben.
Moderne Yogakommentare greifen diesen Faden auf. So wird Sutra 4.14 heute etwa übersetzt als „Die Eigenschaften eines Objekts erscheinen als eine Einheit, da sie sich einheitlich aus den zugrundeliegenden Elementen manifestiert haben.“. Das heißt, zeitgenössische Lehrer betonen, dass wir in der Wahrnehmung immer nur das Gesamtergebnis eines Prozesses sehen – nicht die einzelnen Bestandteile, die sich verändert haben. Wir sehen den fertigen Krug und nicht die Tonpartikel, aus denen er geformt wurde; wir erleben eine Stimmung in ihrer Gesamtheit, nicht die unzähligen neuronalen Impulse, die sie hervorbringen.
Diese Interpretation hilft Praktizierenden zu verstehen, dass die Vielfalt der Erscheinungen letztlich auf simplen Grundbausteinen beruht, die sich unterschiedlich kombinieren. Der Yogalehrer T.K.V. Desikachar betont in seinem Kommentar, dass kein Objekt isoliert besteht: Es ist immer Produkt eines Prozesses. Demnach erinnert uns Patanjali daran, hinter die Oberfläche zu blicken – zu erkennen, dass jedes Ding eine Geschichte von Veränderung in sich trägt, die es einzigartig macht.
Interessanterweise wird die alte Idee von der ständigen Veränderung und Einzigartigkeit heute durch verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse untermauert. Quantenphysik und Kosmologie zeigen, dass scheinbare Stabilität oft trügerisch ist. Auf subatomarer Ebene ist Materie in ständiger Bewegung: Selbst in einem festen Kristallgitter zittern und vibrieren die Atome unaufhörlich hin und her. Nichts steht wirklich still – außer vielleicht bei theoretisch unerreichbaren -273,15 °C (dem absoluten Nullpunkt). Der Nobelpreisträger Richard Feynman erklärte einmal, wenn er einen einzigen Wissenssatz an künftige Generationen weitergeben könnte, wäre es folgender:
„Alle Dinge bestehen aus Atomen – kleinen Teilchen, die sich in ständiger Bewegung befinden.“
In einem Wasserglas zum Beispiel wimmeln die Moleküle umher, stoßen sich ab und ziehen sich an; sie sind ständig in Bewegung, niemals wirklich statisch. Was für das Auge als ruhiges, unveränderliches Objekt erscheint, ist in Wahrheit ein pulsierender Tanz von Teilchen. Die moderne Physik bestätigt damit eindrucksvoll Patanjalis Erkenntnis: Die Natur ist dynamisch. Alles, was existiert, ist Prozess – vom winzigen Elektron, das um den Atomkern schwirrt, bis zu Galaxien, die sich bewegen und entwickeln.
Darüber hinaus hat die Wissenschaft festgestellt, dass Einzigartigkeit ein grundlegendes Prinzip der Natur ist. Kein noch so simples System ist exakt reproduzierbar – es gibt immer minimale Unterschiede.
- Ein schönes Beispiel sind Schneeflocken: Traditionell heißt es, keine Schneeflocke gleiche genau der anderen. Neuere Untersuchungen zeigen zwar, dass bei Milliarden Flocken statistisch durchaus ähnliche Formen vorkommen können, doch streng genommen sind selbst zwei fast identische Flocken in ihren molekularen Details verschieden.
- Ähnlich verhält es sich mit biologischen Strukturen: Kein Blatt an einem Baum ist exakt wie das andere, jedes hat eine einzigartige Musterung der Adern, einen leicht unterschiedlichen Umriss.
- Fingerabdrücke sind sprichwörtlich einzigartig – nicht einmal eineiige Zwillinge teilen den gleichen Abdruck.
In der Informatik oder Philosophie wird dieses Prinzip auch als Identitätsprinzip von Leibniz bezeichnet: Zwei Dinge sind nur dann wirklich unterscheidbar, wenn sich wenigstens eines ihrer Merkmale unterscheidet – und in der Realität finden sich stets Unterschiede, wenn man genau genug hinschaut.
Die Neurowissenschaften untermauern Patanjalis Sicht ebenfalls, insbesondere was den ständigen Wandel angeht. Das menschliche Gehirn etwa ist kein statisches Organ, sondern wandelt sich ständig durch Neuroplastizität. Lernen wir etwas Neues oder machen wir eine intensive Erfahrung, verändern sich die Verbindungen zwischen unseren Nervenzellen. Selbst im Erwachsenenalter passt sich das Gehirn an und organisiert seine Schaltkreise neu, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Wissenschaftler betonen inzwischen die „dynamische, sich ständig weiterentwickelnde Natur des Gehirns“. Mit jedem Gedanken, jedem Gefühl fließen neurochemische Impulse; nichts bleibt auf Dauer unverändert gespeichert.
So gesehen spiegelt unser Geist im Kleinen genau das wider, was Patanjali im Großen beschreibt: ein fortwährender Fluss von Zustandsänderungen, der unsere Identität dennoch aufrecht erhält. Deine heutige Persönlichkeit ist das Resultat unzähliger einzigartiger mentaler Wandlungsprozesse – kein Moment deines Bewusstseins wiederholt sich je exakt.
Diese Erkenntnis teilen übrigens auch andere Meditationslehren: In der Achtsamkeitspraxis beobachtet man, wie Gedanken und Empfindungen kommen und gehen, ständig neu auftauchen und wieder vergehen. Alles ist im Fluss; und gerade darin, dass sich kein Augenblick wiederholt, liegt die Frische und Lebendigkeit des Erlebens.

Praktische Bedeutung für Yoga-Praktizierende
Neben der philosophischen und wissenschaftlichen Betrachtung hat Yogasutra 4.14 auch eine sehr greifbare, praxisnahe Bedeutung – besonders für Yoga-Praktizierende und Lehrende. Die Erkenntnis „alles befindet sich im Wandel“ ist nicht nur ein abstraktes Konzept, sondern lässt sich im eigenen Körper und Geist erfahren.
In der Yogapraxis zeigt sich die Wahrheit dieser Sutra-Aussage ständig: Jede Yogastunde ist anders. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass sich eine vertraute Asana an unterschiedlichen Tagen völlig verschieden anfühlen kann. Dein Körper ist nie exakt derselbe – Muskeln, Energien, sogar die Zellen befinden sich in permanentem Umbau. Heute bist du vielleicht flexibler als gestern, morgen möglicherweise kraftvoller als heute, und in diesem Moment atmest du anders als noch vor wenigen Augenblicken. Keine zwei Atemzüge sind identisch.
Wenn du im Pranayama oder in der Meditation lauschst, bemerkst du die feinen Unterschiede: mal strömt der Atem sanft und kühl, mal warm und kräftig; mal ist der Geist ruhig, mal unruhig – immer verändert er sich. Diese direkte Erfahrung bestätigt: Wandel ist allgegenwärtig.
Für Yogalehrende kann Sutra 4.14 ein Schlüssel sein, um SchülerInnen Geduld und Achtsamkeit zu lehren. Wenn alle Dinge – einschließlich wir selbst – sich ständig verändern, dann sollten wir uns weder an schwierigen Momenten festklammern noch stur an einem idealisierten Endzustand. Der Körper, der heute steif ist, kann durch Übung weicher werden; die Unruhe im Kopf kann sich wandeln, wenn wir sie akzeptieren und beobachten.
Umgekehrt gilt aber auch: Ein angenehmer Zustand wird nicht ewig währen. Diese Einsicht fördert Nicht-Anhaftung (vairagya): Yogaübung lehrt uns, die Veränderungen wahrzunehmen, ohne uns daran zu verzweifeln oder zwanghaft festzuhalten. Wenn die Balancepose gestern klappte und heute wackelt – kein Grund zur Frustration, sondern eine Erinnerung daran, dass jede Praxis einzigartig ist.
Gleichzeitig schenkt das Sutra Trost und Hoffnung: Nichts Bleibt, wie es ist – das heißt auch, Leid und Krisen gehen vorüber. Die schmerzende Erfahrung auf der Matte (oder im Leben) transformiert sich, nichts quält uns endlos in gleicher Intensität. So gesehen beinhaltet Patanjalis Aussage eine Einladung zur Gelassenheit. Wer tief versteht, dass „alles fließt“, kann im Strom des Lebens eher mitschwimmen, statt verzweifelt gegen das Unvermeidliche anzukämpfen.
Interessanterweise verweist Yogasutra 4.14 indirekt auch auf einen Pol der Beständigkeit im Wandel. Spätere Sutren im vierten Kapitel erläutern, dass es jenseits aller Veränderungen einen unveränderlichen Kern gibt: den Purusha, das reine Bewusstsein oder Selbst, das all die Wandlungen nur beobachtet, selbst aber unbewegt bleibt Patanjali’s Weltbild ist dualistisch – auf der einen Seite Prakriti (die Natur, die sich verändert), auf der anderen Purusha (das Bewusstsein, ewig unbewegt). Warum ist das wichtig? Aus praktischer Sicht erinnert uns das: Mitten im Chaos der Veränderungen gibt es in uns einen ruhenden Punkt, einen inneren Zuschauer, der still wahrnimmt, wie alles kommt und geht. In der Meditation versuchen Yogis genau diesen stillen Beobachter in sich zu verankern – jenen Teil von uns, der die Vergänglichkeit aller Erfahrungen erkennt, ohne davon mitgerissen zu werden. Sobald wir uns mit diesem inneren Kern identifizieren, verlieren Veränderungen ihren Schrecken: Wir wissen ja, der Kern unseres Wesens bleibt unversehrt, während um uns herum der Tanz der Gunas tobt.
Für die Praxis bedeutet das: Yoga lädt dich ein, die ständige Veränderung bewusst zu erleben. Jede Asana, jede Atemübung kann zum Experiment werden, die feinen Wandlungsprozesse im Körper-Geist-System zu erforschen. Du spürst zum Beispiel in einer Vorbeuge die Spannung der Muskeln – bleib einen Moment, atme hinein und beobachte, wie sich die Empfindung mit jedem Atemzug verändert. Vielleicht lässt die Spannung langsam nach, vielleicht wandert sie oder verwandelt sich in Wärme. Nichts bleibt statisch. Dieses Erspüren der Vergänglichkeit schult die Achtsamkeit und führt zu tieferem Verständnis: Der Körper wird zum Lehrer über Wandel und Einzigartigkeit.
Auch im Alltag hilft die Erinnerung an Yogasutra 4.14, bewusster und flexibler zu leben. Sie ermutigt, Veränderungen anzunehmen – sei es der Wechsel der Jahreszeiten, ein neuer Lebensabschnitt oder einfach die Laune eines Tages. Wenn alle Dinge „in der Veränderung einzigartig“ sind, dann hat jeder Moment etwas Einmaliges. Diese Haltung fördert Wertschätzung: Der heutige Sonnenaufgang, die Begegnung mit einem Freund, sogar die Herausforderungen im Job – sie alle sind so nie wiederholbar. Paradoxerweise kann das Bewusstsein der Vergänglichkeit uns dazu bringen, das Hier und Jetzt intensiver auszukosten. Statt an der Vergangenheit zu hängen oder ängstlich an die Zukunft zu denken, wird klar: Das Leben entfaltet sich nur in der Bewegung, in diesem Fließen von Augenblick zu Augenblick.
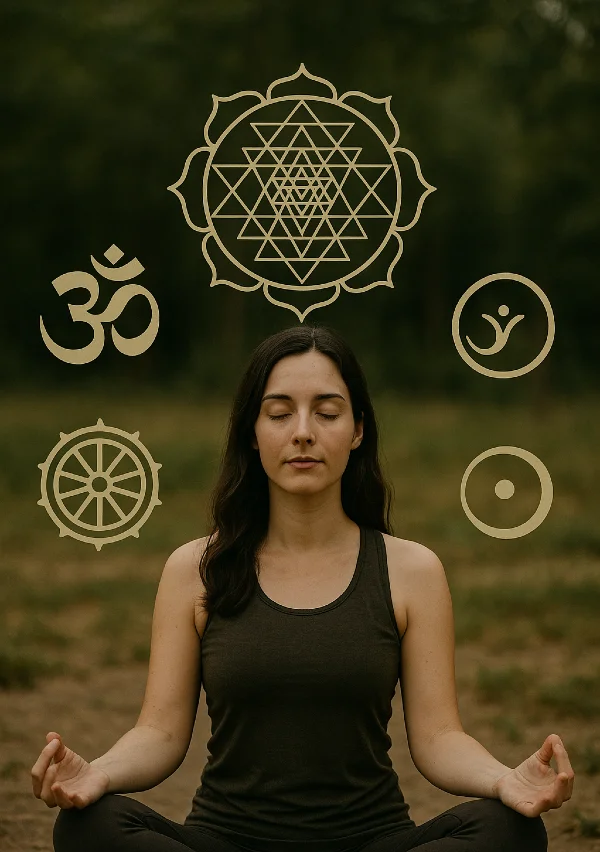
Übungsvorschläge zu Sutra IV-14
Wie du Yogasutra 4.14 in der Meditation erfahren kannst
Meditieren über „Alles befindet sich im Wandel und ist in der Veränderung einzigartig“ klingt zunächst abstrakt. Aber eigentlich kannst du es mit etwas üben, das dir immer zur Verfügung steht: deinem Atem.
Setz dich hin, richte die Wirbelsäule auf, und beobachte. Ein Atemzug gleicht nie dem anderen. Mal fließt er geschmeidig, mal stolpert er. Mal dehnt er den Brustkorb, mal tiefer den Bauch. Wenn du lange genug hinschaust, merkst du: Nichts wiederholt sich exakt. Das ist die direkte Erfahrung von pariṇāma, dem Wandel.
Eine zweite Möglichkeit: Achte während der Meditation auf deine Gedanken. Zunächst wirkt es chaotisch: Bilder, Erinnerungen, Pläne. Aber wenn du geduldig bleibst, erkennst du: Jeder Gedanke ist wie eine Seifenblase – taucht auf, platzt, ist weg. Und der nächste ist anders. Selbst wenn es wieder um „meine To-Do-Liste“ geht, ist es nicht derselbe Gedanke wie gestern. Dein Geist wird zum Lehrbuch dieser Sutra.
Wenn du möchtest, kannst du dir die Frage stellen: „Wie fühlt sich dieser ständige Wandel an?“ Manchmal befreiend, manchmal unruhig, manchmal beides zugleich. Darum geht es: nicht die Theorie herunterbeten, sondern spüren, wie das Sutra in dir lebendig wird.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?
Wie du Sutra 4.14 im Alltag üben kannst
Das Schöne ist: Diese Sutra trainierst du nicht nur auf dem Meditationskissen. Du kannst sie mitten im Alltag erforschen – dort, wo das Leben sowieso nie stillsteht.
- Beim Zähneputzen. Klingt banal, aber achte einmal darauf: Heute fühlt es sich anders an als gestern. Der Geschmack der Zahnpasta, die Temperatur des Wassers, sogar die Art, wie die Borsten das Zahnfleisch berühren. Schon hier erlebst du die Einzigartigkeit des Augenblicks.
- Im Gespräch. Wenn du mit jemandem redest, erinnere dich: Diese Person ist nicht dieselbe wie vor einer Woche. Ihr Klang, ihre Stimmung, sogar die Falten um die Augen haben sich verändert. Statt die Sätze routiniert zu hören, kannst du lauschen, als wäre es eine Premiere. Denn genau das ist es.
- In der Yogapraxis. Du gehst in den Hund. Gestern hast du dich kraftvoll gefühlt, heute zittert dein Oberschenkel. Anstatt frustriert zu denken „Gestern war’s besser“, sieh es als Experiment: „Ah, so fühlt sich der Hund heute an. Einzigartig. Morgen wieder anders.“ Die Matte wird so zum Feldforschungslabor dieser Sutra.
- In Momenten von Ärger oder Stress. Halte dir vor Augen: Auch das vergeht. Dein Ärger von heute Mittag – wo ist er jetzt? Schon verflogen. Kein Gefühl bleibt unverändert, egal wie fest es sich im Moment anfühlt. Das kann sehr befreiend sein, gerade wenn du in einer Situation feststeckst.
Warum das Üben Sinn macht
Wenn du diese Haltung einübst, bekommst du zwei Geschenke. Erstens: mehr Gelassenheit. Du hängst dich weniger an Dingen fest, weil du weißt: sie verändern sich sowieso. Zweitens: mehr Dankbarkeit. Weil du merkst, dass jeder Moment ein Unikat ist – nie wieder kommt genau dieser Abend, genau dieser Atemzug, genau dieses Gespräch.
Das Üben von Yogasutra 4.14 ist also kein Trockenunterricht über Gunas und Philosophie. Es ist ein sehr praktisches Erinnern: Alles lebt, alles wandelt sich, und gerade deshalb ist jeder Augenblick kostbar.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.14: über die Realität der Dinge
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
Schauen wir uns Vyasas Kommentar zu dieser Sutra noch einmal von einem andren Blickwinkel an. Vyasa kommentiert im Zusammenhang mit Yogasutra 4.14 die Frage: Wenn alles aus denselben „Qualitäten“ (den drei Gunas) besteht – warum erscheinen dann die Dinge so verschieden? Warum ist das eine „Klang“, das andere „Ohr“?
Er antwortet sinngemäß:
- Eine bestimmte Modifikation der Gunas, die Anteile von Helligkeit (Sattva), Aktivität (Rajas) und Schwere (Tamas) trägt, formt sich zu einem Instrument. So entsteht etwa das Gehörorgan.
- Eine andere Modifikation derselben Gunas tritt dagegen in Erscheinung als das, was gehört werden kann: das Klang-Atom, das feinstoffliche śabda tanmātra.
Mit anderen Worten: Dieselben Grundqualitäten können sich so verwandeln, dass sie entweder das Organ des Hörens hervorbringen – oder das Objekt, das gehört wird.
Von den feinsten Atomen zur Vielfalt der Welt
Vyasa erklärt weiter:
- Das feinste Atom des Elements Erde (pṛthvī) entsteht durch Modifikationen von Klang und weiteren Qualitäten, verbunden mit der Eigenschaft der Form (mūrti).
- Aus diesen feinsten Stoffen (tanmātras) entwickeln sich konkrete Dinge: Erde, Kuh, Baum, Hügel – all die Vielfalt, die wir kennen.
- Dasselbe Prinzip gilt auch für die anderen Elemente: Wasser, Feuer, Luft, Raum. Jede Modifikation trägt ihre charakteristische Qualität – Glätte, Hitze, Bewegung oder Weite – und bringt dadurch ihre eigenen Erscheinungsformen hervor.
Vyasa weist darauf hin: Diese Modifikationen lassen sich nicht nur theoretisch verstehen, sondern auch in Meditation erfahren.
Realität und Vorstellung
Ein weiterer Punkt ist Vyasa wichtig:
- Es gibt kein Objekt ohne begleitende Vorstellung. Wenn du eine Kuh siehst, gibt es die Kuh und deine Vorstellung von „Kuh“.
- Aber: Es gibt durchaus Vorstellungen ohne reales Objekt – zum Beispiel im Traum.
Manche Denker seiner Zeit behaupteten: Alles sei wie ein Traum – die Welt sei nur eine Erfindung des Geistes. Vyasa widerspricht entschieden.
Er sagt sinngemäß:
„Die objektive Welt ist durch ihre eigene Kraft präsent. Wie könnte man sie einfach wegdiskutieren? Und wenn sie wirklich nur Einbildung wäre – warum reden diejenigen, die das behaupten, dann trotzdem über sie, als gäbe es sie?“
Ein Argument mit einem Schuss Ironie. Er dreht die Sache um: Wenn die Welt wirklich nur Fantasie wäre, müsste auch die Behauptung „die Welt ist Fantasie“ bloß Fantasie sein.
Was du daraus mitnehmen kannst
Vyasa erinnert uns an zwei Dinge:
- Alles ist Wandel. Aus denselben Urbausteinen entstehen völlig unterschiedliche Erscheinungen – Ohr und Klang, Baum und Berg.
- Die Welt ist real. Auch wenn wir sie mit unserem Geist deuten und färben, hat sie eine eigene Präsenz, die wir nicht einfach wegleugnen können.
Für deine Praxis heißt das: Wenn du meditierst oder Asanas übst, beobachte genau, wie sich derselbe Atem einmal als Ruhe, einmal als Kraft, einmal als Unruhe zeigt. Aus denselben Grundqualitäten formt sich immer etwas Neues. Und gleichzeitig: Die Matte, der Raum, dein Körper – sie sind wirklich da. Keine bloße Illusion.
👉 So macht Vyasa deutlich: Zwischen ständiger Veränderung und realer Welt gibt es keinen Widerspruch. Gerade die Vielfalt und Wandelbarkeit der Dinge zeigt ihre Lebendigkeit und ihre Wahrheit.

Siehe auch folgende Sutras zu den Gunas
Yoga Sutra I-16: Das Nichtbegehren nach den Elementen der Erscheinungswelt führt zur Wahrnehmung des wahren Selbstes, des Purushas – die höchste Form der Verhaftungslosigkeit
Yoga Sutra II-3: Unwissenheit, Identifikation mit dem Ego, Begierde, Abneigung und (Todes-)Furcht sind die fünf leidbringenden Zustände (Kleshas)
Yoga Sutra II-15: Für jemanden mit Unterscheidungsfähigkeit ist alles in dieser Welt leidvoll; das liegt an der Vergänglichkeit, unserem Verlangen, den unbewussten Prägungen (Samskaras) und an der Wechselhaftigkeit der Grundeigenschaften der Natur (Gunas)
Yoga Sutra II-18: Die wahrgenommenen Objekte sind aus den 3 Gunas mit den Eigenschaften Klarheit, Aktivität und Trägheit zusammengesetzt, bestehen aus Elementen und Wahrnehmungskräften – alles Wahrgenommene dient der sinnlichen Erfahrung und der Befreiung
Yoga Sutra II-19: Die Stufen der Eigenschaftszustände von den Grundbausteinen der Natur (den Gunas) sind spezifisch, unspezifisch, subtil-differenziert und undefinierbar.
Yoga Sutra IV-13: Diese (Eigenschaften/Formen) sind manifest oder subtil und bestehen aus den drei Gunas
Yoga Sutra IV-32: Dann (wenn Dharma-Megha-Samadhi erreicht wurde) enden für den Yogi die Veränderungen in der Natur durch die drei Gunas, weil diese ihren Zweck erfüllt haben
Yoga Sutra IV-33: Krama, das Kontinuum bzw. die Abfolge von Momenten und die damit verbundene Transformation, wird vom Yogi erkannt, wenn die Wandlungen der Gunas enden
Yoga Sutra IV-34: Das Ziel des Purushas, unseres wahren Selbstes, ist das Aufgehen der Gunas in die Prakriti, der Urnatur, und seine Rückkehr zu Kaivalya, der absoluten Freiheit. Purusha, ruht dann in seiner wahren Natur. Hier endet die Yogalehre – iti.

Fazit
Yogasutra 4.14 mag auf den ersten Blick theoretisch anmuten, doch es trägt eine Botschaft, die sowohl philosophisch als auch praktisch von unschätzbarem Wert ist. Die alten Yogameister wussten: Alles wandelt sich, und genau dadurch ist jedes Wesen, jedes Ding auf seine Weise wirklich und unvergleichlich. Moderne Stimmen – von Yogalehrern bis zu Physikern – stimmen mit ein und liefern Belege dafür, dass Patanjalis Einsicht zeitlos gültig ist.
Für uns Praktizierende bietet diese Weisheit die Chance, Veränderungen nicht als Bedrohung, sondern als essenziellen Ausdruck des Lebens zu begreifen. In der beständigen Veränderung liegt sowohl die Wahrheit der Welt, wie Yoga sie sieht, als auch der Schlüssel zu mehr Gelassenheit, Kreativität und Verbundenheit mit dem Fluss des Seins. Alles ist im Wandel – und genau darin entfaltet sich die einzigartige Wirklichkeit jedes einzelnen Moments.
Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-14
Zeit und Existenz – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 12 bis 17
Länge: 12 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Warum nichts in der Natur identisch ist – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.14
Länge: 6 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Gott ist der Tätige: Asha Nayaswami (Class 65) zu Sutra 4.11 (Rest) bis 4.17
Länge: 70 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


