Udâna-jayâj jala-panka-kantakâdishv asanga utkrântish cha
उदानजयाअत् जलपण्खकण्टकादिष्वसङ्गोऽत्क्रान्तिश्च
Manche Verse in den Yoga-Sutras sind wie kleine poetische Rätsel – und dann stolpert man über III.40: Levitation, Unberührbarkeit, Energie, die dich tragen soll? Klingt erstmal weit hergeholt. Doch wer sich in die Kommentare einliest und hineinfühlt, entdeckt dahinter eine uralte Lehre über innere Leichtigkeit, über den aufsteigenden Atem und das wunderbare Gefühl, wenn du das Leben nicht mehr mit dir herumschleppst, sondern es dich hebt. Der Artikel führt dich in diesen Vers ein – mit Wurzeln in alten Kommentaren, Praxisideen für den Alltag und dem Versuch, das Unerklärbare ein kleines Stück greifbar zu machen.
Kurz zusammengefasst
- 🌀 Udāna – die aufsteigende Lebenskraft
Udāna ist einer der fünf Haupt-Prāṇas im Körper. Er wirkt im Bereich von Kehle und Kopf und steht für Aufrichtung, Sprache, Bewusstsein und geistiges Wachstum. - 🔬 Wirkung durch Samyama
Durch gezielte meditative Versenkung (Samyama) auf Udāna entwickelt sich laut Yoga-Sutra III.40 die Fähigkeit, nicht mehr von Wasser, Schlamm oder Dornen berührt zu werden – symbolisch oder wörtlich als Levitation oder Austritt des Geistes aus dem Körper verstanden. - 🧘 Praxisnahe Umsetzung
Udāna kann durch Ujjayi-Atmung, Umkehrhaltungen, Mantrasingen und bewusste Kommunikation im Alltag gestärkt werden. Auch Schweigephasen oder achtsames Sprechen fördern den Energiefluss. - 📿 Bedeutung in klassischen Kommentaren
Klassische Ausleger wie Vyāsa oder Hariharananda betonen Udānas Rolle im bewussten Tod, beim Austritt aus dem Körper und als Träger von Sprache und Willen. Moderne Stimmen deuten das eher als innere Leichtigkeit und geistige Unberührbarkeit. - 💡 Metaphysik trifft Alltag
Die Sutra lädt dazu ein, das Über-sich-Hinauswachsen nicht nur spirituell zu sehen, sondern auch ganz lebensnah als Fähigkeit, aufrecht, klar und unabhängig durch schwierige Lebensphasen zu gehen.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits
Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:
- Udana, udâna = Wörtlich der „Aufwärts-Atem“; eines der fünf Prânas (Lebensenergieströme); Prana/(feinstoffliche) Energie in der Region der Kehle; aufsteigende Energie; oberster Bereich des Energieflusses; die Lebenskraft im Oberkörper; nach oben ausatmen;
- Jayat, jayât = durch Meisterung; durch Sieg über; durch Kontrolle von; Beherrschung;
- Jala = Wasser;
- Ppanka, paṇkha = Schlamm; Moor, Sumpf;
- Kantaka, kaṇṭaka = Dornen; Stachel;
- Adisu, ādiṣu = und so weiter; und andere;
- Kantakadishu, kantakâdishu = Dornen usw.;
- Asangah, asaṅgaḥ = Nichtberührung; ohne Kontakt; Unberührbarkeit; nicht hängen bleiben; Freiheit von Anhaftung; frei/ungehindert bleiben;
- Utkrantih, utkrântih, utkrānti = aufsteigen; Levitation, Schweben; leicht sein; nach oben fliegen; nach vorne; nach außen; darüber hinaus gegangen;
- Cha, ca = und

Zu den Quellen
Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:
Bücher
- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit
- Iyengar: Der Urquell des Yoga
- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga
- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie
- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra
- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali
- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga
- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali
- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali
- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)
- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)
- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)
- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)
Internetseiten
- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de
- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info
- Zu den Sutras auf 12koerebe.de
- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de
- Openland.de (mittlerweile offline)
- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)
- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)
- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)
- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.
- Übersetzung von James Haughton Woods
- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)
- Wisdom Library
Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.
Dein Übersetzungsvorschlag
Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.
Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?
Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra
Samyama ist die Schlüsselübung im dritten Kapitel des Yogasutra zum Erreichen der geistigen Kräfte. In den Sutras III-1 bis III-7 erläutert Patanjali zunächst, was Samyama ist: die Kombination aus
- Dharana (Konzentration),
- Dhyana (Meditation) und
- Samadhi (Überbewusstsein).
In Sutra III-8 ergänzt er dann, dass der Yogi zur Erlangung der Erleuchtung über Samyama hinausgehen muss.
In den Sutras III-9 bis III-15 geht es weiter mit Erläuterungen, welche Wandlung der Geist (Chitta) vollziehen muss, um Samyama bis zur Perfektion ausüben zu können. Aufeinander aufbauend sind das die Stadien
- Nirodha-Parinama (Wandel durch Sammlung, einfache Konzentration),
- Samadhi-Parinama (Wandlung durch länger andauernde Konzentration) und
- Ekagrata-Parinama (Wandel/Transformation durch vollkommene Versenkung auf einen Punkt/ein Thema).
Der notwendige Wandel des Geistes erfolgt nach und nach, ist keine sprunghafte Entwicklung.
In den Sutras III-16 bis III-49 macht Patanjali eine ganze Reihe von Vorschlägen, worauf man Samyama lenken könnte und welche Folgen (Siddhis = Kräfte, besondere Erkenntnisse) sich jeweils daraus ergeben.
Sutra III-40 erläutert yogische Möglichkeiten, nicht mehr von Schmutz, Dornen etc. belästigt zu werden und die Fähigkeit der Levitation.
Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen
Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen
Patanjalis Anleitungen zur Erlangung der Siddhis lauten generell, dass der Praktizierende Samyama gezielt auf ein Meditationsobjekt anwendet. Samyama ist die Verbindung aus anhaltender Konzentration, Meditation und schlussendlich Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Objekt der Meditation. Skuban sieht den Vorgang von Samyama als “mentales Eindringen in ein Objekt, das den Übenden schließlich zu den feinstofflichsten Bereichen des Seins führt.” Dadurch werden die drei Eigenschaften (siehe Sutra III-13) eines Objektes voll erkannt. So wird das Objekt voll verstanden und über die Gunas auch beherrschbar. Alle Objekte sind nämlich laut Yogalehre Erscheinungsformen der drei Gunas, auch das Bewusstsein des Menschen. Der Yogi diszipliniert sein Bewusstsein und kann über bzw. in Samyama die Gunas auch außerhalb seines Bewusstseins beeinflussen oder verändern. So erklären sich gemäß Yogalehre die Siddhis.
Vibhutis, der andere Name für die Siddhis, bedeutet wörtlich weg (vi) von den Elementen (bhutas) und steht damit laut einiger Kommentatoren auch für die Abwendung von der Identifikation mit den materiellen Grundlagen unseres Lebens, yogisch: Prakriti. Hin zur Erkenntnis unserer wahren Natur: Purusha.
Die Sutras III-16 bis III-49 nennen die Objekte, auf die ein Yogi seine Samyama-Konzentration legen sollte, um besondere Kräfte zu entfalten. Iyengar betont jedoch, dass diese Siddhis sich erst bei weit fortgeschrittenen Yoga-SchülerInnen zeigen.
Ergänzend: Lange Pranayama-Praxis soll spontane Siddhis triggern können. Gerade Wechselatmung über Monate hinweg wird in manchen Berichten als „geistöffnend“ beschrieben – mit plötzlichen Hörerlebnissen oder Visionen.
Was ist Samyama?
Was ist Samyama?
Samyama besteht aus drei Stufen: Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein). Nur die erste Stufe von Samyama, die Konzentration auf ein Objekt, lässt sich willentlich steuern. Die darauf aufbauenden Geisteszustände Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) müssen sich laut der meisten Kommentatoren des Yogasutras von alleine einstellen und werden durch lang anhaltende Konzentration und Beseitigung der Geisteshindernisse erlangt. Feuerstein bezeichnet Samyama als 'Bündelung' von Konzentration, Meditation und Samadhi. Du findest Samyama ausführlicher in den ersten Sutras des dritten Kapitels des Yogasutra hier auf yoga-welten.de besprochen. Siehe vor allem:
Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt
Yoga Sutra III-5: Aus der Meisterung von Samyama entsteht vollkommenes Wissen über das Wahrgenommene
Yoga Sutra III-6: Der Fortschritt im Samyama erfolgt in Stufen
Voraussetzungen und Umgang mit den Siddhis
Empfehlungen zu Voraussetzungen und zum Umgang mit den Siddhis
Viele Kommentatoren empfehlen, mit den Siddhis sehr bewusst umzugehen. Folgendes wird oft geraten:
Wer sich den Siddhis zuwendet, sollte die Yamas und Niyamas in seinem Leben verwirklicht haben. Diese sind:
Die Yamas – Selbstkontrolle
- Ahimsa – Gewaltlosigkeit
- Satya – Wahrhaftigkeit
- Asteya – Nicht-Stehlen
- Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit
- Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier
Niyamas – Verhaltensregeln
- Saucha – Reinheit
- Santosha – Zufriedenheit
- Tapas – Selbstzucht
- Svadhyaya – Selbststudium (Studium)
- Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen
Siehe dazu die Erläuterungen in "Yamas und Niyamas im täglichen Leben".
Siddhis sollten nicht zum Vergnügen, zur Selbsterhöhung oder anderen ungünstigen, egoistischen Zielen angewendet werden. Vielmehr zeigen die Siddhis (so Iyengar und andere), dass die Yogapraxis “richtig angelegt” sei.
Selbstverständlich sollte man Siddhis auch nicht dazu nutzen, um jemand anderen damit zu schaden.
Stattdessen wird eher ein “Nicht-Beachten” der Siddhis angeraten, wenn diese sich denn zeigen sollten. Iyengar schreibt, (S. 244), die Übungen bei Auftreten der Siddhis mit Glauben und Begeisterung weiterzuentwickeln, die Siddhis aber mit völligem Gleichmut zu betrachten.
Dem Yogi wird also geraten, sich nicht auf die Siddhis einzulassen, sich nicht von ihnen “mitreissen zu lassen”, um sie nicht für eigene selbstsüchtige Bedürfnisse zu verwenden, woraus späteres Leiden folgen würde. Stattdessen solle er/sie weiter auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln und die Siddhis eher als Prüfung ansehen, ob man nicht doch noch – trotz fortgeschrittener yogischer Entwicklung - den Verlockungen der Dualität und des Ego-Daseins nachgibt.
Swami Sivananda sagt über Siddhis:
„Yoga ist nicht dazu da, Siddhis, Kräfte, zu erlangen. Wenn ein Yogaschüler die Versuchung verspürt, Siddhis zu erlangen, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er hat den Weg verloren. Ein Yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten Samadhi zu erreichen, muss Siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von Devatas. Nur wenn man diese Siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im Yoga erlangen.“
Im tibetischen Buddhismus werden vergleichbare Fähigkeiten „Shes-rab“ genannt. Auch dort: klare Intuition, inneres Sehen, spontane Einsicht – aber nie als Ziel, sondern als Prüfstein für Demut.
Missverständnisse rund um Siddhis
Die Aussicht auf übernatürliche Kräfte fasziniert viele – und genau darin sind einige häufige Missverständnisse begründet. Ein Irrglaube besteht darin, dass Yoga hauptsächlich dazu diene, solche Siddhis zu erlangen. Tatsächlich betont die Tradition jedoch, dass Siddhis eher Nebenprodukte auf dem spirituellen Weg sind, nicht sein Zweck. Patanjali selbst stellt im unmittelbar folgenden Sutra klar, dass diese Fähigkeiten für einen im Samadhi befindlichen Geist Upasarga – also Störungen oder Ablenkungen – darstellen, auch wenn sie in einem nach außen gewandten Bewusstseinszustand als außergewöhnliche Errungenschaften erscheinen mögen. Yogameister wie Vyasa und später Vivekananda haben daher immer wieder gemahnt, die Siddhis nicht zu überschätzen: Sie seien wie Blüten am Wegesrand – schön und bemerkenswert, aber man sollte nicht vom Weg abkommen, um nur noch Blumen zu pflücken.
Ein weiteres Missverständnis liegt darin, jede ungewöhnliche innere Wahrnehmung sofort für eine echte siddhische Fähigkeit zu halten. Insbesondere wenn Übende beginnen, sich intensiv mit Meditation zu beschäftigen, können imaginäre Bilder, Lichterscheinungen oder akustische Phänomene auftauchen. Die Yoga-Tradition fordert hier Viveka, das unterscheidende Erkenntnisvermögen: Handelt es sich wirklich um eine valide intuitive Einsicht (Pratibha) oder nur um eine Wunschprojektion des Geistes? Echte spirituelle Intuition wird traditionell durch bestimmte Qualitäten kenntlich gemacht – sie geht einher mit tiefer innerer Stille, Klarheit und Gewissheit, ohne Aufregung oder Ego-Stolz. Hingegen sind halluzinatorische Erlebnisse oder irrige „Eingebungen“ oft dramatisch, emotional aufgeladen oder selbstbezogen. Es ist ein bekanntes Risiko, dass ein Yogi, der sich zu früh auf Siddhis fokussiert, Opfer von Täuschungen werden kann. Beispielsweise könnte man glauben, die Gedanken anderer lesen zu können, während man in Wirklichkeit eigenen Fantasien nachhängt.
Schließlich gibt es das Missverständnis, Siddhis seien ein Zeichen von Erleuchtung oder spiritueller Vollendung. Historische Berichte zeigen jedoch, dass auch wenig ethische oder unreife Personen zeitweise paranormale Fähigkeiten aufweisen konnten – was nicht mit wahrer Heiligkeit gleichzusetzen ist. Im Yoga wird daher gelehrt, die Siddhis weder zu verteufeln noch zu vergötzen. Sie dürfen auftauchen, doch der richtige Umgang ist entscheidend: Ein reifer Yogi nimmt sie wahr, schenkt ihnen aber wenig Bedeutung und bleibt dem höheren Ziel, Kaivalya (der völligen Befreiung), verpflichtet. Missverständnisse klären sich letztlich durch Erfahrung und Anleitung: In der traditionellen Guru-Schüler-Beziehung wurden auftauchende Siddhi-Erlebnisse vertraulich besprochen, um sicherzustellen, dass der Schüler nicht in Fallen wie Egoismus oder Ablenkung tappt. So soll auch der moderne Übende verstehen, dass Wunder im Yoga-Kontext Prüfsteine der Haltung sind – sie verlangen nach noch mehr Demut, Vairagya und Konzentration auf den eigentlichen Weg.
Möchtest du bis hierhin etwas ergänzen oder korrigieren?
Möchtest du bis hierhin etwas zum Gesagten ergänzen oder etwas korrigieren?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
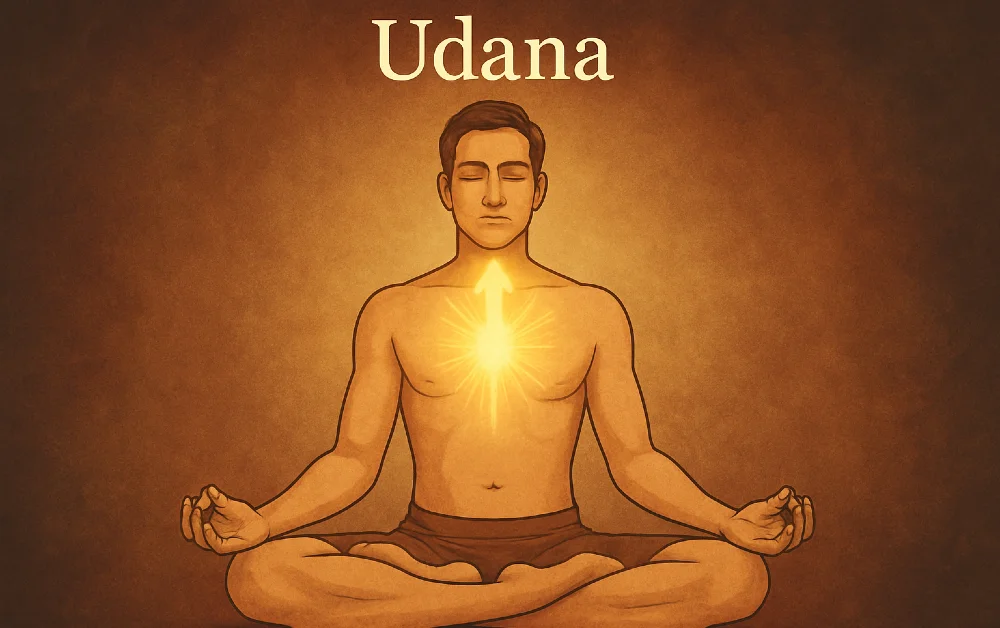
Was ist Udana?
Udana-Prana heißt wörtlich der „Aufwärts-Atem“ und ist mit der aufwärts steigenden Luft verbunden. In der yogischen Lehre werden verschiedene Atem-Energieströme, Pranas oder Vayus genannt, unterschieden. Udana ist einer der fünf Hauptpranas und stellt die Energie des Nervensystems dar. Udana steuert dadurch auch den Schlaf und den Traum und soll somit auch die Astralreise ermöglichen. Probleme mit Nervosität oder Schlafprobleme sollen gemäß dieser Lehre oft auf Udana-Störungen beruhen.
Die fünf Hauptpranas oder Vayus:
- Prana, die Energie der Atmung und des Lebenserhaltes.
- Apana, u.a. die Energie der Sexualität und der Ausscheidung
- Udhyana, die Energie der Muskeln und vom Blut-Kreislauf
- Samana, die Energie der Verdauung (siehe auch nächste Sutra III-41)
- Udana, die Energie hinter dem Nervensystem und den Hormonen
Udana Vayu ist also einer der fünf Prana Ströme. Schon früh erkannten Yogis, so Feuerstein auf Seite 376, dass der Atem bzw. die im Atem vorhandene Lebenskraft verschiedene “Aspekte” enthält, deren Meisterung ebenso unterschiedliche paranormale Kräfte zur Folge hätte. Einer dieser Aspekte ist Udana. Vyasa: „Udâna [heißt so], weil es [Körperflüssigkeiten] nach oben trägt.”
Udana soll seinen Sitz in der Kehle haben und steht damit auch für Kommunikation. Es ist ein Luftelement und wirkt auch im Kopf, in den Sinnesorganen und den Extremitäten (Skuban S. 217).

Siddhi: Utkrantih – Levitation
Utkrantih bedeutet aufsteigen, schweben, nach oben fliegen und wird gerne mit Levitation übersetzt. In der spirituellen Literatur gibt es viele Berichte über Menschen, die schweben oder über Wasser gehen können: Jesus an erster Stelle, aber auch Nagendra Nath Bhaduri (in Autobiographie eines Yogi), die Nonne Teresa von Aviala, der Philosoph Apollonius von Tyana und andere.
Zum einen wird unter Levitation das reale Abheben des Yogis vom Boden verstanden. So wie es früher in den Videos der Transzendentalen Meditation zu sehen war, auch wenn dabei vermutlich eher gehüpft wurde.
Zum anderen kann Levitation als Astralreise gedeutet werden. Den Austritt aus dem physischen Körper mit dem Astralkörper kann während des Träumens, in tiefer Meditation, in Tiefenentspannung, unter Drogeneinfluss und im Moment des Todes erfolgen.
Sukadev: „In einer typischen Yogalehreraus-bildung mit 40 Teilnehmern haben fünf bis zehn schon die Erfahrung gemacht, ihren Körper verlassen zu haben. Und wenn wir Udana meistern, können wir das bewusst machen.”
Iyengar deutet es so, dass sich der Yogi mittels der Übung (Samyama über den aufsteigenden Atem) tatsächlich so leicht mache, dass er über all diese Dinge schweben kann. Zudem, so ergänzt er, könne der Yogi Prana durch Brahmarandhra aufsteigen lassen und so in freiem Willen versterben (siehe oben bei der Übersetzung von “Roots of Yoga”: yogischer Selbstmord).
Astralprojektion lernen – Anleitung & Buch-Review | Praxis & Kritik Astralprojektion – besser als Astralreisen bekannt – ist eine Technik, die einen Teil unseres Bewusstseins auf eine Reise in die Astralwelt senden will. Ein sehr umfassendes Buch zum Thema ist „Dynamik der Astralprojektion – Praxisbuch der außerkörperlichen Erfahrung“ (im Original: „Astral Dynamics“) von Robert Bruce. Das Buch verspricht nicht weniger als einen strukturierten Zugang zur außerkörperlichen Erfahrung. Dieser Artikel ordnet das Werk systematisch ein, beleuchtet Theorie und Praxis, benennt Chancen und Grenzen – und zeigt dir, was dich erwartet, wenn du dich ernsthaft mit Astralreisen beschäftigst. Hierin findest du die Lehre von der Astralprojektion – ich habe das Buch gelesen, den Inhalt zusammengefasst und ein Fazit gezogen. ► Dimensionstheorie ► Aufspaltung des Bewusstseins ► vorbereitende Übungen ► Austrittstechniken ► Probleme bei Astralreisen ► Tipps und Tricks zur Astralprojektion Hier weiterlesen: Astralprojektion lernen – Anleitung & Buch-Review | Praxis & Kritik Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe Seit vielen Jahrtausenden finden sich Berichte von intensiv Meditierenden zu mystischen Erfahrungen. Zu geistigen Erlebnissen, die sich mit dem Verstand nicht erklären lassen. Hierzu gehört das Erlebnis von außerkörperlichen Wahrnehmungen. Schon Patanjali hat im Yoga Sutra hierfür eine Meditationsanweisung geschildert. Bonus: ► Umfragen zur Außerkörperlichen Erfahrung ► Monroe-TechnikBeitrag: Astralprojektion lernen – Anleitung & Buch-Review | Praxis & Kritik

Astralprojektion lernen – Praxisbuch der außerkörperlichen Erfahrung | Inhalt & Rezension
Beitrag: Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe

Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe

Siddhi: Unberührt von Wasser, Schmutz, Dornen etc.
Hiermit könnte gemeint sein, dass man ganz allgemein weniger von der Welt berührt wird. Dass durch die Meisterung von Udana so etwas wie ein Energiefeld entsteht, was die äußere Welt vom Yogi abschirmt.
Manche deuten den Vers so, dass der Yogi über die Fähigkeit der Levitation einfach über diese Dinge erhebt.

Traditionelle Auslegung von Yoga-Sutra III.40
In den klassischen Kommentaren wird Udāna als der aufsteigende Lebenshauch beschrieben, der vom Hals bis zum Kopf wirkt und eng mit Atmung und Sprache verbunden ist. Der altindische Gelehrte Vyāsa erklärt, Udāna bedeute wörtlich „das nach oben Tragende“ – dieser Energieaspekt trägt z.B. Nahrungssäfte nach oben und ermögliche das Aufrichten des Körpers. Beherrscht ein Yogi diesen aufsteigenden Lebensstrom, so wird sein Körper außergewöhnlich leicht.
Patanjali sagt, der Yogi komme dadurch mit Wasser, Schlamm oder Dornen nicht mehr in Berührung – er sinkt nicht ein und wird nicht verwundet. Vielmehr kann er darüber hinwegschweben bzw. sich erheben.
Einige klassische Kommentatoren verstehen das so, dass der Körper durch die Meisterung des Udāna so leicht wird, dass Wasser ihn trägt und Dornen ihn nicht durchdringen können.
Utkrānti, die zweite Fähigkeit in diesem Vers, bedeutet „Aufsteigen“ oder das Verlassen des Körpers. Traditionell wird dies als Macht verstanden, den Körper nach Wille zu verlassen – etwa im Moment des Todes bewusst aus dem Scheitel auszutreten. So schreibt ein Kommentator, die Regulierung des Udāna ermögliche es dem Yogi, am Lebensende die Lebenskraft durch das Kronenzentrum auszuleiten, was als bewusster Austritt aus dem Körper und als „sicherer Pfad“ zur Befreiung gilt.
Berichte über Yogis und Heilige, die über Wasser gingen oder schwebten, untermauern diese wörtliche Auslegung: Oft zitiert werden wie gesagt Jesus, der Philosoph Apollonius von Tyana oder die spanische Mystikerin Teresa von Ávila, denen solche Fähigkeiten zugeschrieben wurden. In der Yogatradition selbst gibt es Geschichten von Meistern wie Nagendra Nath Bhaduri (bekannt aus der „Autobiographie eines Yogi“), die angeblich levitieren konnten. Solche Erzählungen mögen die wörtliche Interpretation stützen, doch bleibt ihr Wahrheitsgehalt im Bereich des Glaubens und der Überlieferung.
Hast du schon einmal eine Außerkörperliche Erfahrung gemacht?
Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓
Die bisherigen Stimmen:
| Nein, niemals. | 84 Stimmen |
| Einmal. | 57 Stimmen |
| Hin und wieder. | 49 Stimmen |
| Ich mache häufig außerkörperliche Erfahrungen. | 14 Stimmen |

Moderne Interpretation und Bedeutungsansätze
Viele Yoga-Lehrer heute betonen neben der wortwörtlichen auch eine symbolische Deutung dieses Sutras. So können „Wasser, Schlamm und Dornen“ metaphorisch für Schwierigkeiten, Verhaftungen und Schmerzen im Leben stehen. Nicht davon berührt zu werden hieße dann, dass der Yogi durch die Meisterung von Udāna eine innere Unberührbarkeit gegenüber weltlichen Hindernissen erlangt. Er „versinkt“ nicht in Problemen und „verletzt“ sich nicht an den Unwägbarkeiten des Lebens, sondern bleibt geistig leicht und unbehaftet.
In diesem Sinne steht die Levitation hier für ein Gefühl der Erhebung und Leichtigkeit des Seins – der Yogi schwebt gleichsam über den Dingen, emotional und mental.
Einige Interpretationen sehen einen Zusammenhang mit der Entwicklung des Bewusstseins: Udāna ist im Körper dem Halszentrum (Kehlchakra) zugeordnet, welches für Ausdruckskraft und Selbstausdruck steht. Ist diese Energie harmonisch, fühlt man sich zuversichtlich, kommunikativ und „erhoben“, was es erleichtert, höhere spirituelle Ziele zu erreichen. Der Yogi, der Udāna gemeistert hat, strahlt demnach innere Leichtigkeit und Klarheit aus.
Levitation kann hier auch als eine Art außerkörperliche Erfahrung verstanden werden – in tiefer Meditation oder im Traum kann sich das Bewusstsein vom physischen Körper lösen. Tatsächlich berichten nicht wenige Praktizierende von spontanen Astralreisen oder dem Gefühl, in der Meditation zu „schweben“. Patanjali weist zwar nicht ausdrücklich darauf hin, doch moderne Lehrer erwähnen, dass diese Fähigkeit bei fortgeschrittener Praxis auftauchen kann, ohne dass man sie forciert.
Wichtig ist vielen heutigen Kommentatoren, dass man das Sutra auch als Aufforderung sehen kann, unbeschwert und frei von Anhaftung zu werden. Die Leichtigkeit wird dann weniger als physikalisches Phänomen, sondern als geistiger Zustand verstanden. Indem man Udāna kultiviert, entwickelt man Optimismus, Eloquenz und die Fähigkeit, über Alltägliches „hinauszuwachsen“. Dieses ganzheitliche Verständnis verbindet die alten Beschreibungen mit psychologischer Tiefe: Das Meistern von Udāna macht den Yogi nicht nur im Körper leicht, sondern auch im Herzen.

Praktische Ansätze zur Meisterung von Udāna
Patanjali selbst nennt keine genaue Technik, doch wird im Kontext deutlich, dass er auf Samyama – die Kombination aus Konzentration, Meditation und völliger Versenkung – auf den Udāna-Vayu abzielt. Der Yogi soll seine fokussierte Achtsamkeit immer wieder auf den aufsteigenden Atemstrom richten, bis sich eine intuitive Kontrolle einstellt. In der Praxis beginnt man jedoch mit grundlegenden Übungen, um Udāna zunächst zu harmonisieren, bevor eine vollständige Kontrolle möglich ist. Traditionelle Quellen und moderne Yogalehrer empfehlen dafür mehrere Ansätze:
Stimme und Stille
Weil Udāna eng mit Kommunikation und dem Kehlzentrum verknüpft ist, kann bewusster Umgang mit der Sprache diese Energie ausgleichen. Phasenweise Schweigen (Mauna) – etwa im Rahmen von Meditationstagen oder jeden Tag ein paar Stunden – hilft, die Energie zu sammeln und nach innen zu richten. Diese Stille-Übung zentriert den Geist und beruhigt den aufsteigenden Atem.
Ebenso wichtig ist achtsames Sprechen im Alltag: Der Yogi übt, nur das auszusprechen, was wahr, freundlich und wesentlich ist (eine Anlehnung an die „drei Siebe“ des Sokrates). Indem man Klatsch, Lügen oder unnötige Worte meidet, bleibt die Udāna-Energie rein und ungestört.
In der Bhagavad Ghita (ca. 500 – 200 v. Chr.) heißt es bei den Tapas: Beitrag: Die Geschichte der drei Siebe

Die Geschichte der drei Siebe
Zusätzlich kann bewusste Stimmarbeit Udāna stärken. Insbesondere das Chanten oder Singen gilt als wirkungsvolle Methode, um das Kehlchakra zu aktivieren. Das Rezitieren von Mantras – sei es die Silbe OM oder andere heilige Klänge – lässt Vibrationen im Halsraum entstehen, die den aufsteigenden Strom stimulieren. Auch einfaches Tönen und Summen (z.B. in Form der Bhramari-Atemübung, bei der wie eine Biene gesummt wird) kann helfen, Blockaden im Hals zu lösen und ein Gefühl von Aufsteigen zu erzeugen.
Während man singt oder tönt, kann man die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie die Energie vom Herzraum aufwärts durch den Hals strömt und nach oben ausstrahlt. Diese Übungen fördern sowohl die körperliche Schwingung in der Kehle als auch das subtile Empfinden von Leichtigkeit und Aufrichtung.
Atemübungen (Prāṇāyāma)
Spezielle Atemtechniken können Udāna direkt ansprechen. Eine häufig empfohlene Übung ist der Ujjayi-Atem, bei dem man mit leicht verengter Stimmritze ein sanftes Rauschen im Hals erzeugt. Dieser „siegreiche Atem“ lenkt die Lebensenergie bewusst durch den Halsraum und nach oben.
Man sitzt für Ujjayi in Padmasana- (Lotussitz) oder Siddhasana-Stellung (eine andere Stellung mit gekreuzten Beinen), schließt den Mund, atmet langsam durch beide Nasenlöcher gleichmäßig fließend, bis die Lunge gefüllt ist. Während des Einatmens entsteht ein sanfter, gleichmäßiger Ton (durch leichtes zusammenpressen der Stimmritzen, eher leise).Beitrag: Ujjayi (Anleitung, Video)
Fortgeschrittene Praktizierende integrieren auch Bandhas (Energieverschlüsse): Zum Beispiel der Jalandhara Bandha (Halsverschluss), bei dem man das Kinn zur Brust senkt, dichtet den Energiefluss nach oben kurzzeitig ab und reguliert so den Udāna-Strom.
Jalandhara Bandha (englisch: Chin Lock) ist der Kinnverschluss. Hier findest du. Üungsanleitungen dazu, Wirkungen, zugehörige Verse aus der Pradipika und Videos.Beitrag: Jalandhara Bandha
In Kombination mit Kumbhaka (Atemanhaltephasen) kann man dadurch lernen, die Energie bewusster zu steuern.
Eine weitere Technik ist Khechari Mudrā, das Zurückrollen der Zunge an den weichen Gaumen – eine Übung aus dem Tantra/Hatha-Yoga, die die aufsteigende Energie fördern soll.
Entdecke die Geheimnisse und die transformative Kraft des Khechari Mudra, einer der geheimnisvollen Praktiken im Yoga. Diese Technik, die über Jahrhunderte hinweg verfeinert wurde, soll nicht nur bemerkenswerte gesundheitliche und psychologische Vorteile bieten, sondern auch als Schlüssel zu erweiterten Bewusstseinszuständen und spiritueller Entwicklung dienen. In diesem umfassenden Leitfaden erfährst du, wie du Khechari Mudra sicher und effektiv praktizieren kannst, welche potenziellen Risiken es gibt und wie es sich von anderen Mudras unterscheidet.Beitrag: Khechari Mudra Praxis

Khechari Mudra Praxis: Leitfaden zur Ausführung und Vorsichtsmaßnahmen
Auch Kapālabhāti (Schnellatmung) und Bhastrikā (Blasebalg-Atem) werden manchmal erwähnt, da sie die aufsteigende Energie wecken können; allerdings ist hier Vorsicht geboten und eine gute Vorbereitung notwendig, da diese Techniken sehr kraftvoll sind.
Kapalabhati als Lungenreinigung und als Stirnhöhlenreinigung Zunächst die Verse aus der Hatha Yoga Pradipika zu Kapalabhati, wo diese Reinigungstechnik als schnelles Pranayama beschrieben wird: 02-35 Wie der Blasebalg bei einem Hufschmied atmet der Yogi sehr schnell ein und aus. Kapalabhati verscheucht die Trägheit (Störungen des Schleims) eines Menschen vollkommen. Ausführungen zur Ausübung: Hier weiterlesen: Kapalabhati als Lungenreinigung und als Stirnhöhlenreinigung Bhastrika (Blasebalg) Pranayama Bhastrika oder auch Blasebalg ist eine Pranayama-Atemübung zur Erweckung von Energie. Die Luft wird fünf bis zehn Mal forciert ein- und ausgeatmet. Danach atmest du so tief wie möglich ein und hältst den Atem so lange an, wie es bequem geht. Atme dann tief aus. Dies ist eine Runde Bhastrika (Bastrika). Im Artikel findest du mehrere Bhastrika-Videoanleitungen.Beitrag: Kapalabhati als Lungenreinigung und als Stirnhöhlenreinigung
Kapalabhati – als Lungenreinigung
Beitrag: Bhastrika (Blasebalg) Pranayama
Körperhaltungen und Bewegungen
Bestimmte Āsanas (Körperübungen) unterstützen den aufsteigenden Fluss des Prana und damit Udāna. Besonders Umkehrhaltungen (Inversionen) haben sich bewährt, da sie den Körper wortwörtlich auf den Kopf stellen und die Energie nach oben leiten. Schon einfachere Haltungen wie Setu Bandha Sarvāṅgāsana (die Schulterbrücke) oder die Stellung „Beine hoch an der Wand“ fördern den venösen Rückfluss und lassen Energie kopfwärts fließen.
Klassische Übungen wie Sarvāṅgāsana (Schulterstand) und Halasana (Pflug) stimulieren intensiv den Halsbereich und die Schilddrüse, was mit Udāna in Verbindung steht.
Für Fortgeschrittene kommen auch Śīrṣāsana (Kopfstand) oder Handstandvariationen in Frage, jedoch sollten diese nur mit ausreichend Vorbereitung praktiziert werden.
Wichtig ist bei all diesen Übungen, die Aufmerksamkeit bewusst auf das Aufsteigen zu richten: Man stellt sich vor, wie mit jeder Einatmung Energie vom Bauch oder Becken nach oben gezogen wird – zur Brust, zur Kehle und bis in den Scheitel. Beim Ausatmen hält man dieses Empfinden von Leichtigkeit im Körper aufrecht.
Zusätzlich können ausgleichende Haltungen wie Matsyāsana (der Fisch) als Gegenstellung zum Schulterstand den Hals energetisch öffnen. Solche Asanas wirken direkt auf die Region, in der Udāna vorrangig fließt, und können helfen, etwaige Blockaden zu lösen.
Schon kurze Umkehrhaltungen am Ende einer Yogastunde – beispielsweise einige Atemzüge in der Schulterbrücke oder im unterstützten Schulterstand – können spürbar machen, wie der Geist ruhiger und „leichter“ wird.
Entspannung und Schlaf
Udāna beeinflusst auch den Schlaf und Traumzustand. Daher trägt ausreichend Tiefenentspannung zur Harmonisierung bei. Übungen wie Yoga-Nidra (Yogischer Schlaf) oder geführte Entspannungen vor dem Zubettgehen beruhigen das Nervensystem und balancieren die aufsteigende Energie im Oberkörper.
Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf & Sankalpa erklärt Willkommen zu der Entspannungstechnik des Yogas: Yoga Nidra. Die yogische Tiefenentspannung, auch "yogischer Schlaf" genannt, ist eine Tiefenentspannungsübung der tantrischen Yoga-Lehre. Die heute verbreitete Form von Yoga Nidra wurde im 20. Jahrhundert entwickelt und basiert auf älteren tantrischen Techniken wie Nyasa, die in der indischen Tradition seit Jahrhunderten überliefert sind. Yoga Nidra führt in tiefe Entspannungszustände, die mit einiger Übung bei vollem Bewusstsein erfahren werden können. Zusätzlich besteht über einen sogenannten Sankalpa die Möglichkeit, Persönlichkeitsentwicklung tief ins Unbewusste einzuprägen. Hier findest du Yoga Nidra erläutert und dazu eine einfache Anleitung, einen Gratis-MP3-Download, den Text zum Ausdrucken und viele Varianten für fortgeschrittenes Üben, auch als Videos. ► Mit Sankalpa-Generator Hier weiterlesen: Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf & Sankalpa erklärt Die MP3-Entspannungsanleitung beinhaltet:Beitrag: Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf & Sankalpa erklärt
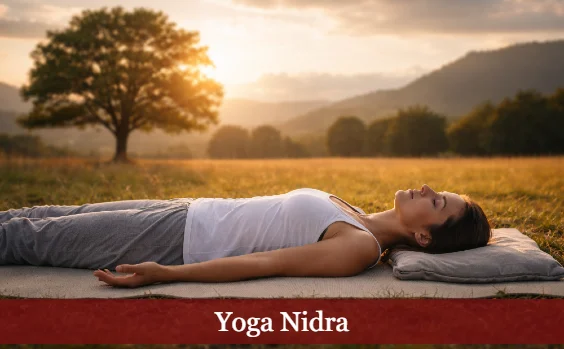
Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf und Sankalpa erklärt
Beitrag: MP3 Entspannungsanleitung
Gratis MP3-Entspannungsanleitung für eine intensive Entspannungserfahrung

Ein einfacher Tipp ist, abends einige Minuten ruhig auf dem Rücken zu liegen und den Atem in den Halsraum fließen zu spüren. Diese Ruheübung kann helfen, etwaige Unruhen (ein Zeichen von Udāna-Imbalance) zu lösen, sodass man besser schläft.
Wenn Udāna nämlich aus dem Gleichgewicht ist, klagen Menschen manchmal über Schlafstörungen, wirre Träume oder innere Nervosität. Durch regelmäßige Entspannung und Achtsamkeit auf den Atem im oberen Brust- und Halsbereich lässt sich dies mildern.
Am Morgen kann man vor dem Aufstehen kurz die Empfindung von Leichtigkeit und Auftrieb wachrufen: tief einatmen, den Kopf sanft anheben und sich vorstellen, der Körper werde von einer inneren Kraft nach oben gezogen. Solche kleinen Visualisierungen stimmen Udāna positiv und können den Tag über zu mehr geistiger Frische beitragen.

Samyama auf Udāna
Für erfahrene Meditierende beschreibt Patanjali letztlich die Technik der Vertiefung auf den aufsteigenden Atem selbst. Das heißt, nach Vorbereitung durch Atemübungen oder Asanas kann man in der Stille sitzen und die Wahrnehmung vollständig auf den feinstofflichen Strom im Körper richten, der vom Nabel oder Herz Richtung Kopf zieht. Man könnte sich z.B. auf die Empfindung konzentrieren, die beim Atemheben entlang der Wirbelsäule spürbar ist. In tiefer Konzentration verschmilzt diese Wahrnehmung zur Meditation, und idealerweise geht sie in Samādhi – vollkommene Vertiefung – über. Patanjali verspricht, dass durch diese vollkommene Einswerdung mit Udāna die beschriebenen Siddhis (Fähigkeiten) spontan eintreten.
Auch wenn moderne Yogis nicht zwingend auf Wunderkräfte aus sind, kann diese Übung zu intensiven Gefühlen von Leichtigkeit, Losgelöstheit und Transzendenz führen. Einige Praktizierende berichten z.B. von einem Schwebegefühl oder dem Eindruck, außerhalb des eigenen physischen Körpers zu sein, wenn die Meditation sehr tief wird. Selbst ohne solche spektakulären Erlebnisse fördert die Samyama-Praxis auf Udāna ein enormes Gleichgewichtsgefühl: Man bleibt auch im Alltag „über den Dingen“, lässt sich weniger von Kleinigkeiten herunterziehen und verspürt eine innere Aufrichtung.
Ein mögliches Vorgehen könnte so aussehen:
- Setz dich aufrecht und entspannt hin
Ob auf dem Boden, auf einem Kissen oder Stuhl – Hauptsache du sitzt stabil, aber locker. Stell dir vor, dein Körper ist eine Hülle, durch die gleich Licht nach oben fließen wird. - Komm über den Atem in deinen Körper
Spür einfach, wie du ein- und ausatmest, ohne etwas zu verändern. Nimm bewusst den Bereich deiner Brust und Kehle wahr. - Lenke die Konzentration auf den Atem im Hals
Beginne, leise Ujjayi zu atmen – das ist dieser Atem mit einem leichten Rauschen im Hals, wie ein sanftes Meeresrauschen. Das hilft dir, den Fluss von Udāna zu spüren. - Visualisiere aufsteigende Energie
Stell dir vor, mit jeder Einatmung steigt ein Lichtstrahl durch deine Wirbelsäule nach oben, vom Herzen durch den Hals bis zur Stirn oder Scheitel. Mit der Ausatmung bleibt das Licht wie ein Glühen in dir. Das ist der Moment, in dem Konzentration zur Meditation wird. - Bleib drin – nichts machen, nur da sein
Wenn du spürst, dass dein Geist ruhig wird, gib dich einfach diesem Aufsteigen hin. Es muss sich nicht spektakulär anfühlen – eher subtil, wie ein inneres Schweben oder ein helles Gefühl hinter den Augen. - Abschluss: OM oder Summen
Zum Schluss kannst du ein paar Mal „OM“ tönen oder summen – spür dabei die Vibration im Halsraum. Das erdet und aktiviert Udāna nochmal auf klanglicher Ebene.
Voraussetzungen und Vorbereitungen für Samyama und Siddhis
Voraussetzungen für Samyama und Siddhis
Um Samyama – die kombinierte Praxis von Konzentration, Meditation und Versenkung – erfolgreich üben zu können, müssen bestimmte psychologische und spirituelle Voraussetzungen erfüllt sein. Einig sind sich die traditionellen wie modernen Lehrer, dass der Geist des Übenden ausreichend gereinigt und gesammelt sein muss. Das bedeutet: innere Stabilität, relative Gedankenstille und Freiheit von starken emotionalen Aufwallungen als Grundlage. Es bedarf eines Maßes an Konzentrationskraft, Achtsamkeit und Gelassenheit gegenüber Sinnesreizen, damit die Aufmerksamkeit vollständig nach innen gelenkt werden kann. Besonders hervorgehoben wird die Haltung der Nicht-Verhaftung (Vairagya): Der Yogi soll nicht mehr an gewöhnlichen Sinnesfreuden oder Erfolgserlebnissen hängen, sondern eine innere Unabhängigkeit davon kultiviert haben.
Darüber hinaus betont der yogische Weg, dass die grundlegenden Stufen des Achtgliedrigen Pfades gefestigt sein sollen, bevor man sich höheren Techniken wie Samyama widmet. Konkret bedeutet dies: Yama und Niyama – die ethischen Prinzipien und Selbstdisziplinen – sollten im Leben des Übenden verankert sein, um mentale Unruhe und konflikthafte Begierden zu minimieren. Die Praxis von Asana (Körperübungen) und Pranayama (Atemlenkung) baut Spannungen und Rastlosigkeit ab und stabilisiert Körper und Nerven, was indirekt dem Geist zugutekommt. Pratyahara, das systematische Zurückziehen der Sinne, ist ebenfalls eine entscheidende Vorstufe: Erst wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr unwillkürlich von äußeren Eindrücken gesteuert wird, kann echte Konzentration nach innen entstehen. Diese Vorarbeiten schaffen den Nährboden, auf dem Samyama gedeihen kann. Ein Yogi, der Schritt für Schritt diesen Pfad gegangen ist, entwickelt die geistige Stärke und Reinheit, die nötig sind, um tiefe Versenkung zu erreichen – und in deren Folge können Siddhis überhaupt erst auftauchen.
Die Rolle von Entsagung und Ethik (Vairagya, Yama, Niyama)
Entsagung/Nichtanhaftung im Yoga, auf Sanskrit Vairagya, und die ethischen Richtlinien Yama und Niyama gehören zu den fundamentalsten Anforderungen, insbesondere wenn es um den Umgang mit Siddhis geht. Vairagya bedeutet ein inneres Losgelöstsein: der Übende übt sich darin, Verlangen und Anhaftungen aufzugeben – seien es sinnliche Genüsse, materielle Güter oder auch das Streben nach außergewöhnlichen Fähigkeiten. So kann der Yogi in die Tiefe von Samyama gelangen.
Die Geisteshaltung von Vairagya ist auch hilfreich dabei, dass aufkommende Siddhis den Yogi nicht verführen. Nur wer in Gleichmut gegenüber allen Phänomenen bleibt, kann übernatürliche Wahrnehmungen haben, ohne vom eigentlichen Pfad abzukommen. Patanjali nennt Vairagya nicht umsonst bereits im ersten Kapitel als Schlüssel zur geistigen Stille: Das fortwährende Loslassen verhindert, dass der Geist neue Wellen von Begierde und Ego-Stolz bildet.
Ergänzend dazu bilden Yama und Niyama das moralische Fundament. Die fünf Yamas – etwa Gewaltlosigkeit (Ahimsa), Wahrhaftigkeit (Satya) oder Nicht-Gier (Aparigraha) – und die fünf Niyamas – etwa Reinheit (Shaucha) und Selbststudium (Svadhyaya) – sorgen dafür, dass der Charakter und Lebenswandel des Yogis ethisch ausgerichtet sind. Warum ist das so wichtig in Bezug auf Siddhis? Zum einen reinigt moralisches Verhalten das Herz und mindert egoistische Tendenzen, was die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch oder falscher Identifikation mit Kräften reduziert. Zum anderen stabilisieren Yama und Niyama den Geist: Ein Gewissen, das frei von Schuld und Zwiespalt ist, kommt leichter zur Ruhe. Traditionell heißt es, dass Siddhis nur einem Yogi dauerhaft und gefahrlos zufallen, der Tugend und Selbstbeherrschung verkörpert. Andernfalls können Machtgefühle, Hochmut oder unethische Versuchungen die Folge sein. Daher lehren die Yogameister, dass jede Erweiterung der Fähigkeiten mit entsprechender Demut und Verantwortungsbewusstsein einhergehen muss – Qualitäten, die durch die Befolgung von Yama und Niyama kultiviert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Vairagya und die ethische Praxis sind Förderer und Schutzmechanismus auf dem Weg zur höheren Erkenntnis. Sie erleichtern das Eindringen in lang anhaltende innere Stille bei voller Bewusstheit und bewahren den Übenden davor, die Richtung zu verlieren, wenn Siddhis auftauchen. Ein Yogi, der Entsagung übt und ethisch gefestigt ist, wird die verfeinerten Sinneswahrnehmungen zwar registrieren, aber weder missbrauchen noch für wichtiger halten als das letztendliche Ziel – die Erkenntnis des wahren Selbst (Purusha) und die Befreiung.
Vorbereitende Techniken für Samyama und verfeinerte Wahrnehmung
Um den Geist auf Samyama und mögliche subtile Wahrnehmungen vorzubereiten, empfehlen Yogalehrer seit jeher verschiedene unterstützende Techniken. Insbesondere folgende Ansätze haben sich als hilfreich erwiesen:
- Yama und Niyama hatten wir schon, empfohlen wird auch eine stabile und bequeme Sitzhaltung (Asana).
- Pratyahara (Zurückziehen der Sinne): In dieser fünften Stufe des Raja Yoga lernt der Übende, die Aufmerksamkeit von äußeren Sinnesobjekten abzuziehen. Praktisch wird Pratyahara z.B. geübt, indem man sich in Entspannung auf innere Wahrnehmungen konzentriert und äußere Reize ausblendet – etwa durch Augen schließen, in Stille sitzen oder Visualisierungen. Dadurch werden die Sinne „nach innen gezogen“. Ein trainiertes Pratyahara ist die Voraussetzung dafür, dass in Samyama die verfeinerten, inneren Sinneswahrnehmungen auftauchen können. Erst wenn die gewöhnlichen Sinnesreize an Macht verlieren, entsteht Raum für das subtile innere Hören, Sehen etc.
- Pranayama (Atemkontrolle): Gezielte Atemübungen beruhigen das Nervensystem und sammeln den Geist. Durch Regulierung (Patanjali nennt Verlängerung und Verfeinerung) des Atems – etwa mittels tiefer Bauchatmung, Wechselatmung (Nadi Shodhana) oder einfach nur der Verlängerung der Ausatmung – wird der Geist fokussiert und der Energiefluss harmonisiert. Patanjali selbst führt Pranayama als wichtige Vorstufe zu Dharana (Konzentration) an. Ein gleichmäßiger, feiner Atem fördert eine introvertierte Aufmerksamkeit und kann latente Energien (Prana) wecken. Insbesondere fortgeschrittene Pranayamas, die mit Konzentration auf Energiezentren (Chakras) verbunden sind, schulen die Wahrnehmung des inneren Raums. Dadurch wird der Yogi empfänglicher für subtile Empfindungen – eine essenzielle Vorbereitung, um in tiefere Meditation vorzudringen, wo sich Siddhis zeigen könnten.
- Optional: Yoga Nidra (Yogischer Tiefenentspannungszustand): Yoga Nidra ist eine geführte Meditation, die den Körper in vollständige Entspannung versetzt, während der Geist hellwach bleibt. In diesem Schwebezustand zwischen Wachen und Schlaf treten Gehirnwellen auf, die für Aufnahmefähigkeit und Intuition förderlich sind. Die Praxis von Yoga Nidra hilft, unbewusste Verspannungen und mentale Blockaden abzubauen. Sie schult außerdem die Fähigkeit, bewusst ins Unterbewusstsein hineinzulauschen, ohne einzuschlafen. Diese Fertigkeit – entspannt und zugleich aufmerksam nach innen zu schauen – ist eine direkte Vorbereitung auf Samyama. Ein Yogi, der Yoga Nidra meistert, kann seine Aufmerksamkeit lange nach innen richten, was die Kontinuität von Dharana/Dhyana fördert. Zugleich fördert Yoga Nidra einen Zeuge-Geist („Sakshi-Bhava“), der Phänomene beobachten kann, ohne sich damit zu identifizieren – hilfreich, um etwaige Siddhi-Erfahrungen nüchtern zu betrachten. Hier findest du die konkrete Übungsanleitung.
- Optional: Japa (Mantra-Wiederholung): Die Rezitation oder mentale Wiederholung eines Mantras gilt als eine der wirkungsvollsten Konzentrationshilfen. Durch Japa wird der rastlose Geist schrittweise beruhigt und auf einen Klang oder eine heilige Silbe ausgerichtet. Das kontinuierliche Wiederholen – ob laut, leise oder innerlich – bündelt die Gedankenströme und führt zu tiefer Meditation. In vielen Yoga-Traditionen heißt es, ein Mantra reinige den Geist und öffne das Herz. Praktisch bewirkt Japa, dass störende Gedanken in den Hintergrund treten und eine spirituelle Schwingung den Vordergrund einnimmt. Dies bereitet auf Samyama vor, indem das Mantra wie ein Anker für Dharana dient und nahtlos in Dhyana übergehen kann. Zudem kann intensives Mantra-Japa dazu führen, dass der Übende das Mantra schließlich innerlich „hört“, ohne aktives Tun – eine Form von subtiler Wahrnehmung, die als Siddhi betrachtet werden könnte (z.B. Nada-Anubhava, das innere Klang-Erlebnis). Selbst wenn solche Phänomene nicht explizit gesucht werden, stärkt Japa in jedem Fall die Konzentration, Hingabe und Vairagya. Diese Qualitäten schützen und begleiten den Yogi, falls sich verfeinerte Sinneswahrnehmungen einstellen.
Zusammengefasst dienen Pratyahara, Pranayama, Yoga Nidra und Japa als (nicht unbedingt notwendige aber) hilfreiche Bausteine in der Vorbereitung auf Samyama. Sie entwickeln die nötige geistige Disziplin, Sammlung und Reinheit, um die im Yoga-Sutra beschriebenen Fähigkeiten zu ermöglichen (garantieren aber deren Auftreten nicht). Gleichzeitig fördern sie die Haltung von Losgelöstheit und innerer Ruhe, sodass der Yogi bereit ist, Siddhis weder zu erzwingen noch zu fürchten, sondern sie im richtigen Geist zu integrieren. Jede dieser Techniken ist für sich schon eine wertvolle Übung; im Zusammenspiel ebnen sie den Weg zu den tieferen Erfahrungen des Yoga – bis hin zur Pratibha, dem aufblitzenden inneren Wissen, und darüber hinaus zum endgültigen Ziel des Yoga, der Verwirklichung des Selbst.
🌀 Samyama-Reife-Check
Samyama – die Kombination aus Konzentration, Meditation und tiefer Versenkung – ist eine hochentwickelte Praxis im Yoga. Doch ist sie für jeden und zu jeder Zeit sinnvoll? Mit diesem kurzen Selbsttest kannst du einschätzen, ob dein Geist bereit ist, sich auf diese subtile Form des inneren Forschens einzulassen.
So geht's: Beantworte die Fragen ehrlich und spontan. Am Ende erhältst du eine Einschätzung und eine Empfehlung für deinen nächsten Schritt.
Zeitleiste: Pfad zu Samyama und den Siddhis
Diese Zeitleiste zeigt dir die Stufen des Yogawegs, die nötig sind, um in den Zustand von Samyama zu kommen – und wie daraus Siddhis (verfeinerte Sinneswahrnehmungen) spontan entstehen können.
🪷 Yama & Niyama
Ethische Grundlagen & Selbstdisziplin: z. B. Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sie bereiten deinen Geist auf Tiefe und Klarheit vor.
🧘 Asana
Stabiler, bequemer Sitz. Der Körper wird still, der Atem ruhig – beides ist nötig für längere innere Versenkung.
🌬️ Pranayama
Atemkontrolle als Brücke zur inneren Wahrnehmung, Pantanjali empfiehlt, Ausatmung und Einatmung und Anhalten zu verlängern und zu verfeinern. Dieses Pranayama beruhigt das Nervensystem und bereitet den Geist auf Fokus vor.
👁️ Pratyahara
Zurückziehen der Sinne. Der Blick geht nach innen. Die Außenwelt verliert an Bedeutung. Jetzt beginnt echte Sammlung.
🎯 Dharana
Konzentration auf ein Objekt (z. B. Licht, Atem, Mantra). Der Geist bleibt bei einem Punkt – erste Form von Meditation.
🧘♀️ Dhyana
Meditation. Der Fokus wird fließend, mühelos. Es gibt keine Unterbrechungen mehr – reines Verweilen im Beobachteten.
🌌 Samadhi
Verschmelzen mit dem Objekt. Kein „Ich meditiere“ mehr – nur noch reines Sein. Dies ist der Eingang in tiefe Einsicht.
✨ Übergang zu Samyama
Wenn Dharana, Dhyana und Samadhi auf dasselbe Objekt gerichtet sind – ohne Unterbrechung –, kann daraus Samyama entstehen. Dann ist der Geist hochfokussiert, durchlässig und empfänglich für tiefe, intuitive Erkenntnis.
🌟 Was entsteht daraus?
Spontan kann es geschehen, dass sich ein Siddhi zeigt, du z. B. feiner hörst, spürst, siehst – nicht mit den Sinnen, sondern von innen heraus. Denke immer daran: Siddhis sind kein Ziel, aber ein möglicher Meilenstein auf deinem Weg.

Die fünf Hauptkräfte des Lebens (Prāṇa-Vayus) nach Vyāsa
Erläuterungen zu Vyasa
Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.
Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.
Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.
Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.
Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.
Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".
Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.
In seinem Kommentar zum Yoga-Sutra beschreibt Vyāsa das Leben als ein Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung und Bewegung – getragen durch die fünf Vitalenergien oder Lebenswinde (Vāyus). Diese Vayus sind Ausdruck des Prāṇa, der grundlegenden Lebensenergie im Menschen.
Jede dieser Energien hat eine bestimmte Richtung, Funktion und Wirkungsregion im Körper. Sie ermöglichen nicht nur physiologische Vorgänge wie Atmung und Verdauung, sondern auch subtile Prozesse wie Wahrnehmung, Ausdruck oder spirituelles Wachstum. Oben haben wir die fünf schon einmal aufgelistet, hier gehen wir nun näher auf jeden Vayu ein:
🔹 1. Prāṇa-Vāyu – die empfangende und versorgende Kraft
- Wirkungsbereich: vom Mund und der Nase bis zum Herzen
- Funktion: Prāṇa ist die Energie, die durch Einatmung aufgenommen wird und den Körper mit Lebensenergie versorgt.
- Besonderheit: Sie steuert insbesondere Atmung, Herzschlag und die Aufnahme von Eindrücken (nicht nur physisch, auch geistig).
- Anmerkung: Prāṇa ist nach Vyāsa die zentrale Kraft unter allen Vayus – sie „führt“ sozusagen die anderen an.
🔹 2. Samāna-Vāyu – die ausgleichende und verteilende Kraft
- Wirkungsbereich: im Bereich des Bauchnabels
- Funktion: Samāna sorgt für die gleichmäßige Verteilung der aufgenommenen Nahrung und Energie im Körper.
- Bedeutung: Sie verbindet Ein- und Ausatmung, aktiviert die Verdauung und trägt zur körperlichen Mitte bei.
- Übersetzung des Begriffs: „Samāna“ bedeutet „ausgleichend“ oder „gleichmachend“, da diese Energie alle Körperbereiche gleichmäßig versorgt.
🔹 3. Apāna-Vāyu – die ausscheidende und erdende Kraft
- Wirkungsbereich: Unterbauch bis zu den Füßen
- Funktion: Apāna ist für alle Prozesse zuständig, bei denen etwas aus dem Körper hinausgeführt wird: Ausscheidung, Menstruation, Ejakulation, Gebären.
- Symbolik: Apāna steht für Loslassen, Erdung und Stabilität.
- Etymologie: „Apāna“ kommt von apa, was „weg“ oder „hinaus“ bedeutet – also das, was nach unten abgeleitet wird.
🔹 4. Udāna-Vāyu – die aufsteigende, klärende Kraft
- Wirkungsbereich: vom Hals bis zum Kopf
- Funktion: Udāna trägt Energie nach oben – etwa beim Sprechen, Singen, Denken, Träumen oder beim Aufrichten des Körpers.
- Spirituelle Relevanz: Udāna spielt eine zentrale Rolle beim Bewusstseinsanstieg, bei der Meditation und möglicherweise auch beim Verlassen des Körpers im Moment des Todes (wie im Yoga-Sutra III.40 angedeutet).
- Bildlich: Man kann sich Udāna wie eine Aufwärtsströmung vorstellen, die dir hilft, „über dich hinauszuwachsen“.
🔹 5. Vyāna-Vāyu – die verbindende und durchdringende Kraft
- Wirkungsbereich: im gesamten Körper, in alle Richtungen
- Funktion: Vyāna ist zuständig für Bewegung, Koordination und Zirkulation – sowohl im Blutkreislauf als auch in der Nervenaktivität.
- Besonderheit: Diese Energie durchdringt alles – sie verbindet die vier anderen Vayus und hält das ganze Energiesystem zusammen.
- Bedeutung von „Vyāna“: „ausbreitend“, „umfassend“ – also die Energie, die alles im Gleichgewicht hält.
🧭 Ergänzende Hinweise zur Bedeutung
Vyāsa macht deutlich, dass diese fünf Energien nicht voneinander getrennt sind. Sie wirken zusammen wie ein feines Netz, das den gesamten Körper – und darüber hinaus auch Geist und Bewusstsein – lebendig macht.
Er hebt hervor, dass Prāṇa selbst der Wichtigste unter diesen ist. Alle anderen Ströme leiten sich von ihm ab oder stehen mit ihm in Wechselwirkung. In der Yogapraxis (etwa im Prāṇāyāma) geht es deshalb oft darum, alle fünf zu harmonisieren, wobei das Bewusstsein auf einzelne gezielt gelenkt werden kann – z. B. auf Udāna für Klarheit und innere Aufrichtung.
Grafik: Die fünf Prana-Vayus im Körper
Diese interaktive Grafik zeigt die fünf Prana-Vayus als Energiezonen im menschlichen Körper. Wenn man mit der Maus über einzelne Zonen fährt oder klickt (mobil), erscheinen Name, Funktion, Störungen und passende Yogaübungen zur Harmonisierung. Das hilft Lesern, besonders visuell Lernenden, die Rolle von Udana besser im Zusammenhang zu verstehen.
🌀 Die fünf Prāṇa-Vayus im Körper
Fahre mit der Maus über die Körperbereiche oder tippe sie an, um mehr zu erfahren.

💡 Fazit
Was auf den ersten Blick wie ein energetisch-spirituelles System klingt, beschreibt letztlich ganz konkrete Lebensfunktionen – körperlich wie geistig. Wer sich mit den fünf Vayus beschäftigt, bekommt nicht nur ein tiefes Verständnis für die eigene Lebenskraft, sondern auch einen feinen Kompass für die eigene Praxis: Wo fühle ich mich „unten fest“? Wie gut kann ich „loslassen“? Was muss „aufsteigen“?
Vyāsas Beschreibung ist also mehr als eine Theorie – sie ist eine Einladung zur inneren Erforschung.

Abschließende Gedanken
Yoga-Sutra III.40 bietet also mehrere Deutungsebenen. Historisch betrachtet zeigt es die Überzeugung, dass Meisterschaft über die Lebensenergien zu übernatürlichen Kräften führen kann. Heutige Lehrer betonen jedoch oft die innere Bedeutung: Die eigentliche Meisterung des Udāna spiegelt sich in Gelassenheit, geistiger Höhe und einer starken Verbindung zur eigenen höheren Natur wider.
Wichtig ist auch, dass Patanjali in seinem Werk an anderer Stelle warnt, man solle sich von solchen Kräften nicht ablenken lassen. Die Siddhis werden als Nebenprodukte der Yogapraxis angesehen, die zwar auftreten können, aber Hindernisse auf dem Weg zur endgültigen Befreiung sein mögen, wenn man an ihnen haftet. Ein Yogi soll letztlich Nicht-Anhaftung entwickeln – sogar an wundersamen Fähigkeiten. Die Fähigkeit, „nicht von Wasser, Schlamm und Dornen berührt“ zu werden, lässt sich daher auch als Zustand völliger Unabhängigkeit vom Weltlichen verstehen.
Patanjali zeigt mit diesem Sutra einen Weg auf, wie fortgeschrittene Kontrolle über die Vitalenergie zu außergewöhnlicher Leichtigkeit führen kann – ob man dies nun wörtlich als Levitation oder innerlich als Überwindung aller Hindernisse interpretiert. Beide Sichtweisen inspirieren den Übenden, tiefer in die Geheimnisse der Prana-Kraft einzutauchen und letztlich die Grenze zwischen dem Möglichen und Unmöglichen neu zu definieren.
Übungsvorschlag zu Sutra III-40
Beginne mit einigen Minuten Ujjayi-Atmung, Anleitung siehe oben.
Stell dir jetzt vor, dass du bei jeder Einatmung einen Lichtstrom von deinem Herzen nach oben lenkst.
Der Atem steigt auf – durch den Hals – bis in den Kopf.
Mit der Ausatmung bleibt dieses Licht dort. Es wird nicht weniger – es breitet sich aus.
Einatmung: Aufsteigen.
Ausatmung: Weite.
Mach das ganz für dich. Ruhig, gleichmäßig.
…
Mit jedem Atemzug wirst du innerlich leichter.
Wie von innen her aufgerichtet – getragen.
Spür die Qualität von Klarheit und Helligkeit im Kopfbereich.
Bleibe noch einen Moment ganz in diesem Gefühl.
Udāna – das Aufsteigen deiner Energie.
Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung
... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Siehe auch folgende Sutras
Yoga Sutra III-41: Durch Beherrschung von Samana (verbindender Atem/Prana) erlangt der Yogi inneres Feuer
Yoga Sutra III-42: Samyama auf die Beziehung zwischen Hören und Raum führt zu gottgleichem Hören
Yoga Sutra III-43: Samyama auf die Verbindung von Raum (Akasha) und Körper und der Vorstellung, leicht wie Baumwolle zu sein, führt zur Fähigkeit, sich frei im Raum bewegen zu können

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra
Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra III-40
Levitation u. Unverletzbarkeit - Udana Meisterung – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra - Kap. 3, Vers 40
Länge: 10 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Wissen zu Levitation – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 3.40 (bei ihr Sutra 3.39)
Länge: 14 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Video von Ahnand Krishna zur Sutra
Kräfte von Samyama, Class 60: Asha Nayaswami zu Sutra 3:40-46
Länge: 75 Minuten
Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.
Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra
Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*
Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*
Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎
Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*
Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎
Alte Schriften auf Yoga-Welten.de
- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert
- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst
- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita
- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata
- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung
- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst
- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt
➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de
Weitere oft aufgerufene alte Schriften
- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik
- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung
- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara
- Mrigendra Tantra Yoga Pada
- Die Shiva Samhita


