
Patanjali Yogasutra Kapitel 4: Kaivalya-Pāda – über die Befreiung
In diesem vierten und letzten Kapitel der Yoga Sutras erläutert Patanjali Kaivalya, die wahre Freiheit des Menschen. In diesem Kapitel steht der Weg der Entsagung im Fokus, der Ablösung von der diesseitigen Welt. Dieses Kapitel liefert Einblick in den Kerngehalt indischer Weltsicht.
Janmaushadhi-mantra-tapah-samâdhi jâh siddhayah
जन्मओषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः
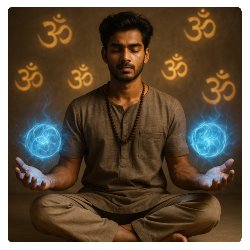 Siddhis sind außergewöhnliche Fähigkeiten, Kräfte oder Wahrnehmungen. Die erste Sutra des vierten Kapitels im Yogasutra (betitelt mit Kaivalya Pada) nennt fünf Möglichkeiten, solche Siddhis zu erlangen.
Siddhis sind außergewöhnliche Fähigkeiten, Kräfte oder Wahrnehmungen. Die erste Sutra des vierten Kapitels im Yogasutra (betitelt mit Kaivalya Pada) nennt fünf Möglichkeiten, solche Siddhis zu erlangen.
Auch in diesem Kapitel des Yogasutra will uns Patanjali zum Yoga-Ziel Kaivalya, der endgültigen inneren Freiheit, führen. In den folgenden Sutras geht Patanjali auf die schier übermächtigen Probleme eines Yogis ein, der Kaivalya (nur) mit eigenem Willen erlangen möchte und gibt viele Tipps und Erläuterungen. Ein wenig wirkt das vierte Kapitel so, als ob Patanjali noch einmal alles ansprechen wollte, was in die Logik der vorigen drei Kapitel nicht hineinpasst hat.
jāty-antara-pariṇāmaḥ prakṛty-āpūrāt
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्
Veränderung ist kein Projektplan. Kein Willensakt. Und schon gar nicht die Folge exzessiver Selbstoptimierung. So könnte man diese Sutra lesen.
In Yogasutra 4.2 deutet Patanjali auf eine Wahrheit hin, die so einfach ist, dass sie leicht übersehen wird: Wachstum geschieht, wenn innere Kräfte überfließen. Nicht vorher. Nicht später. Was das mit Pflanzen zu tun hat, mit psychologischer Reifung – und mit deinem ganz persönlichen Yogaweg –, zeigt dieser Artikel. Mit vielen Kommentaren und Deutungen zu dieser Sutra.
Weiterlesen: Yoga Sutra IV-2: Die überfließenden Kräfte der Natur bewirken die Umwandlungen
nimittam aprayojakam prakëtînâm varaña-bhedas tu tataï kæetrikavat
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनांवरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्
Dieser Artikel führt durch Patañjalis Yogasutra 4.3 – vom alten Gleichnis des Bauern bis zur Neurowissenschaft – und zeigt, wie Hindernisse lösen oft wirksamer ist als "Ergebnisse erzwingen" sein soll. Die klassischen Kommentare liefern die Tiefe, moderne Studien die Bodenhaftung, und konkrete Übungen sorgen dafür, dass aus Philosophie Praxis wird: weniger Druck, mehr Durchfluss. Und wer weiß, wer bereit ist, Jäten wichtiger zu nehmen als Zerren, wird vielleicht rasch erleben, wie erstaunlich oft das Richtige von selbst geschieht – unaufgeregt, aber hartnäckig.
Nirmâna-chittâny asmitâ-mâtrât
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्
Wieder eine Sutra über die Auswirkungen der Ego-Verhaftung. Indirekt auch eine Sutra über die Verkennung von Purusha, unserem Wahren Selbst. Wer glaubt, das eigene Ich sei ein fester Kern, der unverrückbar durch alle Lebenslagen trägt, bekommt von Yogasutra 4.4 einen leisen, aber spürbaren Klaps auf die Schulter – und den Hinweis: „Schau genauer hin.“
Weiterlesen: Yoga Sutra IV-4: Die Bewegungen des Geistes entstehen aufgrund des Ichgefühls
pravṛtti-bhede prayojakaṁ cittam-ekam-anekeṣām
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्
Dieses Sutra erzählt von der Einheit hinter all unseren Gedanken, Rollen und Masken. Die alten Meister Vyasa, Shankara und Mishra haben darüber gestritten, erklärt, ergänzt – und die moderne Wissenschaft nickt inzwischen (teilweise) mit.
Tatra dhyānajamanāśayam
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्
Wenn du möchtest, dass deine spirituellen Fortschritte von Dauer sind, muss dein Geist sich so grundlegend verändern, dass dein ganzes Wesen auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Abkürzungen (Schleichwege, Drogen, intensive Atemübungen etc.) oder intelligente Übungsmethoden können dich kurzfristig in jene Zustände versetzen, aber du bist nicht in ihnen gefestigt. Völlige Absichtslosigkeit in Denken und Handeln soll darum ein grundlegender Wesenszug eines Yogis sein.
Die Meditation, wie sie im Yogasutra gelehrt wird, soll zu dieser grundlegenden Wandlung führen. Das Yogasutra sagt, dass alles, was wir tun und denken Folgen hat. Nicht so der Geist, der aus der Meditation entsteht.
Dieser Artikel führt durch klassische Kommentare, moderne Deutungen und wissenschaftliche Befunde und zeigt, warum dieses Sutra mehr ist als bloße Philosophie: Es ist eine Einladung zum Ausprobieren.
Karmâshuklâkrishnam yoginas tri-vidham itareshâm
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम्
Yogasūtra 4.7 klingt unscheinbar – „Handlungen des Yogī sind weder schwarz noch weiß“ –, doch in dieser Kürze steckt ein ganzer Kosmos. Wer genauer hinschaut, stößt auf die Frage, wie wir handeln, warum wir handeln und welche Spuren wir damit in uns selbst hinterlassen. Karma.
Der Artikel beleuchtet klassische Kommentare von Vyāsa und Śaṅkara, würzt sie mit neueren psychologischen und neurowissenschaftlichen Einsichten und stellt sie neben alltagspraktische Beispiele. So handelst du wie ein Yogi.
tataḥ tad-vipāka-anugṇānām-eva-abhivyaktiḥ vāsanānām
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्
Yogasutra 4.8 ist kein frommes Zitat für yogische Postkarten, sondern eine präzise Gebrauchsanweisung für das menschliche Schicksal: Was wir denken und tun, kehrt zu uns zurück – nicht als Strafe, sondern als Spiegel unserer eigenen Neigungen. Aber nur dann, wenn passende Bedingungen herrschen. Dieser Artikel zeigt, wie klassische Kommentatoren und moderne Forschung denselben Nerv treffen, und warum es sich lohnt, in Meditation und Alltag die eigenen „Früchte“ einmal genauer zu kosten.
jâti-deåa-kâla vyavahitânâm apyânantaryaä smëti-saäskârayor eka-rûpatvât
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्
Wer glaubt, das eigene Leben sei eine Abfolge zufälliger Momente, wird beim Blick in Patañjalis Yogasutra eines Besseren belehrt. Hier entfaltet sich die unbequeme wie tröstliche Idee, dass nichts je verschwindet – kein Gedanke, kein Wunsch, kein Streit, kein liebevoller Blick. Alles legt Spuren, die bleiben und irgendwann wiederkehren, manchmal wie ein Echo, manchmal wie ein Bumerang. Der folgende Text lädt dazu ein, diesen uralten Gedanken aus klassischer und moderner Sicht zu betrachten – und sich selbst darin wiederzufinden.
Behalte dabei im Hinterkopf: Gemäß indischer Philosophie überträgt sich Karma von Geburt zu Geburt. Nur so lassen sich scheinbare Ungerechtigkeiten oder Zufälle in einem jetzigen Leben logisch in die Karmalehre integrieren.
Tâsâm anâditvam châshisho nityatvât
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्
Dieser Beitrag führt in die Kommentare zu Yogasūtra 4.10 ein. Er ordnet die großen Wörter (āśiṣaḥ, saṃskāra, abhiniveśa) mit klassischen Kommentaren und legt dann die Kabel zur Gegenwart: Was sagt die Gehirnforschung, was die Evolutionsbiologie, und – wichtiger – wie übst du das in Meditation und Alltag?
hetu-phala-āśraya-ālambanaiḥ-saṁgṛhītatvāt-eṣām-abhāve-tad-abhāvaḥ
हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः
Wieder eine sehr praxisrelevante Sutra. Patanjali nennt hier die Gründe bzw. Ursachen, warum wir auch an ungünstigen Wünschen und Neigungen festhalten. Und er sagt, wie diese Wünsche/Neigungen schwächer werden können bzw. wie wir sie ganz verlieren können. Die Kommentatoren der Sutra ergänzen dies mit vielen Praxistipps. Zwischen klassischer Philosophie, psychologischer Feinmechanik und modernen Studien spannt sich ein Faden, der überraschend praxisnah ist: Wer die Stützen seiner Wünsche kennt, kann sie auch unterbrechen. Und genau das schenkt Freiheit, die sich im Alltag spürbar macht – nicht nur auf dem Meditationskissen.
Atîtânâgatam svarûpato ¢sty adhva-bhedâd dharmânâm
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तिअध्वभेदाद् धर्माणाम्
Zeit ist ein widerspenstiges Phänomen: sie rinnt uns zwischen den Fingern, klebt uns in Erinnerungen fest und lockt uns mit Zukunftsbildern. Patanjalis Yogasūtra 4.12 und seine alten wie modernen Kommentare drehen dieses Bild um – sie behaupten, Vergangenheit und Zukunft existierten in eigener Form, und nur die Gegenwart zeigt, was sichtbar sein soll. Wer sich darauf einlässt, entdeckt nicht nur Philosophie, sondern ein Werkzeug, das die eigene Wahrnehmung von Leben, Praxis und Bewusstsein leiser, tiefer und womöglich klarer macht.
te vyakta-sūkṣmāḥ guṇa-atmānaḥ
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः
Wieder – wie so häufig im 4. Kapitel – eine rätselhafte Sutra, die viele Kommentare auf den Plan ruft.
Nach dem Samkhya (altes indisches Philosophiesystem) ist das Universum (die Urmaterie Prakriti) durch drei Gunas, meint wesentliche Eigenschaften oder Kennzeichen, charakterisiert: Tamas (steht für Trägheit, Dunkelheit, Chaos), Rajas (Rastlosigkeit, Bewegung, Energie) und Sattva (Klarheit, Güte, Harmonie).
Yogasūtra 4.13 erklärt, dass alles Wahrnehmbare und auch das noch Ungeborene aus diesen drei Guṇas besteht. Was trocken klingt, entpuppt sich als Einladung, den eigenen Alltag mit neuen Augen zu sehen – denn wer erlebt und bewusst wahrnimmt, dass selbst Gedanken, Erinnerungen und Gefühle nur Spielarten dieser drei Grundkräfte sind, genießt beispielsweise Gelassenheit an Stellen, wo zuvor Drama herrschte.
Dieser Artikel verbindet klassische Kommentare von Vyāsa und Śaṅkara mit modernen Deutungen, psychologischen Studien und praxisnahen Übungen – ein Versuch, Philosophie aus dem Elfenbeinturm auf die Yogamatte und mitten in den Alltag zu holen.
pariñâmaikatvâd vastu-tattvam
परिणामैकत्वाद्व्स्तुतत्त्वम्
Hochphilosophisch geht es weiter. Yogasutra 4.14 klingt wie ein feines Stück Philosophie – „alles ist im Wandel“ liest sich schnell, doch die Tiefe erschließt sich erst, wenn man sie spürt. Der Artikel nimmt dich mit in alte Kommentare, moderne Auslegungen und wissenschaftliche Parallelen. Er zeigt, wie diese knappe Formel von Patanjali nicht nur ein Gedankenspiel bleibt, sondern zur Haltung wird: in der Yogapraxis, in der Meditation, im Alltag – und manchmal auch im banalen Zähneputzen.
Vastu-sâmye chitta-bhedât tayor vibhaktah panthâh
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः
Mit IV-15 beginnt ein Abschnitt, der bis Sutra IV-27 Hindernisse in der Meditation beschreibt, die ein Erfahren der universellen Einheit behindern. Es beginnt in dieser Sutra damit, dass die Wahrnehmung von Objekten (und Erlebnissen, Situationen …) als subjektiv angesehen wird. Es besteht eine objektive Realität, aber unser Geist nimmt diese subjektiv wahr.
Dieser Artikel öffnet ein stilles Fenster in das, was zwischen „da draußen“ und „hier drinnen“ geschieht: Warum gemäß Yogasutra zwei Menschen im gleichen Raum zwei verschiedene Welten sehen. "Veel Köpp - veel Sinn", sagte meine Oma immer. Moderner ausgedrückt: Unsere Überzeugungen, Einstellungen, Meinungen, Gefühle etc. filtern unsere Wahrnehmung.
na caika-citta-tantraṁ cedvastu tad-apramāṇakaṁ tadā kiṁ syāt
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्
Ein Koan fragt: Im Wald fällt ein Baum, doch niemand ist dort. Wie klingt dieser fallende Baum?
Mit diesem Sutra (das nicht in allen Fassungen des Yogasutras enthalten ist) stellt sich Patanjali gegen die Vedanta-Philosophie. Diese postuliert, dass Objekte nur deswegen existieren, weil ein Bewusstsein sie wahrnimmt. Yogasutra 4.16 hingegen erklärt, dass Dinge eigenständig bestehen. In diesem Artikel findest du klassische und moderne Kommentare, Brücken zur Wissenschaft – und handfeste Praxisideen.
tad-uparâgâpekæitvâc-cittasya vastu jõâtâjõâtam
तदुपरागापेक्षत्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्
Wer das vierte Kapitel des Yogasutra liest, begegnet einer irritierenden Wahrheit: Die Welt liegt nicht einfach so offen vor uns, sie wird uns vielmehr nur dort sichtbar, wo unser Geist bereit ist, sich färben zu lassen. Ein Satz wie aus einem alten Text, und doch wirkt er aktueller als manch modernes Achtsamkeitsbuch. Dieser Artikel bündelt klassische Kommentare, moderne Auslegungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sutra 4.17 – und zeigt, warum es nicht egal ist, ob der Geist wie blankes Eisen auf die Magneten der Welt reagiert oder stur in seiner eigenen Ecke rostet.
Sada jnâtash chitta-vrittayas tat-prabhoh purushasyâparinâmitvât
सदाज्ञाताः चित्तव्र्त्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्
Weiter geht es mit yogischen Erkenntnissen zur Natur unseres denkenden Geistes (yogisch: Citta) und zu dessen Verhältnis zu dem, was wir wirklich sind – unserem Wahren Selbst, unserer Seele, auf yogisch: Purusha.
Sutra 4.18 erklärt, dass hinter all dem mentalen Durcheinander ein ruhiger Beobachter lebt. Dieser Artikel bietet Übersetzungen und Kommentare von Klassikern wie Vyāsa oder Vācaspati Miśra, sowie Brücken in die heutige Praxis, bis hin zu Einsichten aus Psychologie und Neurowissenschaft. Leserinnen und Leser finden auch Anregungen, wie sich die alte Weisheit im Alltag spüren lässt.
Na tat-svābhāsaṁ dṛśyatvāt
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्
Ein wichtiger Punkt in der Yogaphilosophie: Unser Geist kann nie durch sich selbst erleuchtet werden. Wir brauchen dazu die Erkenntniskraft unseres wahren Selbstes. Anders ausgedrückt: Der Verstand allein findet nicht zur Erleuchtung. Dieser Artikel bündelt klassische Kommentare, praktische Übungen und aktuelle Bezüge – und gibt so einen Kompass für alle, die nicht nur lesen, sondern erfahren wollen, wie sie diese alte Weisheit heute selbst erfahren können.
Eka samaye c-obhaya-an-avadhāraṇam
एकसमये चोभयानवधारणम्
Eigentlich eine ganz banale Erkenntnis und auch in der modernen Neurowissenschaft bekannt: Multitasking ist nur möglich, wenn der Geist schnell hin und her springt. Aber für den Weg des Yoga ergeben sich mehrere Konsequenzen aus der Eigenschaft des menschlichen Geistes, sich nur auf eine Sache auf einmal konzentrieren zu können. Denn auch das Bewusstsein und die davon wahrgenommenen Objekte können nicht gleichzeitig erfasst werden.
Schauen wir uns klassische Kommentare (u. a. Vyāsa, Vācaspati Miśra, Bhoja) an und vergleichen diese mit modernen Befunden aus Kognitionswissenschaft und Neuropsychologie und übersetzen das alles in Praxis: Meditation, Alltag, interaktiver Stroop-Test.
Weiterlesen: Yoga Sutra IV-20: Der Geist kann nicht zwei Dinge auf einmal erfassen
Chittântara-dëåye buddhi-buddher atiprasaògaï smṛti saṅkaraś ca
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च
Das vierte Kapitel des Yogasutra ist kein leichter Stoff, sondern ein dichtes Gewebe aus Logik, Mystik und Psychologie. Wer sich darauf einlässt, stößt auf eine zentrale Botschaft: Hinter deinem denkenden Geist findet sich dein wahres Selbst. Dieser Artikel bringt die klassischen Kommentare, moderne Stimmen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sutra 4.21 zusammen und versucht sich an der Erläuterung der Logik hinter den Deutungen.
Citer apratisamkramâyâs tad-âkârâpattau sva-buddhi-samvedanam
चितेरप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्
Mit dieser Sutra wiederholt Patanjali, was er schon in Sutras zuvor gesagt hat. Allerdings mit eigener Akzentuierung. Er sagt klar: Wenn es dir gelingt, bei voller Wachheit deine Gedanken zum Schweigen zu bringen, wirst du dich selbst erkennen.
Dieser Artikel bündelt klassische Kommentare, Übersetzungsvarianten, Verbindungen zu moderner Wissenschaft und nennt den Yogapfad zum ruhigen Geist.
Draṣṭṛ-dṛśy-opa-raktaṁ cittaṁ sarva-artham
द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्
Wieder keine ganz unwichtige Sutra, vor allem, wenn man der Interpretation von Vyasa zustimmt. Er verneint vehement, dass unser Verstand auch unser Selbst ist. Vielmehr gebe es einen Purusha hinter dem (materiellen) Verstand, welcher letztendlich der wirklich Erkennende ist. Dein Geist "färbe" sich stattdessen mit der Welt und mit dir selbst, er wirkt dadurdch lebendig, ist aber in Wahrheit nur Bühne. Dieser Punkt wird in den Neurowissenschaften heutzutage ähnlich diskutiert. Dieser Artikel bietet dir eine Mischung aus alten Kommentaren, moderner Wissenschaft und handfesten Übungen, die dir helfen können, den Spiegelcharakter deines Geistes zu begreifen – im Sitzen auf dem Kissen ebenso wie mitten im Alltagstrubel.
tad asaòkhyeya-vâsanâbhiå citram api parârthaä saähatya-kâritvât
तदसंख्येयवासनाभिश्र्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्
Auch wenn die Übersetzung dieser Sutra abstrakt klingt, merkst du, wenn du dich hineinliest, wie nah die Gedanken des Yogasūtra an deinem eigenen Erleben sind. Der Geist, so bunt er sich gebärdet, ist nicht Selbstzweck – er arbeitet, damit du als stiller Zeuge überhaupt erkennen kannst, was Genuss, Leid oder Freiheit bedeutet. Wer das begreift, findet ein Werkzeug zur Meisterung von Alltag, Meditation und dem großen, nie endenden Spiel von Geist und Bewusstsein.
Vishesha-darshina âtma-bhâva-bhâvanâ-vinivrittih
विशेषदर्शिनः आत्मभावभावनानिवृत्तिः
Wieder geht es um die Entwicklung von Unterscheidungsvermögen für das Erreichen von innerer Freiheit – Kaivalya. Wer das eigene (wahre) Selbst erkennt, entdeckt nicht neue Antworten, sondern das Verstummen alter Fragen. Der Text und seine Kommentare kreisen um eine Erfahrung, die kaum in Worten fassbar ist – das Aufhören der Identifikation mit den unruhigen Bewegungen des Geistes. Dieser Artikel lädt dich ein, die klassischen Stimmen, moderne Deutungen und eigene Übungswege zusammenzudenken.
Tadā viveka-nimnaṁ kaivalya-prāg-bhāraṁ cittam
तदा विवेकनिम्नङ्कैवल्यप्राग्भारञ्चित्तम्
(Yoga-)Philosophie wirkt manchmal trocken, doch Patañjalis Yogasutra 4.26 bringt eine verblüffend praktische Pointe: Wenn der Geist einmal die Klarheit der Unterscheidung gefunden hat, kippt sein ganzes Gewicht in Richtung Befreiung – wie ein Stein, der auf eine Schräge geschoben wird und dort von der Schwerkraft nach unten gezogen wird.
Der folgende Artikel bündelt klassische Kommentare, moderne Stimmen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sutra 4.26 und zeigt, wie sich diese alte Weisheit im Alltag spüren lässt: in Meditation, im Umgang mit Ärger oder einfach im Warten an der Kasse.
tac-chidreæu pratyayântarâñi samskârebhyah
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः
Wir befinden uns im vorletzten Abschnitt des Yogasutras, Thema ist weiter die Unterscheidungskraft Viveka. Diese ist die Basis für die innere Freiheit (Kaivalya) der/des nach Erleuchtung Strebenden. Patanjali macht hier darauf aufmerksam, dass auch ein weit entwickelter Yogi immer wieder durch seine unbewussten Prägungen zeitweise vom Pfad gestoßen werden kann. Die Vorprägungen (Samskara) trüben dann die Unterscheidungskraft. Folgende Fragen stellen sich: Wie erkenne ich, dass meine Unterscheidungskraft schwächelt, ich irrigen Ansichten fröne? Und: Wie erkenne ich wieder, was richtig ist?
Dieser Artikel führt dich durch klassische Kommentare, moderne Deutungen und wissenschaftliche Parallelen – und zeigt dir, warum die alten Eindrücke (Samskaras) selbst im klarsten Geist noch herumspuken, und wie du damit umgehen kannst.
Hânam eshâm kleshavad uktam
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः
Mit dieser Sutra erhältst du eine Landkarte, wie du die letzten Fesseln des Geistes auflösen kannst. Wir erläutern das im Artikel durch klassische Kommentare, moderne Einsichten und praxisnahe Impulse. Hier findest du Klarheit darüber, was genau mit „Prägungen“ gemeint ist, wie die alten Meister sie verstanden haben – und wie du ihre Lehre im eigenen Geist erfahren kannst, mit Stille und Methode, nicht mit Idealismus. Denn jene letzten Fäden, die dich noch zurückhalten – sie sind lösbar.
prasaṁkhyāne-'py-akusīdasya sarvathā vivekakhyāteḥ dharma-meghas-samādhiḥ
प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः
Die Sutras IV-29 bis 34 legen dar, welche Segnungen wir erhalten, wenn alle Hindernisse durch Meditation (Dhyana) beseitigt wurden. In diesem Artikel erkunden wir die tiefere Bedeutung von Yogasutra 4.29. Du erfährst, was Dharma-Megha-Samadhi genau bedeuten könnte und warum hier alle Wünsche – sogar der Wunsch nach Allwissenheit oder Befreiung – an Bedeutung verlieren bzw. verlieren müssen, um diesen Zustand zu erreichen. Wir beleuchten, wie klassische Gelehrte wie Vyasa und Shankara diesen Zustand beschrieben haben und wie moderne Lehrer ihn heute interpretieren. Dabei wirst du auch entdecken, welche Paradoxie am Ende des spirituellen Weges wartet: Oft erreicht dich das höchste Ziel erst dann, wenn du aufgehört hast, es zu verfolgen.
tataï kleåa-karma-nivëttiï
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः
Patañjali und seine Kommentatoren, allen voran Vyāsa, sprechen hier von nichts Geringerem als dem Ende des Leidens – nicht als Flucht, sondern als ein Erwachen, auch mitten im Alltag. Der Artikel führt dich durch klassische Deutungen, moderne Erkenntnisse und ganz praktische Wege, wie du diese Sutra erleben kannst.
Weiterlesen: Yoga Sutra IV-30: Dann folgt das Ende aller Leiden und des Karma
Tadâ sarvâvarana-malâpetasya jnânasyâ-nantyâj jneyam alpam
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम्
Wir nähern uns dem Ende des Yogasutra. In IV-31 betont Patanjali erneut, dass der Lohn am Ziel des Yoga die Vorstellungen des normalen menschlichen Geistes übersteige. Das Wissen wird unendlich. Wie ist das zu verstehen? Wie können wir das üben?
tataḥ kṛtārthānaṁ pariṇāma-krama-samāptir-guṇānām
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्
In den letzten drei Versen des Yogasutras beschreibt Patanjali, wie für einen erleuchteten Menschen das normale Dasein endet, sich Raum, Zeit und Welt auflösen, das Streben endet. Am Ende soll eine vollkommene Freiheit warten.
Dieser Artikel führt dich dorthin, wo Patanjali leise wird: zu dem Moment, in dem die Welt ihr Werk getan hat und die inneren Rädchen aufhören zu klicken. Du bekommst eine klare Landkarte – von den klassischen Kommentaren bis zu Übungen, die du heute ausprobieren kannst.
kæaña-pratiyogî pariñâmâparânta-nirgrâhyaï kramaï
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रार्ह्यः क्रमः
Die vorletzte Sutra. Der erleuchtete Mensch erkennt das Wesen der Zeit.
Dieser Artikel bietet dir nicht nur eine philosophische Einführung in Yogasutra 4.33 und dessen Kommentare, sondern auch Werkzeuge zur direkten Erfahrung deines eigenen Zeitbewusstseins. Du wirst erahnen (oder sogar verstehen?), wie die Begriffe kṣaṇa, krama und pariṇāma zusammenwirken – und wie du in Meditation oder Alltag kleine Brücken schlagen kannst, um die Lehre selbst nachzuempfinden.
Purushârtha-shûnyânâm gunânâm pratiprasavah kaivalyam svarûpapratishthâ va chiti–shakter iti
पुरुषार्थशून्यानां गुणानांप्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति
Die letzte Sutra. Das Yogastura beginnt mit ata (jetzt) und endet mit iti (Ende). Patanjali schildert (erneut) Kaivalya, das Ziel des Yogaweges, die Befreiung. Unser Selbst, unsere Seele, findet zu ihrer wahren Natur.
Mit diesem Artikel versuche ich, Yogasutra 4.34 zu erschließen, beginnend bei den Schlüsselbegriffen, über klassische Kommentare bis hin zu modernen Anknüpfungen und Übungsanregungen. Keine ganz einfache Angelegenheit, da dieser Zustand nicht mit unserem normalen Alltagsbewusstsein vergleichbar sein soll.
